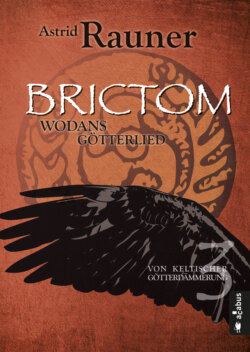Читать книгу Brictom - Wodans Götterlied. Von keltischer Götterdämmerung 3 - Astrid Rauner - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDer Zorn des Gottes
Aigonn war von Stimmen umgeben. Das leise Flüstern kam von allen Seiten, ein beständiges Rauschen, dem er lauschte, während sich sein Geist wider Willen in die Gegenwart vorwagte. Ein kühnes Unterfangen. Und er wurde sofort dafür bestraft.
Der Lärm war kaum zu ertragen. Schreie, Rauschen, ein bedrohliches Tosen, das ihm alle Nackenhaare in die Höhe trieb, fuhren direkt unter seine Haut. Sobald er die Augen aufschlug und die Schwärze des Schlafes trübem Flammenlicht wich, wusste er, dass er einen Fehler begangen hatte. Nächte wie diese waren nur zu ertragen, wenn man sie schlafend verbrachte. Dann war das Chaos am nächsten Morgen entweder vorbei oder man selbst tot.
Schlaftrunken richtete sich Aigonn von seinem Schlaflager auf. Das Stimmengewirr deutet darauf hin, dass außer ihm in dem kleinen Langhaus niemand geschlafen hatte. Ein Wimpernschlag genügte, damit er vier Gestalten ausmachte: zwei Männer, ein Kind, eine Frau. Sie schleuderten Worte einer fremden Sprache durch den Raum, deren Silben zum Teil im Tosen des Sturmes erstickten. Das Lied des Sturms erfüllte jeden Winkel des Hauses. Aigonn hörte die Geister des Meeres singen und johlen, ein Lied grenzenlosen Übermutes auf dem Weg der Verwandlung in die Raserei.
Aigonn musste sich einfach nur zurückfallen lassen. Er konnte die Augen schließen und Erschöpfung simulieren. Vielleicht dauerte es die halbe Nacht, wieder Schlaf zu finden, doch der Schatten des Hausdaches und sein Felllager würden ihn fernhalten von dem Chaos, in das Wode dieses Land am Ufer des großen Gottes gestürzt hatte. Niemand würde bemerken, dass er erwacht war und ihn zu sich rufen, damit er sich dem sinnlosen Kampf gegen den Sturm anschloss. Zu nah waren die Bilder noch, die er an der Felswand im Land der Daukionen zurückgelassen hatte, als dass er es wagen würde, dem zornigen Herren des Sturms noch einmal die Stirn zu bieten.
Schlafen. Das Wort allein erschwerte seine Lider. Ihr Glühen war ein Echo des Fiebers, das ihn seit der Sonnenwende verfolgte. Ja, schlafen. Ein guter Gedanke. Wenn morgen der Himmel einstürzte, konnte er es doch nicht aufhalten.
Plötzlich ein Krachen. Einen Herzschlag innehalten. Dann fuhr der heulende Sturm in das Langhaus. Aigonn riss die Hände an die Ohren, wobei er sich die Fingernägel in die Kopfhaut bohrte. Das Singen der Windgeister wurde laut bis zur Unerträglichkeit. Ihre spitzen Stimmen gruben sich durch den Knochen in seinen Kopf, zermarterten seine Nerven. Ein Schreien, irgendjemand schrie. Was, bei Lugus, war überhaupt geschehen? Es spielte keine Rolle, wenn es nur aufhörte, das Lied der Geister. War Aigonn es selbst, der so brüllte? Seine Stimmbänder schmerzten. Ja, er selbst musste es sein. Aufhören, echote eine Stimme in seinem Kopf die sinnlose Bitte an das Heer des Wode, das darauf nur zu lachen schien.
„Fremder!“, wehte es irgendwann an seine Ohren. „Fremder!“ Die Bewohner des Langhauses gebrauchten skandische Worte, um sich mit Aigonn zu unterhalten. Dieser beging den Fehler, die Hände von den Ohren zu nehmen. Sofort wurden sie mit starkem Griff gepackt. Als man ihn in die Höhe zog, wurde Aigonn schwindelig. Die Bilder drehten sich noch nach zweimaligem Blinzeln, dann machte er im Dämmerlicht des Hauses endlich das Gesicht eines Mannes vor sich aus.
„Fremder, wie kannst du schlafen? Die Götter sind rasend!“ Blondes Haar, von grauen Strähnen durchsetzt, wirbelte ihm vor die Augen. Viel älter als Rowilan konnte dieser Mann nicht sein, dessen Namen er sich immer wieder aufs Neue sagen lassen musste. Das Leben hatte ihn nur mit einer Härte gezeichnet, die ihn im Schattenwurf der Flammen zum Greis zu verwandeln schienen.
Keinen Augenblick später fuhr Aigonn erschrocken zusammen. Das nächste Krachen, das unzweifelhaft von brechendem Holz ausgelöst wurde, verschuf noch weiteren Sturmgeistern Einlass in das Langhaus. Für wenige Herzschläge war den dort Unterschlupf Suchenden noch Schutz vergönnt, dann sah Aigonn die Silhouette eines Stücks grasgedeckten Dachs davonfliegen, bevor prasselnder Regen auf sie niederging.
Was der Mann, der seinen jungen Gast noch immer am Handgelenk hielt, gegen den Regen brüllte, verstand Aigonn auch ohne Kenntnis ihrer Sprache als Fluch. Und sein Ton machte deutlich, dass er kein weiteres Zögern dulden würde. Bis Aigonn die Situation richtig erfassen konnte, hielt er ein starkes Nesselseil in den Händen. Die anderen Männer hatten es bereits an der Verbundstelle zweier Deckenbalken verknotet, um seine Enden an Pflöcke zu binden. Auf geflochtene Grasmatten und Felle am Boden wurde keine Rücksicht genommen. Aigonn stand einer Salzsäule gleich da, sah zu, wie die Männer die Pflöcke durch den Bodenbelag trieben und wenig später die Stärke des Seils auf eine harte Probe gestellt wurde.
Der Ruck, mit dem der Wind am Dach riss, brachte Aigonn ins Stolpern. Ein weiteres Paar Hände, das sich vor ihm an das Stück Seil klammerte, verhinderte, dass er der Länge nach zu Boden stürzte. Sobald der Sturm jedoch eine Böe lang Atem fasste, brüllte der blonde Mann seinen Gast an: „WORAUF, BEI DEN GÖTTERN, WARTEST DU DENN?“
Ja, worauf? Endlich wurde sich Aigonn dem Ernst seiner Lage bewusst. Es war Nacht, es war Winter. Die Luft im Haus, die der Sturm hinein trieb, war so erbärmlich kalt, dass sich der Atem des jungen Mannes in Nebel verwandelte. Und bis zum Sonnenaufgang würde es womöglich kein Dach mehr geben, das sie vor der tödlichen Witterung schützen konnte.
Diese Gewissheit rettete Aigonns Gedanken endlich aus der Trägheit des Schlafes. Das Adrenalin, das durch seine Adern jagte, weckte ungeahnte Kräfte. Kaum, dass er sein eigenes Seil um einen Pflock geschlungen und in die Erde getrieben hatte, lag das nächste Nesseltau in seinem Griff. Wie im Rausch jagte er durch das Langhaus, erklärte mit seinen Bewohnern dem Sturm den Kampf, der diesen mit johlendem Übermut erwidern wollte. Das nächste Stück Grasdach wurde davongetragen. Je länger Aigonn rannte, desto mehr schien es ihm, als schlafe er noch.
Die Müdigkeit, die sein linkes Auge niedersacken lassen wollte, weckte den sehenden Sinn. Mit flackerndem Blick erfasste er die Gestalten der Sturmgeister vor sich. Einen Wimpernschlag lang schien das Bild zu gefrieren, machte verschwommene Gesichter sichtbar, deren Augen sich in seine Richtung drehten.
„Würdig wolltest du sein!“, glitt eine tonlose Stimme durch das Zwielicht. „Kühner Aigonn, hast du deinen Mut verloren, als meine Diener dich aus Skandia trieben?“
Wode. Der Name des Sturmgeistes glich einer Beschwörung. Kein anderer als er lenkte das Chaos, das die ganze Welt einzureißen schien. Schritt um Schritt hatte er Aigonn auf seiner Heimreise von Skandia verfolgt. Einem Alptraum gleich hatte sein Sturm immer die Angst davor mitgetragen, was die Gegenleistung für Aigonns Kühnheit sein würde. Für die Kühnheit, einen Götterdiener herausgefordert zu haben, dessen Name „der Zornige“ bedeutete.
„Fremder“, riss eine Stimme Aigonns Gedanken in die Wirklichkeit zurück. Verwirrt blinzelte er gegen die aufkommende Erschöpfung, um festzustellen, dass der blonde Mann wieder an seine Seite geeilt war. Dessen schwielige Hand ruhte auf seiner Schulter, beschwörend plötzlich und von einer angstvollen Ruhe umgeben. „Fremder“, murmelte er. „Wenn du zu lange den Worten des Sturms lauschst, wirst du den Verstand verlieren. Höre auf mich!“
Aigonn nickte, weil irgendetwas in ihm sagte, dass es gut war. Nicht, weil sein Geist aufnahm, was man ihm sagen wollte.
„Die Sturmgeister pflanzen den Wahnsinn in deinen Kopf, wenn du zu sehr auf ihre Stimmen hörst. Kein Mensch ist ihnen gewachsen. Sei klüger als deine Freundin und ergib dich nicht ihrem Rufen!“
Freundin. Dieses Wort weckte Aigonns Bewusstsein auf einmal mit unerwarteter Heftigkeit. Ein Gesicht schoss vor sein Inneres Auge, eine junge Frau, mager, mit braunen, verfilzten Haaren und dunklen, unergründlichen Augen. Für einen Wimpernschlag schien die Erinnerung sie direkt neben ihm im Raum zu beschwören, bis Aigonn sich klarmachte, dass das, was er sah, nicht die Wirklichkeit war.
Erschrocken überflog er die Schlaflager. Sie war nicht hier im Haus! Der Blonde hatte Aigonn bereits stehengelassen, um einem der anderen Männer zu Hilfe zu eilen. Wo war sie? Draußen herrschte nichts als Verwüstung. Die Menschen schienen alle Macht verloren zu haben in einer solchen Nacht, hilflos den Elementen ausgeliefert, während nichts sonst Schutz versprach, als ein Gebäude, das mit einem Windstoß weggeblasen sein konnte. Niemand, der bei Sinnen war, verließ zu einer solchen Zeit seine einzige Zuflucht.
Außer Tiuhild.
Mit einem Herzschlag war Aigonn hellwach. Bevor er wusste, was er tat, rannte er durch das Langhaus. Im Rennen rief er dem Blonden, der sich verwirrt zu ihm umdrehte, zu: „Wo ist sie? Wo ist die junge Frau, die mit mir reist?“
„Du solltest nicht fragen, wo sie ist, Fremder, sondern was mit ihr geschehen ist! Die Geister haben sie auserwählt. Manche Menschen machen sich aus freiem Willen zum Opfer des Sturms. Du kannst nicht zu ihr hinaus!“
Der Mann hatte nicht ausgesprochen, als sich zwei Hände bereits in seinem Hemdkragen verkrallten. Erschrocken wollten seine Freunde dazwischen gehen, Aigonn jedoch riss seinen Oberkörper so nah an sich heran, dass er dem Blonden seinen Atem ins Gesicht spie. Woher er die Wut nahm? Er hatte keine Zeit darüber nachzudenken. Der Sturm, die Gefahr, alles um ihn herum hatte an Bedeutung verloren, da Aigonn mit einer Bedrohlichkeit zischte, die ihn selbst in Erstaunen versetzte: „Wohin sie gegangen ist, will ich wissen!“
„Nach draußen, an den Strand.“ Die Miene des blonden Mannes war undeutbar. Womöglich wäre es sinnvoll gewesen, an die Sorge, die durch sie schimmerte, einen Gedanken zu verschwenden. Bevor Aigonn darüber jedoch nachdenken konnte, hielt er die Tür schon geöffnet und kämpfte im selben Moment mit seinem Gleichgewicht. Wie ein Kampfschrei heulte der Sturm in seinen Ohren, warf sich gegen seinen Körper, dass er taumelnd nach hinten stolperte. Die Proteste der Hausbesitzer befahlen ihm, augenblicklich zurück in den Innenraum zu kommen, doch sie kümmerten ihn nicht. Nur ein Schritt genügte und das Loslassen der Tür, dann befand Aigonn sich im Reich der Stürme.
Im ersten Augenblick war der junge Mann zu nichts im Stande außer sich den Anblick einzuverleiben. Es war tiefste Nacht. Mitternacht, oder vielleicht schon Morgengrauen? Hinter den schwarzen Wolken, die den Himmel verdunkelten, war kein Rückschluss auf die genaue Nachtzeit zu ziehen. Das gewöhnliche Auge hielt Aigonn bereits geschlossen, da er wusste, dass es ihm hier nicht von Nutzen sein würde. Das Auge des Sehers jedoch zu benutzen, erleichterte ihm die Orientierung zunächst ebenso wenig.
Der Sturm war überall, ein tosender Wirbel aus gestaltlosen Erscheinungen, Geistern, deren Antlitze zu einem Rauschen verschwammen. Die Gewalt, mit der die Natur Aigonn begegnete, machte den Drang übermenschlich, die Flucht zurück ins Haus anzutreten. Zuvor aber erfassten seine Sinne eine fremde, viel vertrautere Kraft. Wie die Gischt ließ sie sich mittragen, kaum auszumachen zwischen dem Regen, der Aigonn von der Seite gegen den Körper prasselte. Bis er sich aus dem Schatten der Hauswand gelöst hatte, war seine Kleidung vollständig durchnässt. Das Entsetzen aber, das ihn vorwärts trieb, machte diesen Umstand nebensächlich.
Die Welt schien aus dem Gleichgewicht geraten. In der Dunkelheit der Nacht waren weder Gebäude, noch Zäune, noch Wege vernünftig auszumachen. Küste und Meer schienen eins geworden. Zwischen den ohrenbetäubenden Liedern der Sturmgeister hörte der junge Mann die donnernde Stimme des Meeresgottes. Wie der sein wellenschäumendes Maul ins Landinnere reckte, erblickte Aigonn mit Leichtigkeit über den kleinen Deich hinweg. Die Kräfte des Landes, des Bodens, des Waldes, des Wassers und des Windes – alles schien seine Grenzen gesprengt, seine Gestalten vermengt zu haben. Jeder Mensch, der glaubte, dieser Gewalt trotzen zu können, musste wahnsinnig sein. Und doch spürte er Tiuhild, ihre Kräfte, die Teil dieses Stroms geworden waren, als hätte sie sich selbst in einen Sturmgeist verwandelt.
Den Arm schützend an die Stirn gezogen, lief Aigonn gegen den Wind an. Wode machte jeden Schritt zum Gewaltakt, doch er musste zu ihr. Eine Ahnung beschleunigte seinen Herzschlag. Eine Erinnerung, die Aigonn seit Tagen mit Sorgen erfüllte, verlieh ihm die Kraft, gegen das Tosen der Elemente anzukämpfen. Die Gewalt ihres Spiels jedoch war beängstigend.
Knöcheltief versank Aigonn im Matsch. Fast wäre er hingefallen, als er halb blind gegen ein Gatter stolperte, dessen eine Hälfte vom Wind Richtung Birkenwald geweht wurde. Je näher er dem Ufer kam, den Dünen, deren sandiger Grund unter jedem seiner Schritte wegsackte, desto mehr zog es ihn zurück zu den Häusern. Irgendwo in dem Lärm des Unwetters hörte er Wode lachen. Ob Bösartigkeit darin lag, Vergnügen oder beides, das konnte Aigonn nicht einschätzen. Doch seine Macht, die das ganze Land umarmte, war einschüchternd genug, um die Wahrheit gleichgültig werden zu lassen.
Dann auf einmal stutzte der junge Mann. Es brauchte einen Augenblick, damit sein Geist begriff, was sein sehender Sinn längst erfasst hatte. Die bedrohliche, einschüchternde Kraft, die einem Nebel gleich über der Küste lag, war anderer Natur als Wodes Macht, die Aigonn seit Skandia verfolgte. Nein, kaum da der junge Mann die Kuppe der ersten Düne erreicht hatte, schien es, als verharre die Zeit für einen Moment. Der Wind und der Regen waren überall. Kein Tropfen ihrer Kraft war verloren gegangen, und doch schien Aigonn im Auge des Sturmes zu stehen. Für einen Herzschlag vergaß er zu atmen, als er begriff, was der Grund dafür war. Und dass er direkt daneben stand.
Wie Nebeldunst sickerte eine Kraft über die Küste. Sie war alt wie das Land selbst. Obgleich ihr eine Bedrohlichkeit anhaftete, die Herrschaft über Leben und Tod versprach, lag ihr doch eine sonderbare Vertrautheit inne. Vor allem die Gewissheit, dass sie genau hier her gehörte, an diesen Ort.
Fast hätte Aigonn sagen können, die Erscheinung ähnelte einem Mann. Er wusste, dass der Eindruck einer menschlichen Gestalt im Grunde eine Täuschung seiner Sinne war. Das, was er erblickte, war viel mehr als das kümmerliche Leben eines Sterblichen, der in diesem Chaos einfach davon geweht werden konnte. Nein, die Präsenz, die das Leuchten des Unvergänglichen umgab, war nicht die Zerstörung. Sie war der Sturm selbst, das Wasser, seine Bewegung.
In der Bewegung erstarrt, erinnerte Aigonn eine Stimme in seinem Kopf, dass er auf die Knie fallen, irgendein Zeichen der Demut geben musste. Was dort auf den Dünen stand und zu den Wellen hinaus blickte, war nicht weniger als ein Gott.
Der Donnerer. Wodes Herr, Wächter über das Wetter, über die Stürme und den Regen. Unwillkürlich schoss Aigonn ein Bild vor Augen, das er niemals vergessen würde. Nicht das erste Mal sah er einen der Herren der Welt leibhaftig vor sich stehen.
Diesmal jedoch war es anders. Aigonn erschreckte nicht seine Gegenwart, sondern die Tatsache, dass er ihm hier begegnete, außerhalb der Anderen Welt, an der Küste. Aigonn glaubte unter seiner Kraft zu vergehen, als diese sich für einen Augenblick in seine Richtung wandte und ihm zu verstehen gab, dass seine Anwesenheit bemerkt worden war. Bevor der junge Mann aber Gedanken daran verlieren konnte, was er tun sollte, hatte der Gott sich schon wieder von ihm abgewandt. Seine Aufmerksamkeit richtete sich der Küste zu. Der Donnerer schien das Schauspiel zu beobachten, wie Menschen dem Lied eines Flötenspielers lauschten, ginge nicht der Eindruck erwartungsvollen Abwartens von ihm aus, erwachsen aus dem beunruhigenden Wissen, dass sich die Welt längst veränderte, anders, als die Menschen es erwarteten.
Aigonns Herz setzte einen Schlag aus, als er endlich erkannte, was der Gott beobachtete. Mitten in den Dünen trotzte ein Mensch dem Sturm. Obgleich der Wind sie mit jeder neuen Böe in die Knie zu zwingen drohte, stand eine junge Frau mit ausgebreiteten Armen dem Meer zugerichtet. Die Wellen, die über den Küstenstreifen krachten, leckten an der sandigen Bastion der Sterblichen. Die Gischt und der Regen hatten sie soweit durchnässt, dass ihre Haare und Kleidung wie eine zweite Haut an ihrem Körper klebten. Doch statt ängstlich wie die anderen Bewohner der Siedlung in die Häuser zu flüchten, befreite die junge Frau ihre eigene Kraft. Aigonn wusste, wie angsteinflößend sie sein konnte. In diesem Augenblick, da sie jedoch Teil des Sturmes geworden schien, wirkte sie befremdend wie nie.
Tiuhild schien wie in Trance. Ob sie Aigonn bemerkt hatte, konnte dieser nicht sagen. Ihre Augen jedoch, die entrückt auf die See starrten, sprachen dagegen. Den jungen Mann schauerte es, als er hörte, dass sie gegen den Sturm anschrie. Und welches Vergnügen ihr dies zu bereiten schien.
„WODE!“, brüllte die Fennin immer wieder. „HERZ DER STÜRME! SIEHST DU, DASS ICH KEINE ANGST VOR DIR HABE? ICH BIN DEINER WÜRDIG, WODE!“
Aigonn wollte das Blut in den Adern gefrieren. In nur einem Augenblick schossen ihm unzählige Szenarien durch den Kopf, die diesen Worten folgen konnten. Er erwartete schon mit Schrecken, dass der Sturmgeist Wode Tiuhild mit der nächsten Böe in die Fluten reißen würde. Zu seiner Verwunderung aber geschah nichts dergleichen. Wode ließ sie gewähren und verschonte sie mit seinem Zorn. Die Arme von sich gestreckt, sandte sie ihre Kraft in den Wind. Aigonn wusste, dass sie im Stande war, die Geister, die ihre Gestalt umgaben, für kurze Zeit zu allem zu zwingen, was sie im Sinn hatte. Nur ähnelte die Art, wie sie ihre Fähigkeiten einsetzte dieses Mal fast einem Spiel. Keine Feindseligkeit schlug ihr von den Geistern im Sturm entgegen, keine Angriffslust – nur ein Lachen, das Aigonn selbst im Delirium wiedererkennen würde.
„TIUHILD!“, startete er den kläglichen Versuch, mit seiner Gefährtin Kontakt aufzunehmen. „TIUHILD, KOMM DA WEG!“
Eine Woge krachte gegen den Küstenstreifen. Das aufspritzende Wasser erreichte selbst Aigonn, der noch dreißig Fuß von der Fennin entfernt stand. Das Gesicht schützend vor einer zweiten Gischtwelle weggedreht, sah er im Aufblicken nur noch schäumendes Wasser.
„HILDA!“ Panisch stürzte der junge Mann auf die Dünen zu. Wie nahe er dabei den entfesselten Fluten kam, wurde plötzlich zur Nebensache. „HILDA!“ Keine Antwort. Wo war sie? Wenn das Meer sie davon gespült hatte, würde es keine Rettung mehr geben. Wieder eine Welle. Dann plötzlich durchbrach ein übermütiges Lachen das Tosen und diesmal allzu menschlich.
„ICH BESTEHE DEINE PRÜFUNG, WODE!“
Aigonn konnte es nicht fassen. Die Erleichterung ließ nicht genug Platz, um sich der Befremdlichkeit des Anblickes bewusst zu werden. Von Wellen umspült, tauchte ihr Kopf zwischen dem sturmgepeitschten Strandhafer auf. Das Wasser hatte sie von den Füßen gerissen, doch ihrem Übermut schien das keinen Dämpfer zu versetzen. Kopfschüttelnd sah Aigonn zu, wie sie sich erhob, vom Sturm gleich getragen, um wieder die Stimme an Wode zu richten. Diesmal aber schluckte das Lärmen jedes ihrer Worte.
Wie ohnmächtig stand der Seher da und beobachtete die unheimliche Szenerie. Tiuhild gab kein Anzeichen dafür, ihn überhaupt wahrzunehmen. Er würde sie schon zum Dorf zurückzerren müssen – falls es ihm gelang, in ihre Nähe zu kommen. „Wenn sie den Sturm nicht fürchtet, braucht sie auch deine Hilfe nicht“, höhnte es in seinem Kopf. „Wenn sie sich den Göttern anvertraut, liegt es nicht mehr in Menschenhand, sie zu retten.“
Widerwillig wandte Aigonn sich ab. Nachdem er sich bereits ein paar Schritte vorgekämpft hatte, warf der Seher noch einen Blick in die Dünen. Der Donnerer war nicht von der Stelle gewichen. Der junge Mann schauerte, als sich der Blick des Gottes abermals auf ihn richtete, von keinem Menschen zu ergründen. Für einen Pulsschlag nur schien eine tonlose Stimme in seinem Kopf zu flüstern: „Wir wissen beide, dass geschieht, was geschehen muss, Aigonn.“
Die Kälte, die Aigonn plötzlich empfand, rührte weder von seinen durchnässten Kleidern noch den eisigen Seeböen her. Beklommen wurde er sich gewahr, dass eine Ahnung der Zukunft an ihm vorüber gezogen war. Und er nicht wusste, ob er sie wahrhaben wollte.
„Es macht keinen Sinn, das Unvermeidliche zu fürchten, Aigonn. Du solltest dich nur fragen, warum du nicht auf es vorbereitet warst.“
Als Aigonn am nächsten Morgen erwachte, glaubte er, die ganze Nacht nicht geschlafen zu haben. Wann er wirklich am frühen Morgen Ruhe gefunden hatte, das konnte er nicht mehr sagen. Viel Zeit durfte seitdem jedoch nicht vergangen sein. Dafür war das Morgenlicht, das durch die angelehnte Haustür herein fiel, noch zu trüb.
Die Hände an die schmerzenden Schläfen gedrückt, schälte Aigonn sich aus seinen Fellen. Sein Gastgeber, der blonde Krieger, war bereits auf – oder hatte erst gar nicht geschlafen. Die tiefen Schatten unter seinen Augen gaben Aigonn eine Ahnung davon, welchen Eindruck er selbst bieten musste. Im Gegensatz zu dem Einheimischen, der ihn freundlich begrüßte, konnte er sich zu keinem Lächeln durchringen.
„Der Donnerer hatte Erbarmen mit uns“, eröffnete ihm der Krieger erleichtert und lud ihn ungefragt zu einem Becher Tee ein. „Er hat Wode zurückgerufen!“
Die Gelöstheit seines Gastgebers wollte noch nicht auf Aigonn übergreifen. Erschöpft von der ruhelosen Nacht trank er den Tonbecher erst zur Hälfte aus, bevor er sich umsah und vor seiner eigenen heiseren Stimme erschrak: „Es bleibt zu hoffen, dass er es sich nicht anders überlegt.“ Aigonn hustete. Wie zur Antwort auf seine Worte fuhr eine kalte Böe durch das Dach herein und offenbarte mehrere, gut vier Fuß lange Löcher im Reet, die man den Geräuschen nach wohl schon zu stopfen versuchte. Was den blonden Einheimischen dabei noch immer so fröhlich stimmte, wollte Aigonn nicht recht in den Sinn. Er ärgerte sich darüber, dass ihm der Name des freundlichen Kriegers schon wieder entfallen war, obwohl er ihn bereits zweimal danach gefragt hatte. Bisher war es ihm zum Glück gelungen, diesen Umstand geschickt zu überspielen.
Zu viele Menschen waren Aigonn seit dem Winter begegnet. Obgleich seit der Sonnenwende noch keine drei Monate vergangen waren, lag Skandia schon hinter ihm wie ein ferner Traum. Für die Demonstration seines Zornes hatte der Sturmgeist Wode, der Wilde Jäger, sich Zeit gelassen. Vanadottirs Häschern geschuldet hatten Aigonn und Tiuhild von einem abgelegenen Strand aus die Überfahrt zum Festland gewagt. Sie war so schnell und so ruhig verlaufen, dass Aigonn bereits misstrauisch geworden war – und das zu Recht. Kaum, da sie die Küste erreicht hatten, war der erste Sturm gekommen. Einen ganzen Monat hatten die beiden Gefährten bei den ansässigen Stämmen Unterschlupf suchen müssen, verdient mit viel harter Arbeit. Dennoch war Aigonn diesen Menschen unendlich dankbar in Anbetracht dessen, dass ihre Gastgeber selber hatten Hunger leiden müssen und zwei weitere Mäuler kaum stopfen konnten. Die wenigsten waren ihnen so freundlich begegnet wie der namenlose Blonde.
Aigonn hatte befürchtet, Tiuhild würde allein dieser körperlichen Belastungen nicht standhalten. Doch er hatte lernen müssen, dass sie zäher war, als er je würde sein können. Gleich wie mager und drahtig sie wirkte, konnte sie dem Seher aus dem Süden immer einen Schritt voraus sein, immer einen Vorsprung höher erklommen haben. Es war Aigonn, den die Nachwirkungen seiner Lungenentzündung zu längeren Pausen zwangen – und damit eine Unruhe in ihm nährten, die er nie für real gehalten hätte.
Alles in ihm trieb Aigonn nach Hause. Nach Hause – zurück an die Rur, in ein Land, das ihm vor einem dreiviertel Jahr noch so fremd gewesen war wie Skandia, die gewaltige Insel im Norden, auf der er im vergangenen Winter Unterschlupf gefunden hatte. Aigonn wusste nicht recht, wie ihm geschah. Die Welt um ihn herum veränderte sich schneller, als sein Geist es zu fassen vermochte. Oder vielleicht war auch er es, der sich veränderte. All das kümmerte ihn nicht, solange er wusste, was er zu tun hatte. Und seit jener Überfahrt zum Festland war er sich dessen bewusst. Er musste heimkehren, schneller als möglich. Aus einem einzigen Grund.
Rowilan. Der Schamane lebte. Nicht, wie jene Vision durch Vanadottir es ihm vorgegaukelt hatte. Es war ein allzu kurzer Moment gewesen, da er die Stimme des Schamanen gehört – nein, eigentlich nur gespürt – hatte. So wenige Worte Aigonn doch erhalten hatte, allen voran präsent war ein Gefühl gewesen, eine Emotion, für die er keinen Namen hatte.
Verzweiflung war der falsche Ausdruck. Vielmehr schien es die Akzeptanz einer Gewissheit gegenüber, die zu machtvoll war, um sich ihr zu erwehren. Die Gewissheit, dass es vielleicht längst zu spät war. Dass zu viel geschehen war, damit die Geschichte ein gutes Ende nehmen konnte. Rowilan schien bereits vor der Wahl zwischen Siechtum und Seuche zu stehen, um die Katastrophe so milde wie möglich zu gestalten. Eine Aufgabe, an der ein Einzelner zerbrechen konnte.
Es ist dein treuster Freund, der seinen Weg schon viel zu lange alleine geht. Lugus’ Worte brannten schmerzhafter als ein Brandeisen. Nie zuvor war Aigonn sich ihrer Bedeutung so bewusst geworden wie in jenem Moment, als Rowilans Hilferuf ihn ereilt hatte. Und er fürchtete bereits, dass die Situation in seiner Heimat noch weitaus schlimmer war, als er es sich jetzt ausmalen konnte.
Die fremden Worte, die draußen hin- und hergeworfen wurden, erinnerten Aigonn daran, dass ihn aber zunächst ganz andere Sorgen kümmern mussten. Vor wenigen Tagen erst hatten sie hier, an einer kleinen Küstensiedlung des Festlandes, Unterschlupf gefunden. In dem Irrglauben, dem Sturm, der sie vom Norden her verfolgt hatte, entkommen zu sein, waren sie eingekehrt. Und Aigonn plagte ein schlechtes Gewissen deswegen.
Der blonde Krieger war so freundlich zu ihnen gewesen. Ob der Einheimische wusste, dass sie, Aigonn und Tiuhild, das schreckliche Unwetter zu ihnen gebracht hatten?
Woher sollte er denn?
Trotzdem ertappte Aigonn sich dabei, die Miene seines Gastgebers zu erforschen, während dieser den Versuch gestartet hatte, sich den Sicherungsmaßnahmen des Hausgebälks und der daraus entstehenden Unordnung anzunehmen. Noch bevor Aigonn Gelegenheit gefunden hatte, seine eigene Hilfe anzubieten, eröffnete der Einheimische auf einmal ohne aufzusehen: „Du solltest einen Gang zum Strand wagen, Fremder!“
„Braucht man dort Hilfe?“
„Es gibt keinen Fleck im Dorf, wo nicht etwas getan werden müsste“, lachte der Blonde. „Aber das ist jeden Winter so. Alle Opfer, die das Meer gefordert hat, haben bereits ihr Leben gelassen. Du wirst keinen weiteren Tod verschulden, wenn du zunächst einmal nach deiner Freundin siehst!“
Sich über den Galgenhumor seines Gastgebers zu wundern, erlaubte Aigonn sich nur einen Pulsschlag lang. Aufgeregt schoss sein Kopf in die Höhe. Für einen Moment kam ihm der schlimmste Gedanke, den der blonde Krieger jedoch sogleich entkräftete: „Ihrer Gesundheit wegen gibt es keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Du solltest dich nur fragen, mit welchen Kräften sie paktiert, dass sie eine solche Nacht in den Dünen folgenlos übersteht!“
Der Einheimische konnte nicht wissen, wie unnötig diese Aufforderung war. Zu oft war Aigonn seit ihrer Abreise aus Tiuhilds Heimat der Gedanke gekommen, die Richtigkeit seiner Entscheidung zu überdenken. Die Entscheidung, die sonderbare junge Frau mit sich in den Süden zu nehmen, die so anders war als alle, die er kannte.
Was Aigonn und Tiuhild verband, das schien keiner von ihnen recht zu wissen. Während die Fennin in dem Bärenjäger einen seelenverwandten Gefährten erahnte, kämpfte Aigonn noch immer gegen die Beklommenheit, die er seit ihrer ersten Begegnung empfand. Tiuhild hütete tief in sich eine ungezähmte, mächtige Kraft, die sie nie wahrlich zu beherrschen gelernt hatte. Vielleicht wäre sie unter anderen Umständen eine mächtige Schamanin geworden. So aber war sie nur eine Hazusa, die selbst mehr Dienerin ihrer Fähigkeiten war, als dass diese ihr nutzten.
In Gedanken daran machte der Seher sich mit gemischten Gefühlen auf den Weg zum Strand. Nach allen Seiten blickte er in eine Szenerie der Verwüstung. So klein das Dorf war, das auf einer flachen, nur wenige Fuß das Umland überragenden Kuppe errichtet war, so sehr hatte der Sturm an den Häusern gezerrt. Weder Dächer noch Wände waren unbeschädigt geblieben, egal wohin Aigonn blickte. Die Männer und Frauen, die ihre zerstreuten und zerstörten Habe beisammenräumten, taten dies oft mit tränenverschmierten Gesichtern. Aigonn wollte gar nicht erfahren, wie viele Menschenleben dieser Sturm die kleine Ansiedlung gekostet hatte. Weil er wusste, was ihnen drohte, sobald die Bewohner die Wahrheit erfuhren: dass Tiuhild und er den Sturm mitgebracht hatten.
In der eisigen Luft malte Aigonns Atem Nebelschwaden in den Himmel. Vor ihm lag das Meer wie flüssiges Silber. Der friedliche Anblick des Gottes schien Aigonn trügerisch genug, dass er sich ein zweites Mal vergewissern musste, wirklich erwacht zu sein. Doch er täuschte sich nicht. Das Meer lag still. Endlich. Vier Tage lang hatten die Sturmgeister gewütet. Die letzte Nacht war die schlimmste gewesen. Von rasendem Zorn getrieben hatten sie die Wellen der See zu übermenschlicher Höhe aufgetürmt. Der Gott hatte seinen Schlund geöffnet, als hätte er das ganze Land verschlingen wollen, während Aigonn tagelang nichts anderes um sich herum gesehen hatte als Wasser, überall Wasser. Die Wellen hatten das Land überspült, die Moorwälder der Küstenregionen in eine groteske Traumwelt verwandelt.
Der ganze Strand, der vor Kurzem noch dreitausend Fuß vor den Dünen bis zur Brandung gereicht hatte, war zur Hälfte überspült. Was das Wasser nicht erobert hatte, war über und über mit Seegras und Treibgut bedeckt. Von Weitem erkannte Aigonn selbst Teile eines Schiffes, das wie ein Tonkrug am Zorn der See zerschellt sein musste. Im Inland hatten die feinen Wasserrinnen sich wie Flüsse in die Salzwiesen gegraben, waren zu reißenden Strömen angeschwollen, die selbst Bäume mit sich gespült hatten. Und irgendwo dazwischen, wie ein Seevogel, den der Wind umhertrieb, schlenderte eine Gestalt durch den Sand.
Tiuhild war eine zierliche Person, der man nicht nur die ungeheure Macht im Geiste kaum ansah. Nur wer sie näher kannte, wusste, dass sich unter ihrer ganz aus Fell gearbeiteten Kleidung eisenharte Muskeln verbargen, die ihr ein beeindruckendes Talent im Umgang mit der Lanze schenkten. Taillenlang fielen ihr dunkelbraune Haare über den Rücken, Zöpfe eingeflochten, die seit Jahren verfilzt sein mussten. Mager wie sie war, mit dem schmalen Gesicht und den eingefallenen Wangen, schien der Wind sie mit der nächsten Böe davontragen zu können. So zerbrechlich sah sie aus, wie sie dort lief. Doch kaum, da sie die Augen hob, ganz egal, wie viele Schritte sie entfernt war, erstarb dieser Eindruck. Aigonn erkannte selbst von Weitem die ungebrochene Stärke, die tief in ihr ruhte, und jeden Eindruck der Schwäche eine Lüge strafte.
An diesem Morgen war diese Stärke Aigonn unheimlich wie nie.
Die junge Frau lächelte, als sie den Seher herankommen hörte. In einer Hand hatte sie ein Stück Leder zum Bündel zusammengeschlagen, in dessen Öffnung sie dann und wann eine Hand voll Miesmuscheln verschwinden ließ. Sich eine Strähne ihres Haares aus dem Gesicht streichend, begrüßte sie ihren Gefährten: „Du hast länger geschlafen, als ich dir zugetraut hätte.“
„Wenigstens habe ich geschlafen.“ Aigonns Worte hätten wie Tadel klingen sollen, doch sie gerieten dafür eine Spur zu verunsichert. Wie ein Nebel, den nur Menschen mit der Gabe des jungen Mannes wirklich sehen konnten, umwob Tiuhild noch das Echo ihrer Kraft. Die Sturmgeister, die die junge Frau früher zornerfüllt gequält hatten, jagten heute fast gefährtengleich um ihre Gestalt. Aigonn traute sich nicht zu, die Gefühle solcher Naturgeister deuten zu können. Doch sie schienen sich unsicher, wie sie zu dieser Person stehen sollten, dieser jungen Frau, die ihnen einem Gott gleich ihren Willen aufzwingen konnte. Sie hingegen begegnete ihnen mit beängstigender Ruhe. Als wäre in der vergangenen Nacht gar nichts geschehen, plauderte Tiuhild weiter: „Wenn du häufiger die Küste besuchen würdest, wüsstest du, dass solche Stürme nichts Besonderes sind.“
Aigonn atmete tief durch. „Tatsächlich? Und es ist völlig normal, dass du todesmutig mit den Geistern zu handeln versuchst?“ Die Sorge darüber, was in seiner Gefährtin vorging, ließ Aigonn die Hände zu Fäusten kneten. Sie für ihren Teil schien jedoch kaum Notiz davon zu nehmen, nicht einmal, als er sie an der Schulter packte und aufgeregt anzischte: „Was soll das, Hilda?“
Die Fennin sah auf, so unbeteiligt, dass Aigonn hart schlucken musste. Einmal mehr wünschte sich Aigonn, er könnte mit seiner Sehergabe einen Blick in ihren Kopf werfen – wie immer, wenn sie die Beklommenheit in seinem Innersten herbeirief, die er seit ihrer ersten Begegnung empfand.
„Was meinst du?“, fragte sie bar jeder Sorge und brachte Aigonn beinahe dazu, sie an den Schultern zu rütteln.
„Was … Was ich …!“ Nach Beherrschung ringend, ballte Aigonn Fäuste. „Hilda, was geht hier vor? Wode und die Sturmgeister reißen dieses Stück Land fast in den Meeresschlund, und du stehst am Ufer, Lieder singend, als wäre dieses Unwetter ein Festtag!“
Ein Aufblitzen in ihren Augen. Nur eine kleine Warnung, die in all der Sympathie, die sie für ihn empfand, nichtig schien, in diesem Moment jedoch von beeindruckender Wirkung war. Ihre Stimme wurde plötzlich ernst, als Tiuhild fragte: „Vertraust du mir, Aigonn?“
„Ja“, kam die Antwort, einen Herzschlag zu zögerlich. Die Enttäuschung darüber, die sich in Tiuhilds Miene spiegelte, tat Aigonn augenblicklich leid. Etwas unbeholfen näherte er sich ihr und bemühte sich um weichere Züge: „Bitte, Hilda, versteh mich doch! Was du gestern Abend getan hast, macht es Menschen einfach, sich vor dir zu fürchten. Was auch immer du gemacht hast!“
Sie wurde nachdenklicher. Mit einem Lederband verschloss sie das Muschelbündel notdürftig, bevor sie mit einem Schritt nach hinten der Brandung auswich und sich an Aigonns Seite gesellte. Ein Schatten huschte über ihr Gesicht, als sie aufs Meer hinaussah. Für einen kurzen Moment hörte Aigonn den Gesang der Geister in den Wellen so überdeutlich, dass es schmerzte. Doch Tiuhilds Stimme vertrieb diesen Eindruck. „Ich bin mir nicht sicher, wie ich all das deuten soll. Heute Nacht, als ich die Geister singen gehört habe, war es Wode, der geantwortet hat. Ich bin mir nicht sicher, was er will. Aber es scheint zumindest, als zürnte er uns nicht. Oder zumindest nicht mehr.“
Aigonns Antwort war ein misstrauischer Blick. Die Unruhe erwachte in dem Seher, als hätten die Windgeister sich nun in sein Innerstes zurückgezogen, um ein neues Unwetter zu entfesseln. Tiuhild registrierte es mit einem schweigenden Blick. Doch als sie darauf ihre Augen wieder der See zuwandte, prallten Aigonns Sorgen an ihr ab, wie die Brandung am Strand.
Wode sprach – unentwegt. Aigonns Sinne waren seit der Sonnenwende zum Zerreißen gespannt, als erwartete er mit jedem Atemzug eine Nachricht, eine Warnung, dass sie ihr Spiel zu lange unbehelligt getrieben hatten, von jenem Geist, den sie beide so kühn herausgefordert hatten. So sehr Aigonn sich aber bemüht hatte, so wenig Antworten hatte er erhalten. Wode sprach zu den Menschen. Nicht aber zu ihm.
Binnen eines Herzschlages schien der Wind an Kraft zu gewinnen. Nachdenklich beobachtete Aigonn, wie Tiuhilds Blick sich für einen Wimpernschlag zu entfernen schien. Dann fragte er: „Was sagt Wode?“
„Ich weiß es nicht.“ Ihre Gedanken waren fern. Von einem Moment auf den anderen wurde es leicht zu glauben, dass ihr Geist sich bereits weit von ihrem Körper entfernt hatte, doch Aigonn wusste – oder zumindest glaubte er zu wissen –, dass Tiuhild im Gegensatz zu ihm, Dauthinga und Rowilan dazu gar nicht in der Lage war. Nein, ihr Geist entfernte sich nicht. Vielmehr war er jetzt gerade umgeben von dem Atem einer fremden, alten Macht. Doch bevor Aigonn ihres Wesens gewahr wurde, war sie verschwunden.
Tiuhild atmete heftig gegen den Wind. Sie registrierte nur halb, als Aigonn nachhakte: „Spricht er? Also spricht er jetzt gerade zu dir?“
Die junge Frau sah ihn nicht an. Ihre braunen Augen schienen über der See verloren, gefangen von dem Rauschen, dem Singen der Wellentöchter, deren blasse Gestalten Aigonn wieder und wieder in den Fluten auftauchen sah. Ihre Stimme hatte beängstigend an Kontrolle verloren, als sie zitternd zur Antwort gab, kaum mehr als ein Flüstern: „Wenn ich das Rad vollende, werden wohl nur jene glücklich bleiben, die wissen, dass der Wandel in diesen Ländern niemals still steht. Sie und die Narren.“
„Was?“ Aigonn verstand kein Wort von dem, was Tiuhild aushauchte.
„Das ist es, was Wode sagt …“ Die Fennin erwachte wie aus einer Betäubung. Sie musterte Aigonn fragend, als hätte ihr Geist gar nicht wahrgenommen, welche Worte sie soeben ihrem Gefährten mitgeteilt hatte. Dieser jedoch enthielt sich einer Entgegnung. Viel zu sehr schien es ihm, als hätten die letzten Sätze des Sturmgeistes niemand anderem gegolten als ihm.
„Was heißt das?“
Für einen Wimpernschlag war Tiuhilds Blick erstarrt, dann auf einmal kam ihre Antwort viel zu schnell: „Ich weiß es nicht.“
Aigonn machte einen raschen Schritt auf sie zu. „Jetzt lügst du!“
„Nein …“, hauchte sie. „Nein, eigentlich nicht …“ Ein Moment, ihr Blick der ins Leere ging. Der Griff, der sich in Aigonns Magen krallte, schmerzte unheilverheißend. Und das Gefühl blieb auch, als sie, wie im Erwachen begriffen, blinzelte und mit einem plötzlichen Lächeln versicherte: „Vertrau mir einfach, Aigonn. Bitte vertrau mir!“
Bevor Aigonn Tiuhild weiter nach den Worten des Geistes ausfragen konnte, hatte diese sich abgewandt und war einige Schritte vorausgegangen, um neue Miesmuscheln zu sammeln. Aigonn blickte ihr nach, von gemischten Gefühlen erfüllt, während er selbst auf die See sah, das gewöhnliche Auge geschlossen, nur mit dem sehenden Sinn.
Die viele Übung hatte sich mittlerweile bewährt. Es war eine Leichtigkeit für ihn, Wodes Gestalt als tosende, wirbelnde Präsenz irgendwo zwischen den anderen Windgeistern ausmachen zu können. Er war nur schwach zu erkennen – viel schwächer als in den vergangenen Nächten, als es leicht gewesen war zu glauben, die Götter würden das Himmelszelt einreißen. Doch während er diese Götterdiener sah, als wären es einfache Menschen, blieb ihr Lied in seinen Ohren das vielstimmige Rauschen, das er schon früher gehört hatte. Es war Aigonn unmöglich, auch nur einzelne Worte in dem Tosen und Brausen ausmachen zu können – geschweige denn klare Aussagen, wie Tiuhild sie soeben wiederholt hatte. Für einen Herzschlag schickte Aigonn die lautlose Frage an den Donnerer selbst, Wodes Herren. Doch dieser blieb ihm eine Antwort schuldig. Stattdessen schien es ihm für kurze Zeit, als spiegele sich in Wodes Präsenz ein spöttisches Lächeln.
Wode spricht nicht mit mir. Ich kann ihn nicht hören, weil er es nicht will. Der Gedanke schmeckte fad. Während Aigonn noch einen Funken Eifersucht in sich durchklingen hörte, verblasste dieser, als er Tiuhilds Gestalt ausmachte. Was planst du nur, Wode?
Auf dem Rückweg zur Siedlung bekamen Aigonns Sorgen ein erstes Gesicht: Eine der Frauen zwischen den Trümmern ergriff bei Tiuhilds Anblick erschrocken die Flucht ins Haus. Schon bald erhoben sich laute Stimmen zwischen den Bewohnern, die in gepresstem Ton diskutierten, was sie tun sollten. Was immer sie vorhatten, die Angst, mit der sie der Fennin begegneten, war groß genug, um nicht näher zu kommen – vorerst.
Bevor Aigonn begriff, was geschah, stürzte einer der jungen Männer auf ihn zu. Sich schützend vor Tiuhild stellend, erwartete er den ersten Schlag wie im Reflex. Doch zu seinem Erstaunen kam es so weit nicht. Den Luftzug des Arms, der vorschnellte, um ihn zu packen, fühlte Aigonn noch, bis plötzlich irgendjemand diesen abfing. Beim Anblick ihres blonden Gastgebers wuchs Aigonns Kloß in seiner Kehle. Zu gern hätte er erfahren, was dieser dem Angreifer zornig ins Gesicht zischte. Bevor er aber danach fragen konnte, hatte sich der blonde Krieger bereits schützend zwischen die beiden Fremden und den Einheimischen geschoben und eskortierte die beiden damit sicher in sein Haus zurück.
Und ich merke mir nicht einmal seinen Namen!
Kaum, da der Gastgeber seine Haustür geschlossen hatte, machte sich auch in seiner Mimik Erleichterung bemerkbar. Der Blick, den er für einen Wimpernschlag über Tiuhild gleiten ließ, enthüllte seine Furcht vor der jungen Frau, deren Miene keinen Rückschluss auf ihre Gefühle zuließ. Gelassen war sie. Viel zu gelassen. Um sich darüber jedoch weitere Gedanken zu machen, blieb Aigonn keine Zeit. Der blonde Krieger wartete keine Erklärung ab, sondern stellte nur fest ohne nachzufragen: „Ich will nicht wissen, was ihr tut, solange ihr es mir nicht selber sagt. Versprecht mir nur, dass ihr uns nichts Böses wollt.“
„Wir versprechen es“, war Aigonns Antwort. Die Wahrheit war es sogar. Sie wollten diesen Menschen nicht schaden, keinem von ihnen. Er konnte nur nicht versprechen, dass sich solche Geschehen wie in der letzten Nacht nicht wiederholten.
Mit prüfendem Blick schien sich der Einheimische zu überlegen, ob er dem glauben sollte, bis ein Lächeln auf seinen Lippen Aigonn diese Sorge nahm. Doch es währte nur kurz. Bedeutungsvoll sah der Blonde zu seinen Gästen. Ob es ihm bereits leidtat, sie aufgenommen zu haben, vermochte Aigonn aus seiner Miene nicht zu lesen. Übelnehmen würde er es ihm allerdings nicht. Aus diesen Grund verwunderte es ihn sehr, wie der Krieger versprach: „Ihr dürft bleiben, solange ihr wollt, Fremde. Geht mir nur ein wenig bei den Reparaturen zur Hand. Stört euch nicht daran, dass die Menschen im Dorf abergläubisch sind. Hier geschieht zu viel, als dass man über mögliche Zeichen der Unsterblichen hinwegsehen könnte.“
„Wie können wir Euch das vergelten?“, fragte Aigonn erstaunt, war wenig später jedoch von einer Ahnung erfüllt, die ihm gar nicht gefiel. Zu seiner weiteren Verwunderung blieb der Einheimische dabei, dass sie ihm lediglich beim Wiederaufbau seines Hauses helfen sollten. Aus welchem Grund auch immer wurde Aigonn das Gefühl nicht los, all das habe einen Haken. Einfacher wurde die ganze Angelegenheit dadurch, dass er ihn bisher nicht gefunden hatte, nicht.
Nur Tiuhild schien keine dieser Sorgen zu teilen. Kaum im Haus angekommen, hatte die junge Frau sich trockene Kleidung angelegt, um sogleich dem Einheimischen dabei zu helfen, die im Gewirr des Sturmes entstandene Unordnung zu beheben. Für einen Herzschlag kämpfte Aigonn mit dem Drang, sie zu sich zu zitieren, als er sah, wie teilnahmslos sie ihrer Arbeit nachging, kein Wort, kein Ratschlag der Unterstützung für ihn.
Bald jedoch wurden Tiuhilds Bewegungen fahrig. Sie schien gegen eine Müdigkeit anzukämpfen, die weder von der Erschöpfung noch der durchwachten Nacht herrührte. Von einem zum anderen Moment schien es ungleich einfacher, sie in die Arme zu schließen. Was ihn davon abhielt, wusste er selbst nicht. Das Bündel Kleider, das Tiuhild zusammengerafft hatte, ließ die Hazusa wieder zu Boden sinken und verkrallte die Hand in Aigonns Oberarm. Die Miene der Abwesenheit brach mit einem Atemzug in sich zusammen. Der junge Mann konnte nicht sagen, dass ihre Züge sich sichtbar veränderten. Es war weniger als ein Zucken ihrer Augen, ein unkontrollierter Reflex, der mehr war als ein Hilferuf. Die Besorgnis in ihrer Stimme, mit der Tiuhild zu Aigonn flüsterte, war ein unheilverheißendes Zeichen: „Deine vielen Fragen, Aigonn, über Wode, was hier geschieht … Wenn ich eine Antwort für dich hätte, wüsstest du sie.“ Sie ließ sich auf den Boden sinken. Wie sie sich unbewusst mit dem Kopf gegen Aigonns Oberschenkel stützte, ließ diesen unmerklich versteifen. Unbeholfen versuchte der junge Mann, den Arm um ihren Oberkörper zu legen. Obgleich er sie festhielt, als versuche er brüchige Eierschalen zu hüten, entspannte sie sich augenblicklich. Die Müdigkeit schien endlich über ihr niederzuschlagen, sodass sie die Augen schloss und in sein Hemd raunte: „Ich höre, was Wode sagt. Und obgleich er keine Gelegenheit auslässt, seine Macht zu demonstrieren, scheint er nicht zornig zu sein. Lass uns einfach weiterreisen, Aigonn. Solange die Götter kein Zeichen geben, länger zu rasten, gibt es wohl keinen Grund zur Besorgnis.“
Diese Worte beruhigten Aigonn nicht. Wahrscheinlich aber hätte es in diesem Moment keine gegeben, die dazu im Stande gewesen wären.
Du wusstest, worauf du dich einlässt, als du sie mit dir genommen hast, stichelte eine Stimme in seinem Kopf. Und zur gleichen Zeit lächelte er über seine Zweifel. Ja, er hatte es nicht nur gewusst, er war sogar auf eine gewisse Weise froh darüber gewesen.
Da Tiuhild, obgleich sie gegen die Müdigkeit ankämpfte, dem Einschlafen nahe schien, wechselte Aigonn den Griff und legte sie behutsam auf ihrem Schlaflager nieder. Die Worte, die sie dabei murmelte, waren nicht mehr zu verstehen. Als Aigonn jedoch bereits glaubte, sie hätte sich dem Schlaf ergeben, schlug sie noch einmal flackernd die Augen auf und fragte: „Wir sollten uns überlegen, womit wir uns bei Rethin erkenntlich zeigen können. Er spricht es zwar nicht aus, aber ich bin mir sicher, es gibt etwas, das wir für ihn tun können. Irgendeinen Grund muss es ja geben, warum er uns schützt.“
Oh ja, den gibt es sicher, schoss es Aigonn durch den Kopf und der Gedanke trübte seine Stimmung sichtlich. „Ich werde mich darum kümmern“, gab er Tiuhild zurück, bevor er sich umdrehte und über einen Haufen zerschlagenen Tongeschirrs hinweg stieg. Rethin, richtig! So nannten die Leute aus dem Dorf ihren blonden Gastgeber. Der Kosename rief Aigonn auch wieder den vollen Namen ihres Beschützers in den Sinn, dessen Klang selbst in seinen Gedanken sonderbar nachhallte. Rethigaun, hieß er. Wenigstens war ihm dies wieder eingefallen.
Wie der Tag verging, maß Aigonn nur daran, in welcher Weise das Grau des Himmels sich veränderte. Obgleich er nur eine kurze Essenpause während seiner Arbeit einlegte, schien es am späten Nachmittag, als hätten sie nichts getan. Zwei der Häuser waren völlig zerstört. Das Vieh, das dort in den direkt an den Wohnraum angrenzenden Stallungen untergebracht war, weidete nervös auf den wenigen Flecken Grasland, die das Meer nicht überflutet hatte. Die Bewohner hatten ihre verbliebene Habe bereits notdürftig in anderen Gebäuden der Siedlung gelagert und bereiteten sich darauf vor, die nächsten Monate als Gäste in fremden Häusern zu verbringen.
„Fremder!“, riss Rethins Stimme seinen Gast aus dessen Gedanken, während der ein letztes Seil festzurrte und damit ein neues Bündel Reet auf dem Dach anbrachte. Sich am Dachbalken festhaltend, wandte Aigonn sich auf der Leiter um, auf der er stand, und sah den blonden Krieger mit einem Korb Broten am Fuß des Hauses stehen. „Komm hinein, für heute ist genug gearbeitet!“ Er hob den Bastkorb einladend an. „Wenn du dich nicht beeilst, wird nichts für dich übrig bleiben. Unser Dorfältester erwartet Boten.“
Aigonn zog eine Augenbraue in die Höhe. „Gibt es Nachricht aus anderen Siedlungen?“
„Nachrichten gibt es immer. Thórr soll gepriesen sein, wenn sie bessere sind, als was wir zu erzählen haben.“
Wie diese Leute den Namen des Donnerers aussprachen, klang in Aigonns Ohren zur gleichen Zeit fremdartig und vertraut wie das ganze Land. Er war nicht böse darum, die Arbeit, die ihn jeden Knochen seines Körpers spüren ließ, für den Abend ruhen zu lassen. Der düstere Glanz aber, der jeden von Rethins Blicken begleitete, spendete keine Beruhigung. Dieser Eindruck wuchs, als Aigonn das zum größten Teil wiederhergestellte Heim seines Gastgebers betrat, aus dem ihm bereits von draußen die Stimmen weiterer Gäste zuflogen. Ein gutes Dutzend Menschen hatte die Luft im Inneren mit dem Geruch nach Schweiß, Schmutz und allerlei anderer Ausdünstungen angereichert, doch zur gleichen Zeit war sie so warm, dass Aigonns steif gefrorene Finger augenblicklich zu prickeln begannen.
Zweimal musste er den Blick über die Anwesenden schweifen lassen, bis er Tiuhild entdeckte. Die junge Frau hatte sich soweit in den Schatten des niedrigen Daches gedrückt, dass er sich an ihre gemeinsame Zeit im Haus des Fischers Lorn erinnert fühlte.
Aigonn selbst übersah die misstrauischen Blicke, die man ihm zuwarf, als rufe allein das Haus des ihm wohlgesonnenen Rethin den Schutz der Götter über ihn herab. Die Menschen, die dort saßen, versuchte Aigonn nicht anzusehen. Er hatte nicht danach gefragt, welche Positionen sie in der Gemeinschaft des Stammes einnahmen. Das einzige, was ihn bisher verwundert hatte, war die Abwesenheit eines Schamanen oder Sehers, den Aigonn unter den Bewohnern des Dorfes noch nicht hatte ausfindig machen können.
Tiuhild empfing ihn mit einem angespannten Kopfnicken, das ihn an ihre Seite wies. Noch bevor Aigonn eine Frage stellen konnte, flüsterte sie: „Wo warst du so lange? Ich bin mir nicht sicher, was hier vorgeht. Die Leute hier scheinen eine Versammlung abzuhalten.“
„Und was ist daran ungewöhnlich?“ Aigonn ließ den Blick über die Gruppe Menschen schweifen, die mit jedem Atemzug anzuwachsen schien. Immer mehr Leute drängten sich in Rethins Haus, das am wenigsten beschädigte, das ihrer großen Anzahl Platz bieten konnte. „Nach einer solchen Katastrophe tut jeder Rat Not.“
„Sie haben ihren Stammesfürsten zu sich gerufen“, sprach die Fennin weiter. Hinter einen Balken gekauert, entzog sie sich der Musterung der Neuankömmlinge, lugte jedoch immer wieder hinter dem Holz hervor, als erwartete sie eine bestimmte Person, die nur sie allein mit Namen zu kennen schien.
Dann auf einmal öffnete sich die Tür ein weiteres Mal, und im selben Augenblick erhob sich ein Teil der Anwesenden von seinen Plätzen. Aigonn hatte den Mann, der mit seiner Begleitung eintrat, noch kein einziges Mal gesehen. Doch sein Äußeres allein sprach eindeutig für seinen Einfluss. Der Ankommende war kein Hochgewachsener, doch von solch stämmigem Wuchs, dass es seine geringe Körpergröße aufwog. Das lange Haar und der struppige Bart waren ergraut, das Gesicht von Wetter und Jahren so zerfurcht, dass es die Spuren eines zweiten Lebens zu tragen schien. Trotz allem bewahrte nicht nur die kostbare Bernsteinkette mit den Goldanhängern seine Autorität, die ihm von Natur aus gegeben schien. Daran taten auch das vor Schmutz starrende Fell, das er sich über die Schultern gelegt hatte, und der abgewetzte Mantel keinen Abbruch.
Rethin war der erste, der von seinem Platz aufsprang, um den Herren zu begrüßen, der zweifelsohne ihr Fürst und Anführer sein musste. Die Worte, die sie zur Begrüßung sprachen, verstand Aigonn ebenso wenig wie die Gespräche, die diesen folgten. Doch obwohl die Ankommenden das dargebotene Essen, Brote und den dünnen Eintopf aus Hirse und Bohnen, dankend annahmen, wurde der Ton bald schärfer und die Stimmen lauter. Unruhig beobachtete Aigonn das Geschehen, ohne wahrlich daran Teil zu haben. Immer wieder sah er fragend zu Tiuhild, die mit gerunzelter Stirn Gesprächsfetzen nachzusprechen schien, in dem Bemühen, sie übersetzen zu können. Als erneuter Regen, ungleich leichter und schwächer als am vorherigen Abend, auf das Hausdach prasselte, drängte Aigonn sie: „Was ist denn nun?“
„Ich verstehe ihre Sprache nicht gut genug.“
„Aber immer noch besser als ich!“
Tiuhild presste missbilligend die Lippen aufeinander, rückte dann aber doch mit der Sprache heraus: „Dieser Mann dort …“ Sie deutete auf einen greisen Alten, der unmittelbar neben Rethin Platz genommen hatte, der Dorfälteste. „… sagt, die Götter hätten diese Länder verlassen. Der Donnerer hat sie verflucht, weil … diese Leute hier sich ihm widersetzt haben, wie auch immer.“
Tiuhild zog die Augenbrauen noch weiter zusammen und schüttelte einige Male missverstehend den Kopf. Aigonn fiel auf, wie wenig Rethin sich an dem Gespräch selbst beteiligte, sondern nur mit düsterem Blick lauschte, was die übrigen besprachen. Der finstere Gesichtsausdruck wollte nicht zu dem Mann passen, der sein Lächeln bisher eisern gegen alles Unglück verteidigt zu haben schien. Für einen kurzen Augenblick schwenkte seine Aufmerksamkeit zu Aigonn und Tiuhild herüber, als diese übersetzte: „Ich verstehe nicht genau, worum es geht aber … der Fürst spricht immer wieder davon, dass das Land sich ihnen entzieht … oder ähnlich. Es geht um die Ernte. Die Ernte war schlecht in den letzten Jahren. Was auch immer das mit diesem Sturm zu tun hat … Aber fast hört es sich an, als ob es schon im vergangenen Jahr eine schlimme Flut gegeben hat.“
„Rhaldar hat auch davon gesprochen.“
Kaum, dass der Name über Aigonns Lippen geschlüpft war, schoss Tiuhilds Blick zu ihm herüber. Als käme jede Erinnerung an diese Sippe einem Fluch gleich, spuckte sie aus: „Worüber?“
„Erinnerst du dich nicht?“
„Will ich das?“
„Am ersten Morgen, als ich bei euch ankam.“
„Da gab es kein ‚euch‘“, ätzte die junge Frau und brachte Aigonn beinahe dazu, sich im Ton zu vergreifen.
Zum Glück bremste er sich rechtzeitig. Wer kann es ihr verübeln, dass sie nicht gern an diese Zeit zurückdenkt. Darüber hinwegsehend, wie sehr Tiuhild ihrer Vergangenheit in der Sklaverei auszuweichen versuchte, erklärte Aigonn seine Worte: „Sie haben auch über die Ernte diskutiert. Wie es schien, muss sie an der ganzen Küste in den letzten Jahren schlecht ausgefallen sein.“
Tiuhilds Miene wurde noch finsterer. „Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie recht verstehe, aber der Fürst spricht immer wieder von Aufbrechen.“
„Aufbrechen?“
„Ja, von einer Reise.“ Die junge Frau schüttelte den Kopf, als wolle sie ihren eigenen Worten nicht trauen. „Ich bin mir nicht sicher, aber … beinahe klingt es, als wollten sie umsiedeln.“
„Umsiedeln?“ Aigonn fehlte die rechte Vorstellung dafür, wie dieser Plan aussehen sollte. „Du meinst, sie wollen neue Siedlungen bauen?“
Nickend stimmte Tiuhild ihm zu, die Augen nicht von den Sprechenden lassend, als läse sie den wahren Inhalt ihres Gesprächs von den Lippen ab. „Ja, aber nicht nur neu bauen. Wenn ich recht verstehe, diskutieren sie, ob …“ Sie schien es kaum glauben zu können. „… ob sie ihre Heimat verlassen sollen. Für immer. Weiter im Süden in den Küstenregionen scheinen sich die Stämme bereits zu versammeln. Der Fürst hält diese Idee für die einzig richtige, aber die Leute hier aus dem Dorf sind nicht einverstanden … glaube ich …“
Wie zur Bestätigung ihrer Worte mischte sich plötzlich Rethin mit scharfem Ton in die Debatte ein. Der zornige Widerstand, auf den er bei seinem Stammesfürsten traf, erstaunte Aigonn. Dies war der richtige Moment, da ein Schamane sich einmischen müsste, ein Götterdiener, der das Wort der Unsterblichen vernommen hatte. Unzählige Male war Aigonn eine solche Szene in seinem eigenen Stamm vor Augen geführt worden – und hatte damit geendet, dass Rowilan Opfergaben entgegengenommen hatte, um den Willen der Götter selbst in Erfahrung zu bringen.
Auch wenn Aigonn es noch immer nicht recht glauben wollte. Tiuhild musste sich verhört haben. Stämme ihre Heimat verlassen? Plötzlich echote eine Stimme in seinem Kopf. Nur der Schatten einer Erinnerung war es, doch er legte sich plötzlich düster über diesen Raum.
Die Zeiten werden sich ändern. Noch nie stand der Lauf der Völker still, noch nie blieb ein Stamm für alle Zeit am selben Ort.
Der Splitter einer Szenerie aus einer, seiner Vergangenheit, die kaum zurücklag aber doch unendlich fern schien; Teil eines anderen Lebens, das sich in einem Land abgespielt hatte, das Aigonn heute Heimat nannte, da er weiter davon entfernt war, als er je gewesen schien. Lugus hatte es ihm gesagt, er hatte ihn davor gewarnt. Aigonn hatte damals gar nicht erfassen können, was der Gott, der Herr des Lebens, ihm hatte sagen wollen. Doch plötzlich, von einem Moment zum anderen, schien die Zukunft wie ein Tuch vor ihm ausgebreitet. Wie in ein Déjà-vu sah Aigonn zu diesen Menschen, als hätte er all das vor langer Zeit schon erkennen können, wenn er es nur gewollt hätte.
Ein Bild schoss vor seine Augen. Der junge Mann wusste, dass er unbewusst das eine geschlossen und nur das andere, sehende, offen hielt, jenes Auge, das für einen gewöhnlichen Menschen erblindet schien, obgleich er damit weit über die Grenzen des Üblichen hinausblickte. Die Gegenwart schien sich in Vergangenheit und Zukunft aufzufächern, ein Bild über dem anderen. Aigonn sah diese Menschen, diese Stämme, ein Zug aus Karren und Lasttieren, gewaltiger als jedes Heer, das je gegen die Wälle seiner Heimat angerannt war. Die Zeit schien einen Herzschlag langsamer zu laufen, während Aigonn in die Versammlung starrte, zu dem Dorfältesten, dem Fürsten, der plötzlich zornig aufsprang, um das Wortgefecht mit einem anderen Mann zu eröffnen. Rethin beobachtete sie kopfschüttelnd, wandte den Blick ab, um Aigonns eigenen einzufangen. Einen Herzschlag lang arbeitete es in seinem Kopf, dann auf einmal sprang der blonde Krieger auf. Aigonn kannte sein Vorhaben, bevor er es wirklich begriff. Trotzdem erfasste der Schrecken ihn erst, als Rethin es aussprach.
Den Finger auf Aigonn gerichtet, wandte er sich an den Fürsten. Ersterer brauchte die Sprache nicht zu beherrschen, um zu verstehen, was er sagte. „Er“, rief Rethin, „er hört die Stimmen der Götter! Lasst ihn für Tiuz opfern. Wenn er nicht in Erfahrung bringt, was der Wille der Götter ist, tut es keiner von uns!“