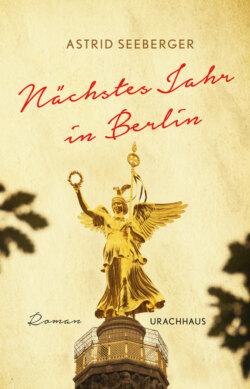Читать книгу Nächstes Jahr in Berlin - Astrid Seeberger - Страница 11
Stuttgart, den 26. November 2007
ОглавлениеAls verwaistes Kind muss man sich wappnen, besonders, wenn man vor einem deutschen Klinkerhaus steht, an dem ein großes Schild neben dem Eingang verkündet: »Häberles Bestattungsinstitut – Leben endet, Liebe nie«. Mutter hatte sich an die Firma gewandt, als Vater gestorben war, und mit ihr vereinbart, dass sie auch ihr Begräbnis ausrichten sollte. Sie hatte mir die Übereinkunft gezeigt, bevor sie gestorben war. Sie wollte eingeäschert werden. Sie scherte sich nicht um das, was ich sagte: Denn Erde bist du, und zu Erde sollst du wieder werden. Sie wollte wie Pappelschaum lodern.
Als ich auf den Klingelknopf drückte, wurde die Tür von einem Mann geöffnet, der aussah, als hätte er sich gerade den Bierschaum von den dicken, glänzenden Lippen gewischt. Er ergriff meine Hand und sprach mir devot und routiniert sein Beileid aus. Er erinnere sich an meine Eltern, sagte er, sie seien wirklich nette Menschen gewesen, was auch immer er darüber wissen konnte. Dann führte er mich in einen Raum, der wie ein normales Büro aussah. Wenn die Glasschränke an den Wänden nicht mit Urnen vollgestanden hätten.
Ich musste an einem breiten, stabilen Schreibtisch Platz nehmen, auf einem breiten, stabilen Stuhl. Er würde seine Frau holen, sagte der Mann, die kümmere sich um die Bestellungen. Und er gab mir eine Broschüre, die ich mir in der Zwischenzeit ansehen könne. Auf dem Umschlag sah man einen schwarzen Berg, der aus einem blauen Wald ragte. Über dem Ganzen segelte eine weiße Taube, auch über der Textzeile zuunterst: »Wir sind Tag und Nacht für Sie da.«
Ich legte die Broschüre beiseite. In meiner Kindheit in Waldstadt gab es keine Tauben. Die wurden gefangen, sobald sie sich zeigten. Und nie haben die Leute aus Waldstadt sie gefangen, die Flüchtlinge waren es. Obwohl es bereits Anfang der Fünfziger war, also mehrere Jahre nach Kriegsende, kamen Monat für Monat neue Flüchtlinge an. Sie mussten in einem großen Magazingebäude wohnen, das aus irgendwelchen Gründen die Jalousie hieß. Dort lebten sie auf Matratzen in kleinen Verschlägen mit Wänden aus Kartonplatten, einem Geschenk von Vaters Chef, dem Besitzer von Pfäffles Verpackungswerken.
Auf eine Kartonplatte hatte ein Mann, der nach Mutters Worten durch irgendetwas, das er im Krieg gesehen hatte, stumm geworden war, einen Bauernhof gemalt. Er hatte ihn sorgfältig dargestellt, mit Wasserfarben, auch die Stiefel, die auf der Vortreppe standen, ein kleines Paar und zwei Paar große. Eins der großen Stiefelpaare war voller Lehm, der in Klumpen daran festklebte. Die beiden anderen Paare glänzten, das kleine ganz besonders.
Oft saß der Mann da und starrte das Bild an. Man sah ihn nie auf dem Hof beim Suppenkessel, obgleich die Flüchtlinge ihn abwechselnd bewachten. Es war ein großer, verbeulter Topf, in dem die Flüchtlinge über einem Feuer ihr Essen kochten. Manchmal schwammen Tauben in der Brühe. Ich weiß es noch genau: Sobald es brodelte, begannen die kleinen nackten Leiber zu zucken.
Mutter ging oft zur Jalousie, um jemanden zu finden, der ihre Identität bezeugen konnte. Sie hatte keine persönlichen Dokumente, die waren im Krieg verloren gegangen. Sie konnte nicht nachweisen, dass sie war, wer sie war. Und sie fragte dort alle nach ihrer Familie. Was war aus ihren Geschwistern geworden, was aus ihrer Mutter und ihrem Vater?
Eine Hand streckte sich mir entgegen, am wurstigen Finger ein goldener Ring, der für immer festzusitzen schien. Frau Häberle sah mich mit einem Blick an, der schwer von Mitgefühl war, während sie mir ihr Beileid aussprach, mit exakt denselben Worten wie ihr Mann. Dann stellte sie ihr Sortiment vor.
Sie zeigte mir die Urnen. Bei der Auswahl müsse man sorgfältig vorgehen, erklärte sie, die Urne sollte zu dem Verstorbenen passen. Sie habe das Gefühl, meine Mutter – eine nette Frau, sagte sie, jedes Mal, wenn sie sich beim Einkaufen im Fleischerladen begegnet waren, hätten sie ein paar Worte gewechselt – harmoniere besser mit den künstlerischen Urnen als mit einer einfachen schwarzen. Warum also nicht diese nehmen, auf der Picassos Friedenstaube abgebildet war, die sei ein Renner. Ich sagte nicht, dass Mutter Tauben verabscheut hatte, weil sie fand, sie verdreckten die Städte, sogar die Kirchen.
Ich wählte eine dunkelblaue Urne mit goldenen Sternen aus. Als Kind hatte ich geglaubt, die Sterne wären die Laternen der Engel, und dass man seinen Weg findet, wenn man ihnen folgt. Was Frau Häberle über die Sternenurne sagte, habe ich nicht in Erinnerung.
Dann legte sie mir die Kataloge mit den Blumengebinden vor, prächtige Kränze oder Rosenherzen, so groß, wie man sie nur haben wollte. Ein schönes Begräbnis sei schließlich eine Erinnerung fürs Leben, sagte Frau Häberle. Ich entschied mich für einen Kranz aus Rosen, die Mutters Lieblingsblumen waren, vielleicht, weil sie selbst Rose hieß.
Und Frau Häberle führte mich in der Villa herum. Statt Betten und Sofas standen in allen Räumen Särge mit geöffneten Deckeln. Auch wenn man eingeäschert werde, habe der Sarg eine Bedeutung, sagte Frau Häberle. Ich fragte nicht, welche. Vielleicht hatte sie es ja erwähnt, und ich hatte nicht zugehört. Ich dachte darüber nach, dass die Särge so ungemein groß waren. Mutters schmächtiger Körper würde darin ganz verloren aussehen. Plötzlich packte mich Schwindel. Es war, als müsste ich mich wieder auf den Boden setzen und die Arme um die Knie schlingen. Ich hielt mich an einem Sarg fest. Und sagte: »Nehmen Sie den!« Nur um da rauszukommen.
Erneut wurde ich gebeten, am Schreibtisch Platz zu nehmen. Frau Häberle schob mir ein Papier zu, das ich unterschreiben sollte. Den oberen Blattrand schmückte ein Bild: Eine rote aufgehende oder untergehende Sonne leuchtete über einem weißen Gebäude, das auf einer fruchtbaren grünen Ebene stand. Unter dem Bild in verschnörkelten Buchstaben: »Wallhall-Krematorium mit Gütesiegel«. Das sei ein Einäscherungsauftrag, erklärte sie. Es genüge nicht, dass Mutter einen Vertrag abgeschlossen habe. Ein Auftrag sei erforderlich, unterzeichnet vom Erben. Ich sagte, das brächte ich nicht fertig, Feuer wäre das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte.
Bevor ich in die Schule kam, besuchte ich einen Kindergarten, der von katholischen Nonnen geführt wurde. Alois, der kleine rundliche Stadtpfarrer, hatte gesagt, das wäre gut für mich, vielleicht, weil er begriffen hatte, wie eigensinnig ich war. Oder es lag daran, dass Mutter, die Katholikin war, jedoch einen Protestanten geheiratet hatte, Hilfe brauchte, um mich im wahren katholischen Glauben zu erziehen.
Ich weiß nicht, ob ich den im Kindergarten gelernt habe. Was man uns dort beizubringen versuchte, war, dass Gott alles sieht, jederzeit, auch mich. Deshalb sah er auch, wenn ich abends im Bett meinen kleinen Schoß berührte, sah es mit einer Art Röntgenaugen, die durch die Decke blicken konnten. Trotzdem aber fasste ich meinen Schoß immer wieder an. Ihn anzufassen und ein wenig zu streicheln tat gut, wenn die Schatten kamen.
Manchmal riss ich aus dem Kindergarten aus. Und rannte in den Wald, zu meinem Bach. Tauchte die Füße hinein. Ich wusste, dass das Wasser des Bachs im Flüssle landete, das durch Waldstadt floss. Und dann im Neckar, der in den Rhein mündete. Und am Ende ins Meer, in Vaters Meer, das alles verschlang. Und Vaters Meer hing mit Mutters schimmernder See zusammen. Wenn ich die Füße in den Bach tauchte, hing auch ich mit allem zusammen.
Es half nichts, dass die Nonnen böse wurden, wenn ich ausriss. Sie wurden so leicht böse, obwohl sie mit Gott lebten. Zur Strafe musste ich in den Keller, eine ganze Stunde im Finstern stehen, zwischen Brennholzstapeln und Kohlevorräten. Ich aber habe nie gestanden, ich habe mich auf den Steinfußboden gesetzt und die Arme um die Knie geschlungen. Und habe ans Meer gedacht mit seinem Schimmern und an die Fische in der Tiefe des Wassers. Sie schwammen ganz friedlich umher, obwohl sie in die ewige Finsternis verbannt waren, während ich nur kurz dort auszuharren hatte.
Einmal, als ich wieder ausriss, kamen Menschen angelaufen. Alle rannten in dieselbe Richtung. Und ich rannte mit. Wir rannten zum Marktplatz, wo ein Haus in hellen Flammen stand, der Himmel war nicht mehr zu sehen, nur dicker, wirbelnder Rauch, und in einem Fenster des obersten Stockwerks stand ein Mann. Ein Mann, der schrie wie ein Tier in äußerster Not, während er versuchte, auf die Fensterbank zu klettern. Seitdem weiß ich, Schreie können auch durch das schlimmste Feuergetöse dringen, direkt hinein in deine Brust. Und noch mehr das Schweigen. Wenn dieser Mensch plötzlich verstummt und nach hinten überkippt, hinein in einen Raum, der nicht länger existiert, nur noch ein Meer ist aus lodernden Flammen. Und das Letzte, was man sieht, ein nackter Fuß im Fenster ist, ein weiß leuchtender, zuckender Fuß.
Ich erinnere mich, dass die Menschen um mich herum weinten. Und dass ich weggerannt bin zu meinem Wald. Doch auch dort gab es Füße, weiße Füße, die zuckten, einfach überall.
Ich unterschrieb den Einäscherungsauftrag. Der Namenszug wirkte seltsam, als hätte ich am ganzen Leib gezittert. Dann fragte ich Frau Häberle, ob die Toten bei der Einäscherung Strümpfe trugen. Mutter musste die besten haben, die es gab. So etwas ist eher ungewöhnlich, sagte Frau Häberle mit ihrem Leben-endet-Liebe-nie-Gesicht, das sich durch nichts aus der Fassung bringen ließ. Mutter muss jedenfalls Strümpfe tragen, sagte ich, und dass ich sie kaufen und dort abgeben würde.
Dann ging ich, ausgestattet mit Kopien des Einäscherungsauftrages und meiner Bestellungen. Vor dem Haus gab es einen kleinen Teich, in dem zwei Goldfische schwammen, beharrlich immer im Kreis, als gäbe es einen Ausweg.
Als ich wieder im Hotelzimmer war, rief ich Lech an. Ich sagte, ich wolle mit ihm nach Dresden fahren. Er fragte nicht, warum, nur wann. Nach Mutters Beerdigung, sagte ich. Und fügte hinzu: »Für dich würde ich durchs Feuer gehen.« Ich sagte es ohne jedes Zögern.