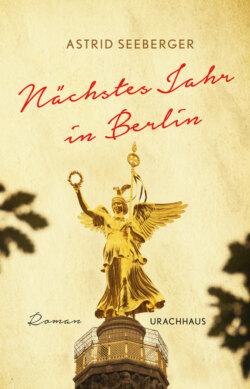Читать книгу Nächstes Jahr in Berlin - Astrid Seeberger - Страница 17
Stuttgart, den 27. November 2007
ОглавлениеAls ich mein Frühstück im Hotel eingenommen hatte, am Tisch neben der dunklen Wand, an der Wasser hinabrann, ging ich zu Mutters Wohnung. Es gab einen Weg dorthin, auf dem man dem Verkehr entkam, einen asphaltierten Fußweg neben einem Bach, der durch eine vermeintliche Idylle floss: eine Ansammlung eingezäunter Schrebergärtchen, in denen Gartenzwerge die Pflanzungen bewachten.
Es war Vormittag. Eine junge Frau mit großen, klimpernden Ohrringen sauste mit einem Kinderwagen vorbei, als ginge es um Leben und Tod. Ein alter Mann in einem langen grauen Mantel mit Fischgrätmuster durchwühlte beharrlich einen Papierkorb auf der Suche nach Pfandflaschen. An einem Anschlagbrett brachte eine stark geschminkte Frau mit schwarzer Lederjacke und rabenschwarzen Haaren ein Plakat an, das für einen Intensivkurs in Mindfulness warb: »Werde ein neuer Mensch in nur sechs Tagen«. Ein Parkarbeiter, der an einen gealterten Fellini erinnerte, studierte das Plakat eine Weile. Dann fuhr er mit dem Aufsammeln des Mülls fort, packte rasch und elegant mit einem langen, zangenbewehrten Stab zu, auch bei einem benutzten Kondom, das an einem Busch hing. Ich blieb stehen. Wie konnte sich das, was einmal mein Land gewesen war, so fremd anfühlen? Allerdings hatte Stuttgart nie zu meinem Land gehört. In meinem Land gab es ein Waldhorn und eine Terrasse, auf der man sich Abend für Abend Geschichten anhören konnte. Auch wenn die Terrasse erst später kam. Zuerst kam das Waldhorn. Irgendwie aber gehörten sie zusammen.
Ich musste an das erste Wochenende in Stuttgart denken, nach dem Umzug von Waldstadt. Wir saßen um den alten Küchentisch herum, den Mutter wegschmeißen wollte. Einen ordentlichen Eichentisch sollten wir uns kaufen, mit ordentlichen Eichenstühlen, jetzt, wo Vater Abteilungsleiter geworden war. Alles sollte standesgemäß sein, sagte sie, jetzt, wo wir ein neues Leben begonnen hätten.
Vater saß auf seinem alten Hocker, wie immer, wenn er Waldhorn spielen wollte. Er hatte die ganze Woche nicht gespielt, nicht bevor alles in Ordnung gekommen war. Jetzt aber hatte er das Waldhorn hervorgeholt, seine Augen leuchteten. Er führte es zum Mund wie ein Verliebter, der sich nach den Lippen seiner Liebsten sehnt. Und begann zu spielen, nicht nur mit dem Mund und den Fingern, sondern auch mit dem Herzen, sanft und zärtlich.
Mitten im Ton hielt er inne. Dann begann er von Neuem, noch sanfter, noch zärtlicher. Doch es ging nicht. Der Ton prallte gegen die Betonwände und verschloss sich hart und kantig. Vater aber gab nicht auf, versuchte es von Neuem. Hatte Orpheus mit seinem Spiel nicht sogar Steine zum Leben erweckt? Die Betonwände aber waren schlimmer, sie bestanden darauf, aus Beton zu sein, nicht wie die Waldstädter Fachwerkwände, die zu Resonanzböden wurden. Und die Nachbarn, von denen wir kaum wussten, wer sie waren, hämmerten gegen die Wand, hart und böse. Vater saß mitten im wütenden Gehämmer und drückte das Waldhorn an die Brust, ratlos und konfus.
Noch ein paarmal versuchte er es mit dem Spielen. Dann verkaufte er das Waldhorn. In der Stuttgarter Zeitung gab er eine Annonce auf. Neun Antworten trafen ein, sieben Leute wollten vorbeikommen, um Probe zu spielen. Der Sechste bekam das Waldhorn, ein Student von der Stuttgarter Musikhochschule. Er hatte beim Spielen den richtigen Glanz in den Augen, sagte Vater. Als der Student fragte, ob er das Waldhorn abbezahlen könne – er habe nicht viel Geld, wolle das Instrument aber unbedingt haben –, da senkte Vater die Summe auf einen Spottpreis, auf lediglich zehn Mark. Mutter sollte ruhig toben. Ein Waldhorn ist wie ein Mensch, sagte er, es braucht Liebe.
Und wenn Rechnungen kommen, braucht man Geld, schrie Mutter. Das stimmt, sagte Vater, genauso wie das, was er gesagt habe, stimme, doch gebe es eine Hierarchie der Wahrheiten.
Ich ging weiter den Hügel hinauf, wo ein großer alter Garten noch immer mitten zwischen all den neuen Häusern lag. Ich sah den bejahrten Geräteschuppen, frisch gestrichen in Grün und Blau, das hier und da ineinander überging. Der Schuppen stand auf der mittleren Terrasse, zwischen knorrigen Apfelbäumen, die den Krieg überdauert hatten. Die Bomben waren auf die Häuser gefallen, nicht auf den Garten, auch nicht auf die Autowerke. Als die Bombenangriffe drohten, hatte man eine Nebelanlage gebaut. Der Nebel war nach draußen gequollen und hatte die Fabrik verborgen, vielleicht auch den Garten.
Solange er noch laufen konnte, waren Vater und ich immer hierhergegangen, um die Apfelblüte zu sehen. Das letzte Mal war es ein Blühen ohne jedes Maß gewesen, und die Wanderung auf dem Pfad hatte viele Pausen erfordert. Vaters Rücken war so krumm geworden, dass einer seiner Lungenflügel zusammengequetscht wurde. Jede Bewegung ließ Vater keuchen.
Damals stand er neben mir und betrachtete all das Blühen. Das hier gibt es Jahr für Jahr wieder. Er sagte nicht: trotz allem. Nur, dass es das gibt. Als bestünde die Gefahr, dass wir es vergessen.
Dann erzählte er von einem Apfelbaum, den er im Krieg gesehen hatte. Es war im Vorfrühling gewesen, sagte er. Er hatte einen verwüsteten Park durchquert. Zwischen verkohlten Baumresten lag ein Teich. Der Teich war nicht tief, nicht tief genug, um die Menschen, die sich dort zu retten versucht hatten, zu verbergen. Von den Bomben hatten sie Phosphor abbekommen, Phosphor, der so lange brannte, wie es Sauerstoff in der Luft um sie herum gab. Es war nicht leicht gewesen, den Teich anzusehen. Man musste etwas anderes anschauen. Vielleicht einen Baum, der ein Stück weiter weg neben den Resten einer Mauer stand.
Auch der war verkohlt. Hatte nur noch ein paar seiner untersten Äste. Und am äußersten Ende des einen saßen wenige zarte Blüten. Die Wärme nach dem Feuersturm hatte das bisschen Leben verleitet, das noch in dem Baum steckte. Die Kälte würde die Blüten vernichten, sobald die Stadt abgekühlt war. Es würde niemals Früchte geben. Die Blüten aber waren da, unfassbar weiß mit einer schwachen Rötung am Rand, mitten in all dem Ruß. Er hatte sie gesehen, ohne zu wissen, ob er es aufwühlend oder tröstlich finden sollte. Als er den Menschen, die er später traf, von den Apfelblüten erzählte, waren sie nicht beeindruckt gewesen. Sie hatten genug damit zu tun, sich selbst am Leben zu erhalten.
Ich erreichte die Kuppe des Hügels, wo sich Beton-Wohnblocks in geraden Reihen neben einem Wasserturm aus ebenso grauem Beton erhoben. An der Bushaltestelle vor dem Turm warteten zwei alte Frauen. Hier hatte Mutter gestanden mit ihrem großen Hut, an dem eine kleine Feder wie ein Seismograf gezittert hatte.
Ich überquerte den Platz. Vor der Obst- und Gemüsehandlung fegte ein junger Mann mit schwarz glänzendem Haar den Bürgersteig. Aus der Bäckerei wehte der Duft frisch gebackenen Brotes herüber, und von der Tür des Tabakladens, in dem Mutter ihre Kreuzworträtselhefte gekauft hatte, ertönte ein Bimmeln. Eine Frau mit mohrrübenfarbenem Haar kam herausgerannt und riss sich eine Zigarette aus der soeben gekauften Packung. Es waren hundertneunundsiebzig bis hundertsechsundachtzig Schritte vom Tabakladen zu Mutters Wohnung. Mutter hatte sie gezählt. Ich ertappte mich dabei, es ebenfalls zu tun.