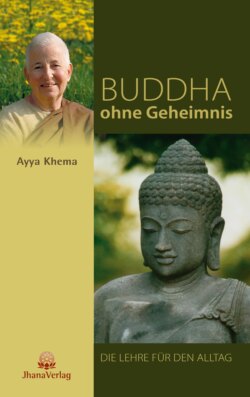Читать книгу Buddha ohne Geheimnis - Ayya Khema - Страница 11
2. Mitgefühl (karunā)
ОглавлениеDer zweite unserer vier Freunde ist Mitgefühl (karunā), sein ferner Feind, das liegt auf der Hand, ist Grausamkeit. Der nahe Feind ist abermals zum Verwechseln nahe: Mitleid.
Mitleid ist eine Gefühlsregung, bei der wir uns selber für intakt halten und überzeugt sind, nur der andere leide, und deshalb tut er uns Leid. Bei Mitgefühl dagegen wissen wir, was es heißt zu leiden, und können mitfühlen mit anderer Menschen Leid. Wir fühlen uns eins mit ihnen, unbekümmert darum, wer sie sind, welcher Hautfarbe, Herkunft, Nationalität, ob sie zu uns passen oder nicht, das Gleiche tun, denken und glauben wie wir – die kann man sowieso mit der Lupe suchen! Der tiefe Unterschied zwischen Menschen tritt erst auf, wenn einer den Noblen Achtfachen Pfad gegangen ist und für einen Augenblick Nibbāna gesehen hat, also – in buddhistischer Terminologie – ein »Nobler« geworden ist, im Gegensatz zum »Weltling«. Zwischen Weltlingen gibt es keinen wirklichen Unterschied, und der zwischen Weltling und Noblem ist auch insofern unerheblich, als jeder Weitling ja die Möglichkeit in sich hat, ein Nobler zu werden.
Aus Mitgefühl erwächst bedingungslose Liebe. Auch sie braucht natürlich das Verstehen, dass es in Wirklichkeit gar nicht »ich« und »du«, »wir« und »sie« gibt, sondern einfach nur menschliche Lebewesen, wie ich eines bin. Jegliche Entfremdung und Abgrenzung geschieht aus Angst. Sie ist nur zu überwinden, wenn wir immer weiter und tiefer ihrer Natur nachgehen und ergründen, woher sie rührt. Es steckt in jedem Menschen eine tiefe und irrationale Angst vor dem Tod. Irrational deshalb, weil wir Angst vor etwas haben, das in jedem Fall eintreten wird. Darum ist es so wichtig, sich mit dem Tod bekannt zu machen und anzufreunden und ihn so zu sehen, wie er wirklich ist.
Stellen Sie sich einmal vor, es gäbe keinen Tod, jemand garantierte Ihnen noch 5.000 Jahre irdischen Lebens. Würden Sie sich darüber freuen? Vermutlich nicht. Und doch hat jeder Angst vor dem Tod. Jeder! Wer von sich meint, er habe nur Angst vor dem Tod seiner Lieben, nicht vor seinem eigenen, stelle sich mitten auf eine Autobahn; man kann als gegeben annehmen, dass er dabei Todesangst empfinden würde. Diese Angst vor dem Tod zeigt sich in einer ständigen Angst vor kleinen Toden, nämlich den kleinen Toden des Ich, die wir alle kennen: dass unser Ich herabgemindert, nicht anerkannt, nicht geliebt und gelobt wird, nicht erwünscht ist, dass uns jemand beschimpft, kritisiert, zur Rede stellt, wegläuft – Angst, die uns dazu bringt, uns von den Menschen zurückzuziehen. Wir manövrieren uns in eine künstliche Vereinsamung hinein, in eine Leere, in der wir nicht einen einzigen Augenblick glücklich sein können, es sei denn, wir begnügten uns mit dem trügerischen Glück der Sinnesvergnügungen. Obwohl es uns selber unglücklich macht, lassen wir nicht davon ab, das zu tun, was alle Länder tun: Grenzen zu errichten und sie zu verteidigen, um uns zu schützen – Grenzen um den einen Einwohner »Ich«. Grenze bedeutet Waffen und scharfe Kontrollen davon, dass nur Befugte ins Land kommen. Und beim kleinsten Zwischenfall werden sofort Angriffsmaßnahmen getroffen, bis dahin heißen sie »Verteidigungsmaßnahmen«. Die Länder der Welt spiegeln die Menschen der Welt wider, so wie jeder Einzelne von uns die ganze Menschheit widerspiegelt. Wir verteidigen also unsere Grenzen, um uns, den Insassen, zu schützen. Aber wenn wir pausenlos mit Verteidigung befasst sind und diese Grenzen stets als unsere betrachten, sind wir nie mit Mitgefühl, Miterleben befasst. Zusammensein geschieht dann nie, wir sind immer allein. Unsere Abkapselung als fixe Idee zu erkennen, die uns daran hindert, glücklich zu sein, und an ihrer Beseitigung zu arbeiten, bringt mehr und mehr Mitgefühl. Aber es kommt nicht von selber, wir müssen wirklich an uns arbeiten.
Liebende Güte und Mitgefühl sind die beiden Empfindungen, an denen es im menschlichen Miteinander am meisten fehlt. Das heißt nun nicht, wir sollten Liebe und Mitgefühl mit dem Vorsatz entwickeln, andere zu beglücken, das wird dann die natürliche Folge sein; uns selber bringt es Glück und innere Stärke, die nicht mehr von außen bedingte Basis für Ruhe und Frieden. Solange Ruhe und Frieden jedoch davon abhängen, was andere Leute machen, oder von unseren schwankenden Gefühlen, solange sind wir in einem Sklavenverhältnis. Ein Sklave ist immer seinem Herrn ausgeliefert. Leider sind wir uns darüber im Allgemeinen gar nicht im Klaren. Wir sprechen von »Women’s Lib«, von Frauenbefreiungsbewegung, und inzwischen auch schon von Männerbefreiungsbewegung; sprechen von Befreiung aus Gewalt-, Feudal-, totalitärer Herrschaft. Selbstverständlich ist es gut, wenn Gerechtigkeit herrscht. Aber Freiheit kommt davon nicht. Freiheit kann nur im eigenen Herzen sein. Wir sind erst dann frei, wenn wir ein Glück erleben, das unabhängig ist von dem, was um uns herum geschieht. Es ist noch nie einem Menschen gelungen, dass alles um ihn herum nach seinen Wünschen war. Das gibt es nicht! Auch der Buddha wurde angefeindet, verleumdet; Jesus gekreuzigt. Glück aber – und es gibt keinen, der es nicht sucht –, kann man finden: in der Herzensreinheit. Denn Liebe und Mitgefühl sind reine Empfindungen. Sie sind jedem möglich. Das meint der viel zitierte Ausspruch »Wir haben alle Buddha-Natur«. Ja, wir haben die Möglichkeit der Reinheit. Wir müssen uns nur darum bemühen. Dabei ist von großem Wert, ein Ideal vor Augen zu haben, an dem wir uns ausrichten können. Aber nicht anbeten! Das bringt nichts, es verleitet bloß dazu, weiter nichts zu tun. Dem Ideal dankbar sein, Respekt vor ihm haben, es lieben – das öffnet das Herz. Der Buddha als Ideal hat nur einen Sinn: den der Nachahmung.
Aus Mitgefühl mit den Göttern und Menschen hat der Buddha in den 45 Jahren seines erleuchteten Lebens Tag für Tag gelehrt, auch wenn er krank war. Rund 17.500 Lehrreden sind überliefert. Es heißt, er habe jeden Morgen das »Netz« seines Mitgefühls ausgeworfen, um darin einen Menschen zu »fangen«, dem er an diesem Tag helfen könnte. Gemeint ist seine Hellsicht, mit der er sehen konnte, wer seine Hilfe nicht nur brauchte, sondern aus ihr auch Nutzen ziehen würde. Oft war er dazu stundenlang unterwegs, und immer ging er zu Fuß, denn er wollte sein Gewicht nicht den Zugtieren aufbürden.