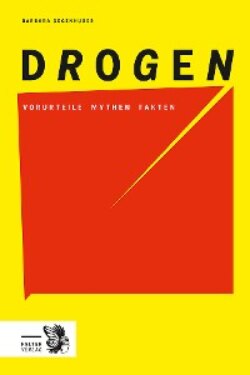Читать книгу Drogen - Barbara Gegenhuber - Страница 10
WIE DROGEN WIRKEN
ОглавлениеWovon sprechen wir eigentlich, wenn wir von Drogen sprechen, was ist der Unterschied zwischen harten und weichen Drogen und wozu zählt der Alkohol? Um diese Fragen zu beantworten, muss man zuerst den Begriff „Droge“ näher beleuchten. Fragt man hundert verschiedene Personen, welche Drogen sie kennen, werden wahrscheinlich Substanzen wie Heroin, Kokain, eventuell noch Cannabis oder LSD genannt. Zu einem hohen Prozentsatz vermutlich jene Substanzen, die gesellschaftlich weniger anerkannt und darüber hinaus verboten sind. Erweitert man diese Befragung hinsichtlich der Gefährlichkeit unterschiedlicher Drogen, stehen ebenfalls schnell die illegalisierten Substanzen ganz weit oben auf der Liste. An den Ergebnissen derartiger Untersuchungen wird auch deutlich, wie wenig Wissen tatsächlich über Drogen und deren Gefahrenpotenzial vorhanden ist. In einer österreichischen Bevölkerungsbefragung schätzten beispielsweise knappe 95 Prozent Drogen wie Heroin oder Kokain als gefährlich ein, aber auch LSD – das ein vergleichsweise niedriges Schadens- und Abhängigkeitspotenzial hat – halten 94 Prozent der Befragten für gefährlich, gleich an zweiter Stelle der risikobehaftetsten Substanzen nach Heroin. Sekt hält gerade einmal jeder Fünfte, Bier jeder Vierte für gefährlich. Drei Viertel glauben, auf Cannabis wird man leicht süchtig, nur ein gutes Drittel glaubt dies hingegen bei Wein oder Bier [100]. Einschätzungen, die in keinem Verhältnis zum tatsächlichen Schadens- und Suchtpotenzial dieser Substanzen stehen.
Die meisten Menschen haben also ein Bild davon, was Drogen sind, oder zumindest eine vage Vorstellung. Hört man das Wort „Droge“ denkt man an Abhängigkeit, Gefährlichkeit, Risiko, eventuell sogar an Gefängnis oder Tod. Bilder von verwahrlosten Menschen, die in U-Bahn-Stationen oder auf öffentlichen Plätzen herumlungern, machen sich breit, vielleicht auch von Stars oder Mitgliedern der sogenannten High Society, die auf Partys Kokain sniefen. Drogen haben für viele Menschen etwas Abschreckendes, Gefährliches und Fremdes, auf andere wieder üben sie eine Faszination aus. So viele Bilder und Vorstellungen mit dem Begriff der Droge transportiert werden, so ungenau ist die Beschreibung, was er beinhaltet, eine wissenschaftlich exakte Definition des Begriffes gibt es nicht.
Auch die Herkunft des Wortes an sich hilft nicht wesentlich weiter. Der Begriff „Droge“ kommt vom althochdeutschen Wort drög, was so viel wie „trocken“ bedeutet und sich auf getrocknete Pflanzen oder Pflanzenteile zur Herstellung von Gewürzen oder pharmazeutisch wirksamen Arzneimittel bezieht. Folgt man der Begrifflichkeit, wären damit chemische Substanzen wie LSD oder Kokain keine Drogen, da sie nicht aus getrockneten Pflanzen bestehen. Auch im Englischen hat der Begriff drugs eine andere Bedeutung als im Deutschen, in den allseits verbreiteten drug stores kann man in den USA nämlich nicht Heroin und Kokain kaufen, sondern Arzneimittel, es handelt sich um Drogerien.
Der Begriff Droge beschreibt in unserem Sprachgebrauch in der Regel illegalisierte Substanzen und ist mit Mythen, Ängsten und Fantasien behaftet. Die fehlende Neutralität ist gleichzeitig ein Teil des Problems. Der Begriff transportiert immer eine bestimmte Bedeutung, für die meisten Menschen eine negative. So gibt es auf der einen Seite die in der Gesellschaft zumeist geächteten Drogenkonsument*innen, auf der anderen Seite die gesellschaftlich weitgehend anerkannten Alkoholkonsument*innen. Mit einem unterschiedlichen Gefährlichkeitspotenzial hat diese Unterscheidung nichts zu tun, es gibt durchaus einige Substanzen, die gemeinhin unter den Begriff Droge fallen, jedoch gesundheitlich weniger bedenklich sind als der Konsum von Alkohol. Diese Unterteilung in legalisierte und illegalisierte Substanzen zur Gefährlichkeitseinschätzung macht demnach nur bedingt Sinn. Auch Alkohol und Nikotin sind Drogen, nur wesentlich weiter verbreitete als Heroin, Kokain oder Cannabis.
Die exaktere sowie weniger moralisierende Bezeichnung ist psychoaktive oder psychotrope Substanzen. Darunter versteht man Stoffe, die in der Lage sind, die Wahrnehmung, das Verhalten, die Befindlichkeit oder Denkprozesse zu beeinflussen. Sie wirken auf das zentrale Nervensystem und lösen dort etwas aus. Sie regen an, beruhigen, verursachen Halluzinationen, führen zu Enthemmung, mehr Selbstvertrauen und vielem anderen mehr.
Nicht jede psychoaktive Substanz wirkt gleich, man kann sie grob in drei verschiedene Gruppen einteilen: betäubende Substanzen, halluzinogene Substanzen und stimulierende, aufputschende Substanzen, wobei es bei vielen von ihnen Überlappungen betreffend die Wirkungsbereiche gibt. Zu den betäubenden Substanzen zählen neben Heroin und Schlafmitteln der Alkohol, zu den stimulierenden neben Kokain das Nikotin. Der Begriff der psychoaktiven Substanzen unterscheidet also nicht zwischen legalen, gesellschaftlich anerkannten Drogen und solchen, die kriminalisiert und weniger verbreitet sind, sondern umfasst alle Substanzen, die in der Lage sind, unser Erleben, Befinden und unsere Wahrnehmung zu beeinflussen.
Ein weiterer Begriff, der in den Sprachgebrauch eingezogen ist, aber aus wissenschaftlicher Sicht wenig Sinn macht, ist die Unterscheidung zwischen „harten“ und „weichen“ Drogen. Diese Einteilung ist ein Versuch, Substanzen anhand ihres Gefährdungspotenzials zu differenzieren, und stammt ursprünglich aus der niederländischen Gesetzgebung. Der Besitz bestimmter „weicher“ Substanzen führt dort unter bestimmten Umständen nicht zur Strafverfolgung. Wo es in den „Coffee Shops“ einen toleranten Umgang mit Cannabis gibt, braucht es eine Abgrenzung zu anderen Substanzen, die als gefährlicher eingeschätzt werden und deren Besitz streng verboten ist. Zu den weichen Drogen zählen in der Regel Cannabis, zu den harten Kokain und Heroin. Doch der „Drogenmarkt“ ist noch viel größer und eine eindeutige treffgenaue Einteilung in eine der beiden Kategorien ist nicht möglich.
Manchmal verläuft die Trennlinie zwischen harten und weichen Drogen auch entlang der Art des Abhängigkeitspotenzials, bei weichen Drogen geht man landläufig davon aus, dass sie „nur“ psychisch abhängig machen, harte Drogen auch körperlich. Nichtsdestotrotz zählt Kokain zu den harten Drogen, obwohl es nur eine psychische und keine körperliche Abhängigkeit auslöst. Diese Trennung suggeriert, dass eine psychische Abhängigkeit weniger gravierend ist als eine körperliche. Die Realität ist aber, dass es sehr schwierig ist, eine rein psychische Abhängigkeit zu überwinden, eine körperliche ist zumindest mit medizinischer Unterstützung vergleichsweise einfacher zu lösen. Die meisten Betroffenen bekommen eine körperliche Abhängigkeit wesentlich schneller in den Griff als eine psychische. Die körperliche Abhängigkeit bei Opiaten wie etwa Heroin kann man mit einem Entzug, der in der Regel in ein paar Tagen vorbei ist, oder mit der Behandlung mit Drogenersatzstoffen bewältigen. Sie ist auf einer medizinischen Ebene relativ gut behandelbar, auf dem Weg der Genesung aber noch nicht einmal die halbe Miete. Die psychische Entwöhnung ist in der Regel wesentlich intensiver und langwieriger.
Dazu kommt, dass es eine Reihe von Substanzen gibt, die allgemein ein geringes Abhängigkeitspotenzial haben. Diese mit einer Klassifizierung als weiche Droge auf dieselbe Stufe zu stellen wie andere, vor allem neuere psychoaktive Substanzen, die zum Teil ein erhebliches psychisches Abhängigkeitspotenzial haben, wäre nicht gerechtfertigt. Aus diesen Gründen ist die Unterteilung in harte und weiche Drogen überholt und wird in der Wissenschaft nicht mehr verwendet, obwohl sie im Sprachgebrauch vieler Menschen noch vorhanden ist. Von der von ihr ausgehenden Dramatisierung oder Verharmlosung von bestimmten Substanzen, sollte man sich nicht verwirren lassen.
Welche Substanzen sind denn nun mehr, welche weniger gefährlich? Und was bedeutet „gefährlich“ überhaupt? Ist eine Substanz erst gefährlich, wenn dabei x Menschen pro Jahr an ihrer Toxizität sterben? Mit einer derartigen Definition wären nicht-substanzgebundene Süchte wie etwa die Spielsucht völlig ungefährlich. Menschen, die wegen hoher Spielschulden all ihr Hab und Gut verlieren und in die Beschaffungskriminalität abgleiten, werden vermutlich nicht bestätigen, dass Spielsucht ungefährlich ist. Es braucht demnach andere Indikatoren für die Beurteilung von Gefährlichkeit.
In einer Arbeit des britischen Psychiaters David Nutt [80], Professor für Neuropsychopharmakologie am Imperial College London, wurde die Gefährlichkeit verschiedener psychoaktiver Substanzen anhand einer Vielzahl von Merkmalen untersucht: Schäden, die der Konsum einer Substanz bei den Konsument*innen selbst verursacht, sowie Schäden bei anderen. Körperliche Folgeschäden wie drogenbezogene Todesfälle spielten genauso eine Rolle wie Folgeerkrankungen, seien dies Infektionen mit HIV oder Hepatitis C oder auch Krebserkrankungen durch Rauchen. Auch psychische und soziale Folgeschäden wie der Verlust von Beziehungen und Besitz wurden in der Untersuchung miteinbezogen. Auf der gesellschaftlichen Ebene wurde die Kriminalität, die der Konsum einer Substanz verursacht, ebenso berücksichtigt wie wirtschaftliche Folgeschäden. Es handelt sich dabei also um ein sehr vielschichtiges Modell, das die Gefährlichkeit von psychoaktiven Substanzen auf mehreren Ebenen untersucht. Etwas, das der Realität mit Sicherheit näher kommt als die Einteilung in harte und weiche Drogen.
Die Gefährlichkeit von zwanzig verschiedenen Substanzen wurde auf diese Weise von einem Expert*innenkomitee eingeschätzt, es zeigte sich ein wenig überraschendes Bild. Die insgesamt gefährlichste Substanz, zählt man die Schäden für die Konsument*innen selbst und die Schäden für andere zusammen, ist der Alkohol. An der zweiten, dritten und vierten Stelle stehen Heroin, Crack und Methamphetamin (Crystal Meth), Nikotin ist auf Platz sechs. Damit sind unter den sechs gefährlichsten Drogen zwei Substanzen, die nicht verboten sind: Alkohol und Nikotin. Cannabis steht bei dieser Reihung auf Platz acht, LSD auf Platz 18. Betrachtet man nur das Schadenspotenzial für die Konsument*innen selbst, sind drei illegalisierte Substanzen vorne: Heroin, Crack und Methamphetamin. An oberster Stelle für den Schaden bei anderen steht jedoch der Alkohol [80, 81], etwas, das man nicht glauben möchte, wenn man in die Boulevardzeitungen schaut. Dort werden oftmals Delikte aus dem Bereich der Beschaffungskriminalität bei illegalisierten Substanzen dramatisiert, während Autounfälle oder Gewaltdelikte, bei denen Alkohol im Spiel ist, verharmlost werden. Die subjektive Wahrnehmung der Gefährlichkeit einer Substanz scheint sich hier oft nicht mit der objektiven Gefährlichkeit zu decken.
Die Wirkung von Drogen ist individuell sehr unterschiedlich und hängt von einer Reihe begleitender Faktoren ab. So kann das Konsumieren von Cannabis in einer geselligen Runde zu Lachanfällen führen, während der Konsum derselben Substanz alleine zu Hause vielleicht entspannt und zum Einschlafen anregt. Die Wirkung ist nicht nur von der Substanz, sondern auch von der Umgebung (dem Setting) und der Person und ihren Erwartungen (dem Set) abhängig. Darüber hinaus macht es einen Unterschied, ob man eine Substanz raucht oder sie nasal, intravenös oder auf anderen Wegen konsumiert (siehe weiter unten „Konsumformen“). Es gibt demnach nicht die eine immer gleiche Wirkung einer Substanz, wenngleich diese nach Wirkungsklassen doch grob in drei verschiedene Gruppen eingeteilt werden können: Beruhigende, dämpfende Substanzen (Sedativa/„Downer“), anregende Substanzen (Stimulantien/„Upper“) und Substanzen, die verzerrte Sinneswahrnehmungen auslösen (Halluzinogene) [116].
Schädlichkeit von Drogen
Konsumformen
Intravenös
Beim intravenösen (i.v.) Konsum wird das Suchtmittel durch Erhitzen verflüssigt und in die Venen gespritzt. Heroin wird dabei mit Wasser und Ascorbin- oder Zitronensäure auf einem Löffel vermischt und mit einem Feuerzeug angehitzt – „aufgekocht“, wie es in der Szenesprache heißt. Wenn sich das Heroin vollständig aufgelöst hat, wird das Gemisch mit einer Spritze aufgezogen und in eine Vene in Unterarm, Unterschenkel, Ellenbeugen oder die Leiste, vereinzelt auch in Muskeln injiziert. Durch den jahrelangen i.v. Konsum vernarben oft die Einstichstellen, Abhängige beginnen in die Venen an Händen oder Füßen oder am Hals zu injizieren. Der intravenöse Konsum verschafft zwar den schnellsten „Kick“, ist aber auch die riskanteste Konsumform. Durch die rasche Anflutung der Substanz im Körper kommt es schneller zu Überdosierungen als bei jeder anderen Konsumform. Dazu kommt die Gefahr von Abszessen, Vernarbungen und Infektionen mit Viren, Bakterien und Pilzen sowie HIV und Hepatitis C durch unsauberes Spritzbesteck. Neben Heroin können auch andere Substanzen wie Kokain, Benzodiazepine, Speed oder Crystal Meth intravenös konsumiert werden.
Nasal-Sniefen
Eine vor allem beim Kokainkonsum verbreitete Konsumform ist das Sniefen oder „Durch-die-Nase-Ziehen“. Hierbei wird das Pulver so klein wie möglich zerhackt und mit Hilfe von Ziehröhrchen in die Nase gezogen. Als Ziehröhrchen werden zumeist Geldscheine oder ein Stück Papier benutzt, bei der gemeinsamen Verwendung besteht die Gefahr einer Ansteckung mit Hepatitis C, Herpes oder anderen Infektionen. Das Sniefen ist zwar im Vergleich zur intravenösen Applikation die schonendere Konsumform, die Gefahr der Schädigung der Nasenschleimhaut ist jedoch groß, die Möglichkeit einer Überdosierung ebenfalls gegeben.
Analinjektion
Die – eher selten angewendete – Analinjektion funktioniert ähnlich wie der oben beschriebene intravenöse Konsum, nur wird die Substanz, anstatt sie mit einer Nadel in die Vene zu injizieren, mithilfe einer nadellosen Spritze in den After gespritzt. Durch die Schleimhäute gelangt der Wirkstoff sehr schnell ins Blut, ähnlich wie bei der intravenösen Applikation. Der Vorteil ist, dass die Schleimhäute im Enddarm eine Filterfunktion für manche Krankheitserreger haben.
Rauchen
Einige illegalisierte Substanzen können auch geraucht werden. Dies geschieht entweder pur in einem speziellen kleinen Pfeifchen, oder auch mit Tabak vermischt in einer Zigarette oder einer Wasserpfeife (Bong). Infektionen mit HIV und Hepatitis C sind nahezu ausgeschlossen. Eine spezielle Form des Rauchens, die häufig beim Heroinkonsum zur Anwendung kommt, ist das sogenannte „Folie rauchen“. Dabei wird das Heroin auf einem Stück Alufolie erhitzt, sodass es schmilzt und zu einer öligen Flüssigkeit wird. Der dabei entstehende Dampf wird mithilfe eines Röhrchens inhaliert. Streckmittel und andere Verunreinigungen geraten nicht – wie beim intravenösen Konsum – direkt in die Blutbahn, sondern werden von Nasenschleimhaut und Lunge gefiltert oder bleiben unaufgelöst auf der Folie. Die Gefahr, sich mit HIV oder Hepatitis C zu infizieren, ist gleich null. Die Wirksamkeit ist im Vergleich zum intravenösen Konsum deutlich geringer, wodurch Überdosierungen wesentlich unwahrscheinlicher, jedoch nicht unmöglich sind.
Zur Gruppe der Sedativa zählen alle Substanzen, die beruhigend, angstlösend oder schlaffördernd wirken, sie machen müde und dämpfen die körperliche Aktivität. Zu den missbräuchlich verwendeten Substanzen dieser Klasse – szenesprachlich auch als „Downer“ bezeichnet – zählen Benzodiazepine, Opioide, Barbiturate und auch Alkohol. Es gibt sowohl pflanzliche Präparate mit beruhigender Wirkung, wie etwa Baldrian, als auch chemisch-synthetische Stoffe mit unterschiedlich starker Wirkung.
Benzodiazepine sind die am häufigsten verwendeten Beruhigungs- und Schlafmittel, sie dämpfen die Funktion des zentralen Nervensystems und werden regelmäßig ärztlich verordnet. Eingesetzt werden sie zur Linderung von Schlafstörungen, Angst- und Spannungszuständen bei psychischen Erkrankungen oder auch zur Beruhigung im Rahmen von diagnostischen Eingriffen wie beispielsweise einer Magenspiegelung. Sedativa und Hypnotika sind durchaus sehr gebräuchliche und gut wirksame Medikamente der Humanmedizin. Sie haben nur einen Haken: Die meisten Beruhigungsmittel können als Nebenwirkung körperlich stark abhängig machen, was den Empfänger*innen dieser Medikamente nicht immer bewusst ist. Nicht selten wurden und werden diese bei Angstzuständen, Depressionen und Schlafstörungen, aber auch bei weniger beeinträchtigenden Zuständen wie Nervosität oder Überlastung eher großzügig verschrieben, was dazu führt, dass man nach einiger Zeit der Medikamenteneinnahme eine Abhängigkeit von Benzodiazepinen entwickelt. Manchmal fällt diese den Betroffenen erst auf, wenn die Medikamente plötzlich abgesetzt werden (müssen), was zu unangenehmen Entzugserscheinungen führt. Insofern ist darauf zu achten, Benzodiazepine nur nach strenger Indikationsstellung, so kurz wie möglich und so niedrig dosiert wie unbedingt notwendig einzunehmen [112]. Vor der Einnahme eines Beruhigungs- oder Schlafmittels sollte man sich bei der behandelnden Ärztin, dem behandelnden Arzt vergewissern, ob ein Abhängigkeitspotenzial der verordneten Substanzen besteht. Ist dies der Fall, ist es ratsam – nach einer genauen Kosten-Nutzen-Abwägung durch die Ärztin oder den Arzt –, darauf zu achten, diese Medikamente, wenn möglich, nicht dauerhaft einzunehmen beziehungsweise nach einer Zeit eine Alternative zu suchen. Nach Schätzungen des Gesundheitsministeriums sind in Österreich etwa 140.000 Menschen von Beruhigungs- und Schlafmitteln abhängig, wovon vorwiegend Frauen und ältere Menschen betroffen sind. Die Dunkelziffer könnte jedoch noch deutlich höher liegen [112]. Aufgrund ihrer vergleichsweise hohen Unauffälligkeit wird die Medikamentenabhängigkeit häufig auch als „stille Sucht“ bezeichnet.
Auch Opioide finden eine breite Anwendung in der Medizin, sie gelten als die effektivsten Schmerzmittel. Im Rahmen des missbräuchlichen Konsums wird vorwiegend das halbsynthetische Opioid Heroin konsumiert, das angst- und schmerzlösend sowie beruhigend wirkt. Im Rausch löst es ein Gefühl der Geborgenheit und Zufriedenheit aus, das psychische sowie physische Abhängigkeitspotenzial ist hoch. Ein Problem im Rahmen des abhängigen Konsums ist eine Eigenschaft dieser Substanzklasse, die auch bei Operationen zutage tritt: Sie wirken atemdepressiv, das heißt sie reduzieren den körpereigenen Atemantrieb. Atemdepressionen im Rahmen von Überdosierungen sind für die meisten Todesfälle im Zusammenhang mit dieser Substanzklasse verantwortlich.
Stimulantien erzeugen das Gegenteil, sie wirken anregend und aufputschend. Wie auch viele andere Drogen wurden Stimulantien früher zu medizinischen Zwecken verwendet. In den 1920er-Jahren wurde etwa das milde Stimulantium Ephedrin als Medikament gegen Atemnot bei Asthmatikern eingesetzt. Damals wurde die Substanz aus der eher seltenen Pflanze der Gattung Meerträubel (Ephedra) gewonnen, später wurde Ephedrin synthetisch hergestellt und unter dem Namen Amphetamin bekannt. Bis Ende der 1930er-Jahre waren Amphetamine als Arzneimittel verbreitet, etwa bei Depressionen, als wirksames Mittel gegen Schwangerschaftserbrechen oder Erkältungen. Im Zweiten Weltkrieg wurden Amphetaminderivate eingesetzt, um Soldaten wacher und furchtloser zu machen. Diese Derivate waren unter dem Namen „Pervitin“ oder „Nazi-Speed“ bekannt und sind im Grunde dasselbe wie das heute bekannte Crystal Meth, wenn es auch damals in einer geringeren Dosierung eingesetzt wurde. Aufgrund des hohen Missbrauchspotenzials und der anfangs nicht bekannten Nebenwirkungen wurde die Zulassung von Amphetaminen in Arzneimitteln stark eingeschränkt, wenngleich sie heute noch in einigen Medikamenten gegen das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (ADHS) oder plötzliche Schlafanfälle während des Tages (Narkolepsie) eingesetzt werden. Zu den Stimulantien – umgangssprachlich auch als „Upper“ bezeichnet – zählen neben den Amphetaminen auch Kokain, Crack, synthetische Cathinone, Nikotin oder, in der Subgruppe der Entaktogene, auch Substanzen mit einer stimulierenden und gleichzeitig bewusstseinsverändernden Wirkung wie MDMA (Ecstasy).
Die letzte große Substanzklasse sind Halluzinogene, die stark bewusstseins- und sinnesverändernd wirken, typisch ist ein stark verändertes Erleben von Raum und Zeit. Zu den Halluzinogenen zählen in der Natur vorkommende Substanzen wie Meskalin oder Psilocybin („Magic Mushrooms“) sowie künstlich hergestellte Phenyläthylamine wie 2-CB. Das wohl bekannteste – und auch eines der potentesten Halluzinogene – ist das im Jahr 1938 erstmals von Albert Hofmann hergestellte LSD, der sich davon vorerst eine kreislaufstimulierende Wirkung versprach. Hofmann war Chemiker und experimentierte vorwiegend mit Naturstoffen, so auch mit einem Getreideparasiten namens Mutterkornpilz. Die darin enthaltene Lysergsäure ist die Grundform der Substanz Lysergsäurediethylamid, von der LSD seinen Namen hat. Die ersten Tests mit LSD ergaben jedoch nicht die erhoffte Wirkung, weswegen auch erst Jahre später weiter geforscht wurde. Im Jahr 1943 experimentierte Hofmann neuerlich mit der Substanz LSD-25 und testete diese im Selbstversuch, wobei er die hochpotente halluzinogene Wirkung erkannte und sich daraus einen Nutzen für die Psychiatrie erhoffte. LSD war, wie viele psychoaktive Substanzen, ursprünglich nämlich nicht für die Berauschung bestimmt, sondern für psychotherapeutische Anwendungen. Es wurde als Medikament unter dem Namen „Delysid“ verkauft und sollte in der Psychotherapie der Entspannung und „Freisetzung verdrängten Materials“ dienen, so war es im Beipackzettel angegeben. Auch für experimentelle Studien von Psychiater*innen selbst war es gedacht, durch die halluzinogene Wirkung sollten Fachkräfte einen Einblick in die Welt der Wahrnehmung psychotischer Patient*innen bekommen. Auch heute wird noch am therapeutischen Effekt der entspannenden und wahrnehmungsverändernden Wirkung von LSD geforscht, vorwiegend bei Patient*innen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung oder starker Angst bei körperlich schwer erkrankten Menschen. Doch bei dieser therapeutischen Anwendung blieb es nicht, auch weil sich die therapeutischen Hoffnungen nicht erfüllten. In den Sechziger- und Siebzigerjahren entdeckte die Hippie- und Partyszene die sinnesanreichernde Wirkung der Substanz, weswegen diese auch nach und nach verboten wurde.
Halluzinogene wirken auf alle Sinnesempfindungen, die äußere Realität vermischt sich mit der inneren Wahrnehmung. Dinge, die normalerweise starr sind, bewegen sich plötzlich, nehmen die buntesten Farben an, fangen vielleicht sogar an zu sprechen. Die Konsument*innen erleben sich selbst mittendrin in dieser plötzlich veränderten Welt. Aber nicht nur Raum und Zeit werden verändert wahrgenommen, oft auch die eigene Person. In der Psychologie wird dieser Zustand „Ich-Auflösung“ genannt, die Grenzen zwischen der eigenen Person und der Welt verschwimmen und zerfließen, die Kontrolle über sich und die Realität geht verloren. Während dies manchmal als sehr positiv wahrgenommen, als spirituelle Erfahrung und als „eins sein mit der Welt“ beschrieben wird, kann dies auch zum Gegenteil führen – zu dem, was in der Umgangssprache als „Horrortrip“ bezeichnet wird. Man fühlt sich durch den extremen Ausnahmezustand und damit einhergehenden Kontrollverlust bedroht und hat Angst „abzustürzen“, die Überwältigung durch die Substanzwirkung kann zu paranoiden oder psychoseähnlichen Zuständen führen. Der Verlauf des Rausches ist damit sehr von der Person, den Erwartungen und der Situation abhängig, diese Faktoren bestimmen, ob es zu einem positiven, von Euphorie getragenen Erlebnis oder zu einem Horrortrip kommt.
Obgleich diese Einteilung in drei Hauptwirkungsklassen sehr anschaulich ist, lassen sich Substanzen nicht immer ganz eindeutig zuordnen. Die meisten von ihnen haben nicht nur eine eindeutige Wirkung, sondern auch Bestandteile anderer Wirkungsklassen. Cannabis beispielsweise wirkt beruhigend, kann aber durchaus auch Halluzinationen verursachen. Alkohol wirkt – vor allem bei den ersten Gläsern – anregend und stimulierend, hat aber ab einer gewissen Dosis eher eine beruhigende Wirkung. Etwas, das sich im Übrigen auch im Alltag ganz gut beobachten lässt. Nach den ersten Gläsern werden Menschen oft kommunikativer und „lustiger“, ab einem gewissen Alkoholpegel jedoch immer ruhiger, bis irgendwann von der anfänglichen Angetriebenheit nichts mehr zu merken ist und die Betroffenen einschlafen. Insofern kann eine derartige Einteilung nie grenzgenau sein, sie gibt jedoch einen Überblick über die vorwiegend auftretende Wirkung.
Substanzklassen
Eine detaillierte Beschreibung anhand ihrer Wirkungsweise, Verbreitung, Konsumform und der damit einhergehenden Gefahren und Risiken der wichtigsten am Markt verfügbaren und häufig missbräuchlich verwendeten psychoaktiven Substanzen findet sich in Kapitel „Kleine Substanzkunde“.