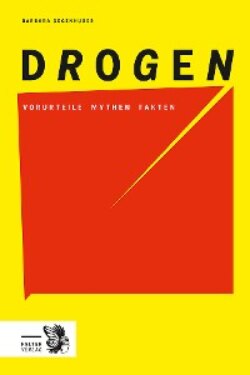Читать книгу Drogen - Barbara Gegenhuber - Страница 7
DIE POLITIK UND DIE SUCHT
ОглавлениеÖsterreich hat bei der Herstellung und dem Konsum von Alkohol eine lange Tradition, er ist Teil unserer Kultur. Es ist noch gar nicht so lange her, dass es gang und gäbe war, auf Baustellen oder ähnlich herausfordernden Arbeitsplätzen Bier zu trinken, natürlich nur wegen des Flüssigkeitsverlustes und der Elektrolyte. Der Konsum von Alkohol auf den zahlreichen Zelt- und Dorffesten am Land, aber auch in Bars und Lokalen in den Großstädten ist für viele selbstverständlich. Die Weinbauern der steirischen Weinstraßen oder anderer Heurigengegenden sind genauso wenig aus der Landschaft wegzudenken wie die großen Brauereien, die als Sponsoren von Veranstaltungen auftreten oder Werbung in den Medien schalten. Alkohol wird in Österreich mit einer Selbstverständlichkeit konsumiert, wie das nicht in vielen Ländern dieser Welt der Fall ist.
Das heißt aber nicht, dass andere Kulturen nicht auch Substanzen zur Berauschung verwenden. So etwa findet man in den südamerikanischen Anden zahlreiche Coca-Bauern. Das Kauen von Blättern der Coca-Pflanze ist aufgrund ihrer anregenden Wirkung in den hochgelegenen Gegenden von Peru, Chile oder Bolivien weit verbreitet. In der Eisenbahn, die über das peruanische Hochland fährt, wird im Bordrestaurant Coca-Tee als Mittel gegen die Höhenkrankheit verkauft. Die Bevölkerung kaut die Blätter mit ihrer stimulierenden und aktivierenden Wirkung zu vielen Gelegenheiten. In Ländern ohne eine derartige Tradition ist die Coca-Pflanze weitgehend verboten, obwohl man kiloweise Blätter benötigen würde, um eine brauchbare Menge Kokain daraus herzustellen. In einer anderen Ecke der Welt ist der Konsum von Cannabis verbreitet, nicht nur weil die gesetzlichen Regelungen dies erleichtern, sondern auch weil damit ein gewisses Lebensgefühl transportiert wird. Man denke dabei nur an die Rastafarians in Jamaika, bei denen Reggae, Dreadlocks und Cannabiskonsum wohl die bekanntesten Aspekte der Rasta-Religion darstellen.
Es sind also bei weitem nicht die Gefährlichkeit oder das Abhängigkeitspotenzial alleine, die über den Konsum von psychoaktiven Substanzen in einem Land entscheiden, vielmehr sind es die Traditionen und damit verbunden natürlich auch die gesetzlichen Regelungen, die das Ausmaß dieses Konsums in einer Gesellschaft mitbestimmen. Relativ deutlich sieht man dies am sehr unterschiedlichen Umgang mit Cannabis, das in immer mehr Ländern der Welt legalisiert oder zumindest entkriminalisiert wird, während es in anderen noch streng verboten ist. Mit einer rein wissenschaftlich orientierten Einschätzung der Gefährlichkeit einer Substanz hat das nichts zu tun, sonst wären vermutlich Alkohol und Nikotin verboten und Cannabis erlaubt. Es muss demnach andere Gründe für die unterschiedlichen Herangehensweisen und gesetzlichen Regelungen geben.
Um einen Einblick in die Entstehung dieser Zugangsweisen zu bekommen, muss man etwas weiter zurückgehen und einen Blick in die amerikanische Geschichte des frühen 20. Jahrhunderts werfen. Bis zum Jahr 1920 galten in den USA Alkohol und Cannabis als legale Genussmittel, in den Saloons wurde Alkohol getrunken, Kühlgeräte wurden von Brauereien gesponsert. Damit einhergehend wuchs auch das Angebot an Glücksspielen und Prostitution. Diese zunehmende Freizügigkeit und Lustbarkeit gefiel nicht allen in den USA. Puritanische Bewegungen, die vorwiegend von der anglikanischen Oberschicht ausgingen, sahen ihren Einfluss und die christlichen Werte schwinden und setzten sich für ein Verbot des Alkohols ein. Kriminalität und Korruption, soziale Probleme und die große Zahl an Gefängnissen wurden dem „Teufel Alkohol“ angelastet. So kam es, dass immer mehr Bundesstaaten unter dem Druck verschiedener Abstinenzorganisationen, wie etwa der Anti-Saloon League, der Prohibition Party, der Woman’s Christian Temperance Union (Christlicher Frauenbund für Abstinenz) und vieler anderer mehr, lokale Alkoholverbote erließen. Es entstanden Landkarten mit „trockenen Zonen“. Im Jahr 1916 war die Prohibition in 23 Staaten der USA eingeführt. Mit 16. Jänner 1920 trat das sogenannte Volstead-Gesetz in Kraft, das die Erzeugung, den Verkauf sowie Transport alkoholischer Getränke auf amerikanischem Staatsgebiet untersagte. Der Beginn der Ära der Prohibition begann mit der Hoffnung auf eine Verbesserung der Gesundheit und der sozialen Situation der Bürgerinnen und Bürger.
Tatsächlich hatte die Prohibition auch positive Auswirkungen, der Alkoholkonsum ging anfangs zurück und auch die alkoholbezogenen Todesfälle – vorwiegend durch Leberzirrhosen – verringerten sich deutlich. Wer sich aber betrinken wollte, dem gelang das auch damals. Alkohol war zwar nicht mehr auf legalem Weg zu kaufen, dafür blühten Schwarzmarkt, Schmuggel und Schwarzbrennerei. Obwohl Alkohol verboten war, konnte man immer irgendwo welchen erstehen. Es etablierten sich sogenannte „Speakeasys“, illegale Bars, in denen man nach dem „Flüstern“ eines Codewortes Alkohol beziehen konnte. Schwarzbrenner destillierten illegal Whisky, der aufgrund seiner heimlichen Herstellung bei Nacht auch „Moonshine“ genannt wurde.
Doch nicht alle Schwarzbrenner arbeiteten sauber und gewissenhaft, gepanschter Alkohol verursachte Vergiftungen, die zu Hirnschäden und Erblindungen bis hin zum Tod führten. Auch gingen die Konsument*innen dazu über, eher hochprozentige Spirituosen statt Wein oder Bier zu trinken, da diese leichter zu schmuggeln waren. Wer Alkohol trinken wollte, bekam diesen, jedoch war der Konsum in Hinblick auf die gesundheitlichen Folgeschäden und die Kriminalisierung deutlich riskanter. Die Zahl der Verbrechen und damit auch der Inhaftierten stieg massiv an, die Korruption blühte.
Eine weitere wesentliche negative Folge der Prohibition war die Förderung mafiöser Strukturen und organisierter Kriminalität. Kriminelle wie Al Capone oder Johnny Torrio gründeten Vereinigungen, die nicht zuletzt durch den Verkauf von Alkohol und die Kontrolle des Alkoholmarktes vorher nie dagewesene Größe und Einfluss erlangten. Der illegale Handel mit Alkohol war ein großes Geschäft, mafiöse Strukturen blieben weit über das Ende der Prohibition bestehen. Lediglich die Art der gehandelten Waren änderte sich im Lauf der Zeit, weg von Alkohol hin zu Drogen und Waffen.
Aufgrund dieser negativen Folgewirkungen musste man schließlich zur Kenntnis nehmen, dass das schlichte Verbot einer Substanz nicht den gewünschten Erfolg bringt, sondern, im Gegenteil, weit massivere Probleme schafft. Dazu kam, dass die Besteuerung von Alkohol auch eine attraktive Einnahmequelle für das von der Wirtschaftskrise gebeutelte Land darstellte. So wurde am 5. Dezember 1933 das Experiment Prohibition wieder aufgegeben.
Damit war der Kampf gegen den Substanzkonsum jedoch nicht beendet. Es gab nach dem Ende der Prohibition viele Arbeitskräfte, die mit der Kontrolle und Exekution des Volstead-Gesetzes beschäftigt gewesen waren und nun keine Aufgabe mehr hatten. In diesem Zusammenhang spielte Harry J. Anslinger, der damalige Leiter des Federal Bureau of Narcotics, eine wesentliche Rolle. Er war ein entschiedener Gegner von Drogen, jedoch weniger aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse als aufgrund persönlicher Erfahrungen sowie rassistisch geprägter Vorurteile. Er vertrat die Meinung, dass Marihuana die Menschen zu wilden Bestien macht, die Frauen vergewaltigen und töten, und bezog sich dabei auf einen damals großes Aufsehen erregenden Mordfall, ein Einzelereignis, das medial hochstilisiert wurde. Der Zeitungsmagnat William Randolph Hearst sowie ein Chemiekonzern unterstützten Anslingers Kampagne, auf eine wissenschaftliche Überprüfung seiner Thesen wurde kein Wert gelegt. Im Gegenteil, Anslinger führte seinen erbitterten Kampf gegen Marihuana mit autoritären und polemischen Mitteln und verknüpfte diesen mit einer rassistischen Kampagne gegen Schwarze und andere Einwanderer, was in Teilen der Bevölkerung auf regen Zuspruch stieß. Im Jahr 1947 wurde Anslinger in die UN-Drogenkommission berufen, wo er im Jahr 1961 die „Single Convention on Narcotic Drugs1“ durchsetzte, in der Cannabis mit anderen Drogen, wie etwa Heroin, gleichgesetzt wurde. Dieses Einheitsabkommen über Betäubungsmittel unterzeichneten insgesamt 183 Staaten, es ist die bis heute gültige Grundlage gesetzlicher Bestimmungen in zahlreichen Ländern.
Während die USA und andere Staaten nach wie vor einen Drogenkrieg führen, entwickelten sich in Westeuropa gänzlich andere Konzepte. Eine wesentliche Rolle spielten dabei Länder wie die Schweiz, die bis heute einen eher liberalen und unterstützenden Umgang mit Konsument*innen illegalisierter Substanzen pflegt, was allerdings auch mehr der Not als der Tugend geschuldet ist. Ende der 1970er-Jahre etablierte sich in einem Park namens „Platzspitz“ und an anderen Orten in Zürich eine offene Drogenszene, die von der Polizei toleriert wurde und sich bald als Anziehungspunkt für Drogenabhängige aus der gesamten Schweiz entwickelte. Die Konsument*innen lebten in dem Park und gingen dort offen ihrem Konsum, dem Drogenhandel, der Prostitution und anderen sonst gesellschaftlich unerwünschten Verhaltensweisen nach. Die Stadt tolerierte die Szene und überließ sie sich selbst, was nach und nach zur Ghettoisierung und Verelendung der dort wohnhaften Abhängigen führte. Eine kaum mehr zu bewältigende Anzahl an Überdosierungen und Drogentoten war die Folge. Der mittlerweile als „Needle-Park“ bekannte Platzspitz musste Anfang der Neunzigerjahre geschlossen werden, es brauchte andere Konzepte. Ein Mittelweg zwischen Repression und Freigabe, begleitet von Therapie und schadensminimierenden Angeboten, ist seither die Basis der Schweizer Drogenpolitik. Auch progressivere Konzepte wie die Substitutionsbehandlung mit Diamorphin (Heroin) kommen erfolgreich zur Anwendung, etwas, das in vielen anderen Ländern – Österreich eingeschlossen – politisch undenkbar ist.
Neben diesen historischen Aspekten sieht man auch an aktuellen Diskussionen, dass die Drogenpolitik nicht nur vom Interesse an einem ordentlichen Umgang mit Süchtigen getragen ist. Während zum einen weiterhin ein Krieg gegen illegalisierte Substanzen geführt wird, gibt es derzeit auch ganz andere Bestrebungen: Die Legalisierung von Cannabis schreitet voran, die Regelungen in den USA sind in einigen Bundesstaaten mittlerweile wesentlich liberaler als im einstigen „Kifferparadies“ Amsterdam. Auch wenn die Tendenz in den USA recht eindeutig in Richtung eines liberaleren Umgangs mit der Substanz geht, ist ersichtlich, dass dieser nicht rein auf evidenzbasierten Fakten zum Nutzen oder der Schädlichkeit der Substanz basiert: Von den fünfzig Bundesstaaten ist in rund einem Drittel der Konsum weiterhin illegal, knapp ein Fünftel hat den Konsum legalisiert, ein weiteres Fünftel erlaubt Cannabis aus medizinischen Gründen und in einigen wenigen Staaten erfolgte eine Entkriminalisierung, ein Modell, dem beispielsweise auch Portugal sehr erfolgreich nachgeht.
Die Regelungen sind von einer Vielzahl unterschiedlicher, einander zum Teil widersprechender Interessenlagen abhängig. Steuereinnahmen und Qualitätskontrolle sprechen für eine Legalisierung, die potenziell gesundheitsschädliche Wirkung jeder psychoaktiven Substanz ist nicht zu leugnen. Bleibt letztlich die politisch-ideologische Frage, wie viel gesundheitsschädliche Substanzen sich eine Gesellschaft um welchen Preis leisten will und ob man mehr auf Eigenverantwortung oder mehr auf Fremdbestimmung der Konsument*innen setzt.
Wie ideologisch diese Debatte hierzulande geführt wird, sieht man auch daran, dass sie wenig differenziert ist. Die einen warnen vor Cannabis als Einstiegsdroge, während die anderen nicht einsehen, wieso sie im Keller Bier brauen, aber Gras am Balkon nicht züchten dürfen. Über die Hintertür der Verwendung zu medizinischen Zwecken kann etwas weniger emotionalisiert diskutiert werden, wobei genau diese Vermischung der Liberalisierungsdebatte mehr schadet als nützt.