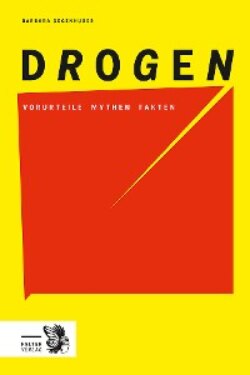Читать книгу Drogen - Barbara Gegenhuber - Страница 16
ABHÄNGIGKEIT
ОглавлениеDie Grenze zwischen schädlichem Gebrauch und Abhängigkeit ist fließend und deren Überschreitung für die Betroffenen oft nicht bewusst wahrnehmbar. Nicht selten sprechen Drogenabhängige davon, dass sie lange geglaubt hätten, den Substanzkonsum im Griff zu haben, die Kontrolle über die Art und Häufigkeit der Drogeneinnahme noch bewusst steuern zu können. Der Zeitpunkt, an dem sie sich eingestehen, dass dem nicht so ist, kommt häufig erst viel später, wenn die Abhängigkeit schon ausgeprägt ist.
In den gängigen Diagnosesystemen geht man davon aus, dass sich eine Abhängigkeit auf mehreren Ebenen manifestiert: auf der körperlichen, psychischen und psychosozialen. Zu den wesentlichsten körperlichen Anzeichen einer Abhängigkeitserkrankung zählen Entzugserscheinungen und Toleranzentwicklung. Unter Entzugserscheinungen versteht man Symptome, die nach dem Absetzen einer Substanz auftreten. Das ist dann der Fall, wenn sich der Stoffwechsel an die Substanz gewöhnt hat und das körperliche Gleichgewicht aus der Balance geraten ist. Bei einem einmaligen massiven Konsum von Alkohol signalisiert der „Kater“, dass der Körper Mühe hat, das Gleichgewicht wiederherzustellen, dies gelingt jedoch in der Regel relativ schnell. Hat sich der Körper jedoch an den dauerhaften Konsum gewöhnt, braucht er die Substanz, um dieses neuen Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Wird diese nicht zugeführt, signalisieren die Entzugserscheinungen, dass das nun auf die Substanz eingestellte Gleichgewicht außer Balance ist.
Eine weitere körperliche Erscheinungsform der Abhängigkeit ist die sogenannte Toleranzentwicklung, die Gewöhnung an eine Substanz. Beim Alkohol ist das sicherlich vielen bekannt. Personen, die nie trinken, sind bereits nach einem Glas Sekt oder einem Achterl Wein leicht angeheitert, während Menschen, die den Alkoholkonsum gewohnt sind, auch drei große Bier trinken können und noch vollkommen nüchtern wirken. Der Körper gewöhnt sich und braucht immer höhere Dosierungen, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Dies geht so weit, dass Alkoholabhängige oft Mengen zu sich nehmen, die ein nicht an diese Dosierungen gewöhnter Mensch nicht überleben würde. Nicht selten begegnet man Patient*innen, denen man es kaum anmerkt, dass sie bereits eine halbe Flasche Wodka und ein paar Bier getrunken haben. Eine Menge, bei der andere Menschen bereits bewusstlos wären. Doch so bedrohlich das klingt, so relativ leicht ist eine körperliche Abhängigkeit zu behandeln. Im Fall der Opiatabhängigkeit ist es möglich, die körperlichen Symptome mit einer entsprechenden Substitutionsbehandlung auszugleichen, damit keine Entzugserscheinungen auftreten. Eine andere Möglichkeit, die beim Alkohol häufig angewendet wird, ist der Entzug, der einige Wochen dauert und mit medikamentöser Unterstützung durchaus gut bewältigbar ist. Beim Entzug von hohen Trinkmengen ist jedoch ein Spitalsaufenthalt mit medizinischer Überwachung unbedingt erforderlich, da dieser zu potenziell lebensbedrohlichen Zuständen führen kann. Beim Opiatentzug ist dies nicht der Fall, wobei auch hier eine medizinische Begleitung die Entgiftung erträglicher macht. Es sind jedoch nicht alle psychoaktiven Substanzen in der Lage, das körperliche Gleichgewicht derart außer Balance zu bringen. Zu den wesentlichsten körperlich abhängig machenden Substanzen zählen Alkohol, Opioide, Benzodiazepine und andere Medikamente. Kokain und Halluzinogene rufen keine körperliche Abhängigkeit hervor, Cannabis nur in einem sehr geringen Ausmaß.
Das weitaus größere Problem ist aber die psychische Abhängigkeit, die sich im Wesentlichen im starken Verlangen nach der Droge manifestiert, in der Fachsprache auch „Craving“ oder „Suchtdruck“ genannt. Dieses starke Verlangen und die damit einhergehende wahrgenommene Unfähigkeit, abstinent zu bleiben, treibt Abhängige an und ist eines der wesentlichsten Motive für einen fortgesetzten Konsum. Die Stärke des Cravings ist diagnostisch schwer festzustellen, da die Beurteilung desselben sehr subjektiv und von außen nicht mit einer Skala messbar ist. Doch genau dieser Suchtdruck und das damit oft verbundene irrationale Handeln ist das, was Außenstehende oft nicht verstehen und nachvollziehen können. Wieso bricht jemand immer wieder seine guten Vorsätze, obwohl er oder sie weiß, dass man damit die Familie verliert, vielleicht wieder ins Gefängnis muss oder den ohnehin schon schwer in Mitleidenschaft gezogenen Körper noch weiter schädigt. Wieso setzt sich jemand über moralische und gesellschaftliche Grenzen hinweg, nur um an sein Suchtmittel zu gelangen. In einer eher rational geprägten Welt wie der unseren ist das für Nichtbetroffene oft schwer zu verstehen, doch genau das macht den psychischen Aspekt der Suchterkrankung aus. Die Unfähigkeit, die vorgenommene Abstinenz auch einzuhalten, die Aufrechterhaltung des Konsums trotz angedrohter oder wahrgenommener negativer Konsequenzen. Gerade bei illegalisierten Substanzen gibt es von Außenstehenden oft wenig Toleranz, etwas, das es bei anderen Suchtmitteln wie Nikotin interessanterweise ja doch gibt. Kaum jemand wird schief angeschaut, wenn er wieder einmal den Silvestervorsatz, mit dem Rauchen aufzuhören, gebrochen hat, weil er das Craving nicht ausgehalten hat. Menschen, die den x-ten Abnehmversuch trotz der allerbesten Vorsätze wieder einmal nicht durchgehalten haben, erhalten oftmals guten Zuspruch und aufmunternde Worte, Opiatabhängige, die rückfällig werden, sehen sich Vorwürfen der Umgebung gegenüber und fühlen sich schuldig. Der Mechanismus ist derselbe, er ist nur bei legalen Suchtmitteln besser nachvollziehbar, weil wesentlich mehr Menschen Erfahrungen mit Nikotin oder Abnehmversuchen als mit Opiaten haben und sich damit besser in andere hineinfühlen können. Die Gründe für das Scheitern sind oft sehr ähnlich und liegen in der Psyche verankert.
Die Bewältigung dieser psychischen Abhängigkeit ist damit der weit schwierigere Prozess als die körperliche Stabilisierung. Der rein körperliche Entzug einer Substanz bedeutet noch lange keine Heilung der Erkrankung, die meisten Menschen werden nach Entzügen ohne zusätzliche weitere Behandlung wieder rückfällig. Der Gedanke, jemand sei nach einem körperlichen Alkohol- oder Drogenentzug „geheilt“, ist viel zu kurz gegriffen, die schwierige Wegstrecke beginnt erst danach. Die Diagnose einer Abhängigkeitserkrankung kann auch gestellt werden, wenn nur eine psychische Abhängigkeit besteht und keine körperliche.
Der dritte Aspekt, der eine Abhängigkeit ausmacht, ist die psychosoziale Komponente. Mit anhaltendem Konsum kommt es zu einer deutlichen Vernachlässigung der Interessen, das Leben dreht sich nur noch um Beschaffung und Konsum der Substanz. Für andere Interessen und Tätigkeiten bleibt oft keine Zeit und auch nicht die notwendige Stabilität, um diesen regelmäßig nachzugehen. Damit einhergehend folgt häufig der Wechsel der sozialen Beziehungen, weg von den „gesunden“, unterstützenden Beziehungen, hin zu Kontakten aus der Drogenszene.
Es sind jedoch nicht alle Abhängigen und alle Verläufe gleich, nicht alle Betroffenen erleben Auswirkungen auf allen drei Ebenen. Um zu einer Diagnose der Erkrankung zu kommen, braucht es ein System, das diese Bündel an Auswirkungen zusammenfasst und die unterschiedlichen Effekte der Substanzen auf die Konsument*innen individuell berücksichtigt. Dies erfolgt für den europäischen Raum in der „Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme“ (International Classification of Diseases – ICD-11), einem von der WHO herausgegebenen Standardwerk zur Diagnose physischer und psychischer Erkrankungen. In der ICD-11 sind alle Erkrankungen mit Diagnoseschlüsseln aufgelistet, vom einfachen Kopfschmerz über die Blinddarmentzündung bis hin zu psychischen Erkrankungen.
Es werden sechs Kriterien, die bei einer Abhängigkeit auftreten können, definiert. Diagnostiziert wird die Erkrankung, wenn über die letzten zwölf Monate drei oder mehr der folgenden Symptome aufgetreten sind:
–ein starker Wunsch oder eine Art Zwang, das Suchtmittel zu konsumieren;
–verminderte Kontrollfähigkeit bezüglich des Beginns, der Beendigung und der Menge des Konsums des Suchtmittels;
–körperliches Entzugssyndrom bei Beendigung oder Reduktion des Konsums;
–Nachweis einer Toleranz: Um die ursprünglich durch niedrigere Mengen des Suchtmittels erreichten Wirkungen hervorzurufen, sind zunehmend höhere Dosen erforderlich;
–fortschreitende Vernachlässigung anderer Interessen und Vergnügen zugunsten des Suchtmittelkonsums und/oder erhöhter Zeitaufwand, um die Substanz zu beschaffen, zu konsumieren oder sich von den Folgen zu erholen;
–anhaltender Substanzgebrauch trotz des Nachweises eindeutiger schädlicher Folgen (körperlicher, psychischer oder sozialer Art).
Sind weniger als drei dieser Symptome, aber schon Schädigungen durch den Substanzkonsum feststellbar, spricht die WHO von einem schädlichen Gebrauch. Diese Definition beinhaltet lediglich substanzgebundene Süchte, also die Abhängigkeit von psychoaktiven Substanzen wie Alkohol, Nikotin, Opiaten, Kokain etc. Während in der Vorgängerversion, der ICD-10, noch nicht substanzgebundene Süchte, wie das pathologische Spielen oder Verhaltenssüchte, in anderen Kategorien subsummiert wurden, gibt es in der neuen Ausgabe, der ICD-11, nun auch eine eigene Kategorie für die sogenannte Gaming Disorder, die Computerspielsucht, die damit den offiziellen Status als behandlungsbedürftige Erkrankung erhält.
Auch wenn die Anwendung dieser Klassifikationssysteme in Fachkreisen nicht nur kritiklos gesehen wird, macht die Einordnung der Abhängigkeit als Erkrankung eines deutlich: Abhängigkeit ist keine Willensschwäche, sondern eine ernstzunehmende psychische Erkrankung, die mit Folgeerscheinungen auf verschiedenen Ebenen einhergeht. Die Verläufe sind zumeist langwierig und der Ausstieg aus der Abhängigkeit ist nicht nur eine Frage des Wollens, sondern benötigt häufig professionelle Unterstützung und Hilfeleistung.