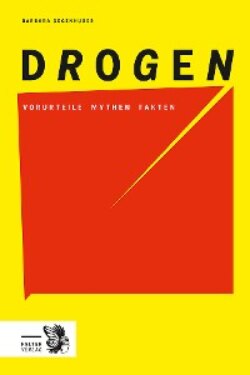Читать книгу Drogen - Barbara Gegenhuber - Страница 9
DIE RECHTLICHE SITUATION IN ÖSTERREICH
ОглавлениеDie österreichische Drogengesetzgebung differenziert zwischen Konsument*innen und Drogenhändler*innen und bietet ein breites Spektrum an unterstützenden und therapeutischen Maßnahmen für Abhängige. Die wesentlichsten gesetzlichen Regelungen finden sich im österreichischen Suchtmittelgesetz (SMG), das im Jahr 1998 das Suchtgiftgesetz ablöste und dem Grundsatz „Therapie statt Strafe“ wesentliche Bedeutung eingeräumt hat. Neben dem SMG existiert seit dem Jahr 2012 zusätzlich das Neue-Psychoaktive-Substanzen-Gesetz (NPSG), das den Umgang mit den seit Ende der 2000er-Jahre aufgekommenen, überwiegend synthetischen Drogen regelt. Das NPSG ist in einigen Bereichen liberaler als das SMG, es versucht noch deutlicher die Konsument*innen von den Händler*innen zu unterscheiden und vor allem eine Reduktion auf der Angebotsseite zu erreichen. Das dritte wesentliche Gesetz im Zusammenhang mit Suchtmitteln in Österreich ist die Suchtgiftverordnung, die vorwiegend die ärztliche Verschreibung von Suchtmitteln sowie die Substitutionsbehandlung regelt.
Das Suchtmittelgesetz regelt den Umgang mit Substanzen wie Cannabis, Kokain oder Heroin. Was wenig bekannt zu sein scheint, ist, dass der Konsum von Suchtmitteln in Österreich generell nicht verboten ist, im SMG sind Besitz, Erwerb, Weitergabe, Erzeugung, Handel und ähnlich gelagerte Handlungen untersagt. Die Strafbarkeit des Konsums wird jedoch quasi indirekt über den Besitz geregelt, wer Suchtmittel konsumiert, muss ja schließlich welche haben. Neben den verbotenen Substanzklassen, deren Einordnung auf Basis internationaler Konventionen erfolgt, werden mittels Verordnungen Grenzmengen für verschiedenste Substanzen festgelegt. Dass es sich dabei um die Menge handelt, die man für den „Eigenbedarf“ mit sich führen darf, wie dies häufig angenommen wird, ist ein Irrglaube. Die sogenannte Grenzmenge regelt lediglich jene Menge einer Substanz, bei deren Überschreitung die Strafen strenger werden. Bei Suchtmitteldelikten unterhalb der Grenzmenge spricht man von Vergehenstatbeständen (§ 27 SMG), bei solchen darüber von Verbrechenstatbeständen (§§ 28, 28a SMG). Die Haftstrafen bei Vergehen liegen bei einem beziehungsweise, in schwerwiegenderen Fällen, bei bis zu drei Jahren, die Strafen für Suchtmittelverbrechen können bis zu zwanzig Jahre oder lebenslang betragen. Nur um einen Eindruck von den Mengen zu erhalten: Die aktuell gültige Grenzmenge bei Cannabis beträgt zwanzig Gramm der Reinsubstanz, die von Heroin drei Gramm.
Die wesentlichen Strafbestimmungen im Suchtmittelgesetz sind die §§ 27, 28 und 28a des SMG. Der § 27 SMG regelt die Strafen für den Erwerb, Besitz, Erzeugung, Beförderung, Ein- und Ausfuhr, das Anbieten, Verschaffen oder Überlassen von Suchtmitteln, wobei es Unterscheidungen hinsichtlich des persönlichen Gebrauchs sowie des gewerbsmäßigen Vorgehens gibt. Unter diese Paragrafen fällt der Besitz von Cannabis zum Eigengebrauch genauso wie der Verkauf von Heroin oder anderen Substanzen, jedoch bei § 27 SMG in allen Fällen unterhalb der Grenzmenge. Der Besitz von Cannabis ist nach diesem Gesetz demnach genauso strafbar wie das Herumreichen eines Joints in einer Runde. Im Gesetzesdeutsch handelt es sich bei Letzterem nämlich um Überlassung eines Suchtmittels, die nach § 27 SMG strafbar ist. Die Bestimmungen für den Suchtgifthandel und die Vorbereitungen dazu finden sich in den §§ 28 und 28a SMG und betreffen den Umgang mit Substanzen oberhalb der Grenzmenge.
§ 27, 28, 28a Suchtmittelgesetz (SMG)
§ 27
(1)Wer vorschriftswidrig
1.Suchtgift erwirbt, besitzt, erzeugt, befördert, einführt, ausführt oder einem anderen anbietet, überlässt oder verschafft,
2.Opiummohn, den Kokastrauch oder die Cannabispflanze zum Zweck der Suchtgiftgewinnung anbaut oder
3.psilocin-, psilotin- oder psilocybinhältige Pilze einem anderen anbietet, überlässt, verschafft oder zum Zweck des Suchtgiftmissbrauchs anbaut, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.
(2)Wer jedoch die Straftat ausschließlich zum persönlichen Gebrauch begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.
(2a)Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren ist zu bestrafen, wer vorschriftswidrig in einem öffentlichen Verkehrsmittel, in einer dem öffentlichen Verkehr dienenden Anlage, auf einer öffentlichen Verkehrsfläche, in einem öffentlichen Gebäude oder sonst an einem allgemein zugänglichen Ort öffentlich oder unter Umständen, unter denen sein Verhalten geeignet ist, durch unmittelbare Wahrnehmung berechtigtes Ärgernis zu erregen, Suchtgift einem anderen gegen Entgelt anbietet, überlässt oder verschafft.
(3)Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren ist zu bestrafen, wer eine Straftat nach Abs. 1 Z 1, Z 2 oder Abs. 2a gewerbsmäßig begeht.
(4)Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren ist zu bestrafen, wer
1.durch eine Straftat nach Abs. 1 Z 1 oder 2 einem Minderjährigen den Gebrauch von Suchtgift ermöglicht und selbst volljährig und mehr als zwei Jahre älter als der Minderjährige ist oder
2.eine solche Straftat als Mitglied einer kriminellen Vereinigung begeht.
(5)Wer jedoch an Suchtmittel gewöhnt ist und eine Straftat nach Abs. 3 oder Abs. 4 Z 2 vorwiegend deshalb begeht, um sich für seinen persönlichen Gebrauch Suchtmittel oder Mittel zu deren Erwerb zu verschaffen, ist nur mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen.
Vorbereitung von Suchtgifthandel – § 28
(1)Wer vorschriftswidrig Suchtgift in einer die Grenzmenge (§ 28b) übersteigenden Menge mit dem Vorsatz erwirbt, besitzt oder befördert, dass es in Verkehr gesetzt werde, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. Ebenso ist zu bestrafen, wer die in § 27 Abs. 1 Z 2 genannten Pflanzen zum Zweck der Gewinnung einer solchen Menge Suchtgift mit dem Vorsatz anbaut, dass dieses in Verkehr gesetzt werde.
(2)Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren ist zu bestrafen, wer die Straftat nach Abs. 1 in Bezug auf Suchtgift in einer das Fünfzehnfache der Grenzmenge (§ 28b) übersteigenden Menge (großen Menge) begeht.
(3)Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren ist zu bestrafen, wer die Straftat nach Abs. 1 als Mitglied einer kriminellen Vereinigung begeht.
(4)Unter den in § 27 Abs. 5 genannten Voraussetzungen ist der Täter jedoch im Fall des Abs. 1 nur mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr, im Fall des Abs. 2 nur mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren und im Fall des Abs. 3 nur mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren zu bestrafen.
Suchtgifthandel § 28a
(1)Wer vorschriftswidrig Suchtgift in einer die Grenzmenge (§ 28b) übersteigenden Menge erzeugt, einführt, ausführt oder einem anderen anbietet, überlässt oder verschafft, ist mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren zu bestrafen.
(2)Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren ist zu bestrafen, wer die Straftat nach Abs. 1
1.gewerbsmäßig begeht und schon einmal wegen einer Straftat nach Abs. 1 verurteilt worden ist,
2.als Mitglied einer kriminellen Vereinigung begeht oder
3.in Bezug auf Suchtgift in einer das Fünfzehnfache der Grenzmenge übersteigenden Menge (großen Menge) begeht.
(3)Unter den in § 27 Abs. 5 genannten Voraussetzungen ist der Täter jedoch im Fall des Abs. 1 nur mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren, im Fall des Abs. 2 nur mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren zu bestrafen.
(4)Mit Freiheitsstrafe von einem bis zu fünfzehn Jahren ist zu bestrafen, wer die Straftat nach Abs. 1
1.als Mitglied einer kriminellen Vereinigung begeht und schon einmal wegen einer Straftat nach Abs. 1 verurteilt worden ist,
2.als Mitglied einer Verbindung einer größeren Zahl von Menschen zur Begehung solcher Straftaten begeht oder
3.in Bezug auf Suchtgift in einer das Fünfundzwanzigfache der Grenzmenge übersteigenden Menge begeht.
(5)Mit Freiheitsstrafe von zehn bis zu zwanzig Jahren oder mit lebenslanger Freiheitsstrafe ist zu bestrafen, wer eine Straftat nach Abs. 1 begeht und in einer Verbindung einer größeren Zahl von Menschen zur Begehung solcher Straftaten führend tätig ist.
Doch was bedeutet das nun in der Praxis? Was geschieht, wenn man in Österreich mit einer geringen Menge Cannabis, Heroin oder Kokain erwischt wird? Schließlich stehen auch zum persönlichen Gebrauch im Gesetzestext bis zu sechs Monate Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen. Werden nun alle, die einmal mit einem Cannabis-Joint erwischt werden, eingesperrt? Nein, denn eine Verurteilung nach dem SMG bedeutet nicht gleichermaßen eine Inhaftierung. Im Jahr 2016 gab es beispielsweise 7351 Verurteilungen nach dem SMG in Österreich, davon 2219 wegen Handels und Vorbereitungen zum Suchtgifthandel und 5095 wegen unerlaubten Umgangs mit Suchtgiften [129]. Diese Kapazität an Haftplätzen gäbe es in Österreich überhaupt nicht und es würde auch nicht viel Sinn machen, alle diese Personen einzusperren. Vor allem bei Delikten im Zusammenhang mit geringen Mengen zum persönlichen Gebrauch kommen zumeist andere Maßnahmen zur Anwendung. Das Prinzip „Therapie statt Strafe“ ist ein fester Bestandteil des österreichischen Suchtmittelrechts.
Für Cannabis gibt es seit dem Jahr 2016 eine eigene Regelung im Suchtmittelgesetz, die zur Entkriminalisierung der Substanz beigetragen hat. Prinzipiell gilt Cannabis in Österreich als illegales Suchtmittel, dessen Erwerb, Besitz und Weitergabe genauso verboten ist wie im Fall von von Heroin oder Kokain. Eine definierte festgesetzte Menge zum Eigengebrauch, welche man besitzen darf, gibt es nicht. Wenn man jedoch mit einer geringen Menge Cannabis (maximal zwanzig Gramm Reinsubstanz THC) für den persönlichen Gebrauch erwischt wird, bekommt man zwar nach wie vor eine Anzeige, es kommt jedoch zu keinem Verfahren bei der Staatsanwaltschaft, sondern einer Meldung bei der Gesundheitsbehörde. Ist dies die erste innerhalb von fünf Jahren, gibt es seitens der Strafverfolgungsbehörden neben einem Eintrag ins Suchtmittelregister keine weiteren straf- oder suchtmittelrechtlichen Konsequenzen. Eine eher milde Reaktion im Vergleich zu den angedrohten Konsequenzen [10]. Bei Wiederholung kann es zu einer Anordnung von Therapie beziehungsweise auch zu Geld- und Haftstrafen kommen.
Eine wesentliche Zielrichtung des SMG ist damit die Differenzierung zwischen Konsument*innen und Händler*innen. Abhängige Personen sollen in geeignete Unterstützungssysteme vermittelt, Händler*innen durch Strafen abgeschreckt werden. Das SMG berücksichtigt die Tatsache, dass bei Drogenabhängigen neben medizinischen, häufig psychische und soziale Probleme im Vordergrund stehen. Unter dem zusammenfassenden Begriff der „gesundheitsbezogenen Maßnahmen“ steht drogenabhängigen Straftäter*innen ein differenzierteres Behandlungsspektrum als Alternative zur Strafverfolgung zur Verfügung. Neben der schon im alten, bis zum Jahr 1998 gültigen Suchgiftgesetz (SGG) verankerten Möglichkeit der ärztlichen Überwachung und Behandlung des Gesundheitszustandes, zählen nunmehr klinisch-psychologische Behandlung, Psychotherapie und psychosoziale Betreuung zu den gesundheitsbezogenen Maßnahmen.
Grundsätzlich sieht das österreichische Rechtssystem eine Art „Stufenleiter“ vor, mit der Drogenkonsument*innen motiviert, genötigt oder gezwungen werden sollen, behandelnde oder betreuende Angebote anzunehmen. Am unteren Ende steht dabei die Intervention der Gesundheitsbehörde, also der regionalen Administration, bei der festgeschrieben wird, dass jeder, der als süchtig und behandlungsbedürftig definiert ist, verpflichtet ist, sich einer Behandlung zu unterziehen. Wenn die Betroffenen den Behandlungsmaßnahmen nachkommen, gibt es keine strafrechtlichen Sanktionen. In der Praxis bedeutet das, dass unter bestimmten Bedingungen kein Gerichtsverfahren eingeleitet (§ 35 SMG) oder ein bereits laufendes Verfahren eingestellt wird (§ 37 SMG). Voraussetzungen hierfür sind der Eigengebrauch, das Unterschreiten der Grenzmenge und eine Begutachtung der Gesundheitsbehörde, bei der festgestellt wird, ob eine gesundheitsbezogene Maßnahme notwendig ist oder nicht. Wird diese als notwendig erachtet und erklärt sich die betroffene Person bereit, die Unterstützungsmaßnahmen anzunehmen, erfolgen keine weiteren straf- oder suchtmittelrechtlichen Maßnahmen. Für Cannabiskonsument*innen gibt es zusätzlich die weiter oben beschriebene Sonderregelung. Diese Bestimmungen führen dazu, dass eine Vielzahl von Fällen diversionell erledigt werden kann. Im Jahr 2016 endeten insgesamt 23.809 Fälle mit einem vorläufigen Rücktritt von der Verfolgung nach § 35 SMG und 1857 Fälle, in denen das Verfahren vom Gericht vorläufig eingestellt wurde (§ 37 SMG) [129]. Damit wird eine Vielzahl von Konsument*innen illegalisierter Substanzen eher dem Gesundheitssystem als dem Strafsystem zugeführt, was durchaus eine sehr sinnvolle Vorgangsweise ist.
Treffen die Voraussetzungen für eine vorläufige Anzeigenzurücklegung oder Verfahrenseinstellung jedoch nicht zu, droht eine unbedingte Haftstrafe. Doch auch hier greift wieder das Prinzip „Therapie statt Strafe“, bei dem die Strafe unter bestimmten Bedingungen bis zu zwei Jahre aufgeschoben werden kann, um dem Verurteilten die Gelegenheit zu geben, sich einer Behandlung der Drogenabhängigkeit zu unterziehen. Wurde diese Behandlung erfolgreich absolviert, wird die unbedingte in eine bedingte Freiheitsstrafe umgewandelt, die Strafe muss unter der Verhängung einer Probezeit nicht im Gefängnis verbüßt werden. Dieser Strafaufschub nach § 39 SMG steht verurteilten Drogenabhängigen bei Strafen, die einen bestimmten Rahmen nicht überschreiten, zur Verfügung, wenn der Betroffene von Suchtmitteln abhängig ist. Darüber hinaus muss sich die Person einverstanden erklären, sich einer notwendigen gesundheitsbezogenen Maßnahme zu unterziehen. Es handelt sich also nicht um eine Zwangsbehandlung, sondern um eine Möglichkeit, die die Betroffenen in Anspruch nehmen können oder auch nicht, wenngleich die Alternative Gefängnis nicht sonderlich attraktiv ist. Demzufolge spricht man in diesem Zusammenhang auch von einer „Quasi-Zwangsbehandlung“, da trotz des Zwangscharakters noch immer eine Wahlfreiheit für die Betroffenen besteht.
Damit gibt es für süchtige und behandlungsbedürftige Täter gewissermaßen eine „rechtliche Privilegierung“ im Sinn von Therapie statt Strafe, die unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit bekommen, anstelle einer Haftstrafe einer Behandlung ihrer Abhängigkeit nachzugehen. Dies stellt selbstverständlich die nachhaltigere Methode im Umgang mit kriminell gewordenen Drogenabhängigen dar, als sie lediglich für einen bestimmten Zeitraum wegzusperren.
Neben dieser Quasi-Zwangsbehandlung gibt es aber noch eine weitere Stufe auf der Leiter der rechtlichen Möglichkeiten, Süchtige in Behandlung zu bringen, nämlich die Einweisung in die vorbeugende Maßnahme nach § 22 StGB. Bei dieser ist eine vom Gericht angeordnete Zwangsbehandlung vorgesehen, die über die Strafzeit hinausgehen kann. In Österreich werden die Behandlungen nach § 22 StGB in der Justizanstalt Favoriten und in Abteilungen anderer Justizanstalten angeboten, dies betrifft aber nur einen verschwindend kleinen Teil der inhaftierten Süchtigen.
Obwohl die Möglichkeiten, straffällig gewordene Abhängige in Behandlung zu bringen, damit im österreichischen SMG ganz gut geregelt sind, gibt es dennoch bei der Umsetzung Probleme. Dies hat auch damit zu tun, dass der Begriff „Therapie statt Strafe“ etwas irreführend ist. Der Gesetzgeber hat bewusst einen sehr offenen Ansatz gewählt und spricht in § 11 SMG von gesundheitsbezogenen Maßnahmen, womit die Behandlung nicht nur auf psychotherapeutische Maßnahmen beschränkt ist, sondern auch medizinische, psychologische sowie psychosoziale Interventionen vorgesehen sind. Die Anwendung methodenvielfältiger Angebote ist nicht nur im Umgang mit straffällig gewordenen Abhängigen mittlerweile State of the Art in der Suchtbehandlung. Diesem Umstand wird jedoch häufig bei der Begutachtung zu einem § 39 SMG zu wenig Beachtung geschenkt. Die vor allem bei einigen psychotherapeutischen Gutachter*innen gängige Methode, lediglich auf die Anwendbarkeit psychotherapeutischer Maßnahmen abzustellen, ist nicht im Sinne des Gesetzgebers und führt dazu, dass eine Reihe von Personen von den Behandlungsmaßnahmen ausgeschlossen ist. Dass nämlich beispielsweise jemandem, der der deutschen Sprache nicht mächtig ist, von vornherein eine Therapie versagt bleibt, macht wenig Sinn, denn um regelmäßig ärztlich verordnete Medikamente einzunehmen, benötigt man noch keine Deutschkenntnisse. Auch Personen, die schon mehrere Therapieversuche hinter sich haben, wird die Therapiefähigkeit häufig aufgrund einer von Gutachter*innen attestierten Aussichtslosigkeit abgesprochen. Wenn man jedoch in Betracht zieht, dass es gerade bei einer chronischen Erkrankung wie der Sucht häufig mehrere Therapieanläufe benötigt, damit diese in einer langfristigen Stabilisierung resultieren, sind derartige Entscheidungen kontraproduktiv. Diese Fehleinschätzungen führen zu einer manchmal recht restriktiven Handhabung des § 39 SMG, was zur Folge hat, dass oftmals die Kränkesten und am schwersten Betroffenen dort bleiben, wo sicher am wenigsten Besserung zu erwarten ist – im Strafvollzug.
Neben diesen Bestimmungen, die straffällig gewordene Abhängige betreffen, gibt es noch eine weitere Ebene, die vorwiegend den sekundärpräventiven Aspekten dienen soll, also jenen Personen Angebote macht, die bereits in Kontakt mit illegalisierten Substanzen gekommen sind. Spezielle Regelungen gibt es in Schulen und beim Bundesheer, die mit einer Art internem Krisenmanagementsystem sicherstellen, dass erstauffällige Konsument*innen möglichst rasch dem Gesundheitssystem zugeführt werden, ohne die Justiz einzuschalten. Fällt in diesen Institutionen jemand bezüglich Drogenmissbrauchs auf, wird der schul- beziehungsweise heeresinterne ärztliche sowie psychologische Dienst verständigt, der abklärt, ob weitere gesundheitsbezogene Maßnahmen notwendig sind. Damit ist sichergestellt, dass erstauffällige Betroffene möglichst rasch und diskret Hilfestellung erhalten.
Die Regelungen bezüglich des Konsums illegalisierter Drogen in Schulen ist in Österreich in § 13 des Suchtmittelgesetzes geregelt, dort heißt es in Absatz 1:
„Ist auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen, daß ein Schüler Suchtgift mißbraucht, so hat ihn der Leiter der Schule einer schulärztlichen Untersuchung zuzuführen. Der schulpsychologische Dienst ist erforderlichenfalls beizuziehen. Ergibt die Untersuchung, daß eine gesundheitsbezogene Maßnahme gemäß § 11 Abs. 2 notwendig ist und ist diese nicht sichergestellt, oder wird vom Schüler, den Eltern oder anderen Erziehungsberechtigten die schulärztliche Untersuchung oder die Konsultierung des schulpsychologischen Dienstes verweigert, so hat der Leiter der Schule anstelle einer Strafanzeige davon die Bezirksverwaltungsbehörde als Gesundheitsbehörde zu verständigen. Schulen im Sinne dieser Bestimmungen sind die öffentlichen und privaten Schulen gemäß Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, die öffentlichen land- und forstwirtschaftlichen Schulen sowie alle anderen Privatschulen.“
Praktisch bedeutet das, dass Lehrer*innen beim Verdacht auf Drogengebrauch einer Schülerin oder eines Schülers zuerst die Direktion zu verständigen haben, die beim begründeten Verdacht auf Suchtmittelmissbrauch wiederum verpflichtet ist, eine schulärztliche beziehungsweise schulpsychologische Untersuchung zu veranlassen und die Eltern zu verständigen. Wenn der oder die Schüler*in die Untersuchung verweigert, muss die Schulleitung die Bezirksverwaltungsbehörde als Gesundheitsbehörde verständigen, es darf aber keine andere Behörde, also auch nicht die Polizei, verständigt werden. Vor dem Hintergrund der Leitlinie „Helfen statt strafen“ ist dies durchaus sinnvoll. Von den involvierten Vertreter*innen des Gesundheitswesens wird nun in weiterer Folge entschieden, ob und welche gesundheitsbezogenen Maßnahmen notwendig sind. Mit dieser Vorgehensweise versucht der Gesetzgeber, einen möglichst unaufgeregten und nicht stigmatisierenden Umgang mit dem Thema Drogen bei Kindern und Jugendlichen an den Schulen zu verfolgen. Ein Ansatz, der weit sinnvoller ist, als mit Strafen, Schulverweisen oder anderen disziplinierenden Maßnahmen ohnehin schon gefährdete Jugendliche auszugrenzen, ihnen Bildungschancen zu nehmen und damit den Weg in den weiteren Drogenmissbrauch zu fördern.