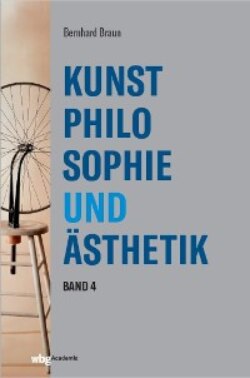Читать книгу Kunstphilosophie und Ästhetik - Bernhard Braun - Страница 31
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.3.2. Positionen der Architektur in der ersten Jahrhunderthälfte
Оглавление2.2.9.
5.3.2.
Die Positionsbezüge der Architektur am Beginn des Jahrhunderts lassen sich besser nachvollziehen, wenn man ganz im Sinn der Losung von van Doesburg, dass Architektur die Umsetzung der Prinzipien der bildenden Kunst sei, die Strömungen der bildenden Kunst nicht aus den Augen verliert. Wie bereits festgestellt, waren die meisten davon mit der Architektur verflochten. Insofern bildet der Expressionismus nicht nur einen kreativen Ausgang für viele Kunstströmungen, sondern auch für Architektur-Positionen. Darauf wird im Kapitel nochmals zurückzukommen sein. Das Attribut expressionistisch dient in der Architekturkritik bis heute als Charakterisierung von Gebäuden, gebauten und nicht-gebauten, von Bruno Tauts Glasvisionen bis zu Werken Hans Scharouns und Jørn Utzons.
609 Chrysler Building; New York
Neben dem Expressionismus – und ihm durchaus ähnlich – bildete das Art Déco mit der Wertschätzung von Ornament und aufwändigem Kunsthandwerk die schon im letzten Abschnitt angesprochene Brücke vom 19. Jh. in die Moderne. Geradezu symbolisch drückt sich das in der beliebten Verbindung der Art Déco-Formen mit dem amerikanischen Hochhaus aus (Chrysler Building, 1930; Empire State Building, 1932), wobei das Hochhaus in Amerika noch lange ein Hort von Neoklassizismus und Historismus blieb.
6.0.f.
Gleiter 2016
Zu den durchgehenden und bis in die Gegenwart reichenden Diskussionsfeldern und Motiven gehört die Spannung von Tradition (Historismus und Jugendstil) und Moderne, die anthropologischen und sozialen Komponenten der Architektur, das Oszillieren zwischen Natur und Maschine und die Faszination an den neuen Materialien, von denen es gerade im 20. Jh. die größte Vielfalt der Geschichte gab. Die Auswahl reichte von Glas und Stahlbeton am Ende des 19. Jh.s bis zu Kunst- und Verbundstoffen sowie zu den faszinierenden Möglichkeiten durch die Digitalisierung an der Schwelle ins 21. Jh. Es ging jedoch nicht bloß um neue Materialien, sondern auch um eine Befreiung der Architektur aus der alten Vorstellung, sie handle stets mit großen Baumassen. »Das führte zur Forderung der Protagonisten der Moderne […] nach Intellektualisierung der Wahrnehmung als Voraussetzung für die Reformulierung des Konzepts von Baukunst.«
VIII.3.2.3.2.
Niemeyer, zit. nach Hess 2006, 30
Dafür eignete sich neben dem Glas der Stahlbeton mit seinen vielfältigen Möglichkeiten. Er ermöglichte die »Zerstörung der Kiste«, also der alten Schachtelform des Hauses, wie Frank Lloyd Wright das ausdrückte: »Ich hatte das Gefühl, dass Stahlbeton nach einer neuen Architektur verlangte, die aus Träumen und Fantasien bestand, aus Kurven und mächtigen, offenen Räumen, aus eindrucksvollen Spannweiten«, sagte Oscar Niemeyer. Man konnte Mauern auflösen, ihnen die Tragelast abnehmen und sie als Schirme ausbilden. Häuser ließen sich in die Natur hinein verlängern, wie es Niemeyer und Wright praktizierten. Hochhäuser fanden ihre Stabilität im Stahlskelett, die Wand konnte man wie einen Vorhang darauf abstimmen. Dieses Konstruktionsprinzip der vorgehängten Fassade wurde manchmal bewusst offen gezeigt wie bei Mies van der Rohes Seagram-Building. Stahlbeton und Glas ließen sich gut kombinieren, insofern Betonwände große Öffnungen zuließen und eine neue Lichtarchitektur ermöglichten, die für Frank Lloyd Wright gleichbedeutend war mit Aufklärung, Humanität und Schönheit.
Sigfried Giedion
Ein erheblicher theoretischer Impuls kam von dem Schweizer Architekturtheoretiker Sigfried Giedion, dem ersten Sekretär des 1928 gegründeten CIAM (bis 1959). Er, der in Wien Maschinenbau und in München bei Wölfflin Kunstgeschichte studiert hatte und der über das Bauhaus und Le Corbusier zur Moderne gekommen war, schrieb 1941 das Buch, das die Theorie der modernen Architektur zusammenfasste und international (allein in den USA mit sechzehn, stets aktualisierten Auflagen) gleichsam als offizielles Handbuch über das Ziel des neuen Bauens fungierte: Space Time and Architecture. The Growth of a New Tradition. Das Buch, für das seine in Harvard gehaltenen Charles Eliot Norton Lectures die Grundlage boten, wird seit seinem Erscheinen kontrovers diskutiert. Die kritisierte Trennung von Stil und Technischem ergab sich daraus, dass der Wölfflin-Schüler primär geistesgeschichtlich und nicht technisch dachte. Er verkörperte den Typus des Kunsthistoriker-Architekten und es ging ihm um den Gleichklang von kulturellen Entwicklungen, egal, ob in der Kunst, der Physik oder der Architektur. »Im Sinne des Hegel’schen Zeitgeistes sah er die Idee, welche die Zeit der Moderne insgesamt charakterisiert, im Rationalismus der Naturwissenschaften.« Sein Buch, das etliche Ideen aus Oswald Spenglers Untergang des Abendlandes verarbeitete, fasziniert durch die Vergleiche, die er quer durch die Kunst- und Architekturgeschichte anstellte, sei es zwischen Borromini und Tatlin oder allgemeiner zwischen der abstrakten Malerei eines Mondrian und der Architektur von van Doesburg oder Gropius. Seine Einteilung der Architekturgeschichte macht seinen spezifischen Blick auf die Einbettung in die Kulturgeschichte deutlich: (1) Architektur als Plastik (Ägypten bis Griechenland), (2) Architektur als Innenraum (Rom bis Barock), (3) Architektur als Plastik und Innenraum (20. Jh.).
Paul Jürgen in ATh, 754
Der Blick auf die Architektur in kulturhistorischen Kontexten bedeutete, dass er hohe Ansprüche an sie hatte. Das neue Bauen, das auf Licht, Luft und Öffnung der Räume (Befreites Wohnen; 1929) setzte, war eigentlich Anthropologie, nämlich die Vision der Verbesserung des Menschen durch das Bauwerk. Es ist kaum verwunderlich, dass Giedion mit solch hochgeschraubten Ansprüchen bis heute polarisiert. Einerseits pries man ihn als Kämpfer für den Internationalen Stil, andererseits warf man ihm Subjektivismus, Schwatzhaftigkeit, Einseitigkeit und eine naive Trennung von Stil und Konstruktion vor. Der deutsche Architekturhistoriker Winfried Nerdinger nennt das Buch einen Dilettantismus eines Architektur-Touristen und beklagt einen verengten Blick auf »eine formal-konstruktive oder formal-hygienische Angelegenheit ohne tiefergehende soziale oder gesellschaftliche Bindung.«
Nerdinger 1988
So weit wie Giedion ging denn auch nicht jeder, der sich für humanes Bauen einsetzte, oder der, wie Frank Lloyd Wright Licht, Humanismus und Schönheit theoretisch verschwägerte. Dennoch: humanes Bauen war ein verbreitetes Schlagwort, das auch der in Wien geborene Richard Neutra, der in Amerika eine große Karriere machte, in theoretischen Abhandlungen (Survival through Design; 1954) grundlegte. Auch bei ihm finden sich die üblichen Überlegungen vom Verhältnis von Gebäude und Natur, von innen und außen, von Universalismus und lokalen Materialien. Jedenfalls spannen diese Themen das Koordinatensystem auf, in dem sich die Positionen der Vorkriegsarchitektur verorteten und die im Folgenden in einem kursorischen Überblick – drei von ihnen ausführlicher – vorgestellt werden.
Skandinavien
England, das so wichtige Beiträge im 18. und 19. Jh. geliefert hatte, nahm sich im 20. zurück. An seiner Stelle meldete sich umso hörbarer Skandinavien zu Wort. Eliel Saarinen gründete 1896 zusammen mit Herman Gesellius und Armas Eliel Lindgren in Helsinki das Architekturbüro Gesellius, Lingren & Saarinen (GLS), das anfangs dem Ideal eines Jugendstil-inspirierten, naturnahen Gesamtkunstwerks anhing, später zu einer abstrakt-geometrischen Formensprache fand. Die zugehörigen kunstphilosophischen Debatten rankten sich um Konstruktivismus und Rationalismus. Auch der Sohn Eliels, Eero Saarinen, wurde ein bedeutender Architekt, der seine Wirkung nach der Emigration der Familie 1923 in die USA vor allem dort entfaltete. Eliel Saarinens Theorie des Städtebaus war von Frank Lloyd Wrights Broadacre City beeinflusst, wenngleich nicht in dem Maße utopisch, sondern näher an der Realität. Wie bei Wright ist der Begriff des Organischen zentral und auch er verband mit der Architektur (bescheidene) pädagogische Ambitionen.
Kretschmer 2013, 194f
Der wohl berühmteste Wortführer war der Finne Alvar Aalto. Er hing in seinen Anfängen noch am Neoklassizismus, fand aber über Konstruktivismus, De Stijl und dem Fünf Punkte-Programm von Le Corbusier bald zur Moderne. Theoretische Reflexionen über seine Architektur hat er kaum hinterlassen. Ein für Aalto wichtiges Element war, ähnlich wie bei vielen seiner Kollegen, die Gleichwertigkeit von Tradition und Moderne, wobei ihm in der Metaphorik die Natur näher war als jene der Maschine. Dies propagierte er auch in seiner Architektur, etwa bei Bauwerken auf dem Campus des Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge, wo unverputzter Ziegelstein neben Sichtbeton stand. »Aalto schuf so einen sich deutlich vom Internationalen Stil und seiner Kühle abhebenden Bau, der in Amerika allerdings wenig Nachfolge fand.« Er vertrat »eine Art erweiterten humanen Funktionalismus mit einer modernen, ornamentfreien, abstrakten Formensprache.«
Italien
Kruft 1985, 473; üss.
In Italien probte man die Symbiose von Moderne und Italianità. Die sich 1923 konstituierende Gruppe Il Novecento bemühte sich um eine auf italienischem Patriotismus beruhende Moderne. Dabei griff man auf den italienischen Klassizismus zurück und über einen Mitarbeiter von Adolf Loos, Giuseppe de Finetti, der zudem eine italienische Übersetzung von Ornament und Verbrechen publizierte, fand der Rationalismus Loos’ Eingang in diese Bewegung. Im Jahr 1926 bildeten sich in mehreren italienischen Städten Architekturgruppen, die sich mit dem internationalen Stand auseinandersetzten. Der Gruppo 7 in Mailand trat mit einem größeren Manifest an die Öffentlichkeit. Darin definierten die Autoren, unter ihnen Giuseppe Terragni, der nicht nur Faschist war, sondern auch der wichtigste Vertreter des italienischen Rationalismus, eine rationale Architektur mit einer klaren Bezugnahme auf Le Corbusier. Darüber hinaus ging es sozusagen um eine neue Generalidee einer rationalen Kunst mit den Vorbildern Picasso, Cocteau, Strawinsky, passend zu den jeweiligen künstlerischen Sparten. Auch diese Bewegungen verzichteten nicht auf einen patriotischen Einschlag. Die italienische Architektur sei landschafts- und klimabedingt eigenständig. Das verleihe ihr einen eigenständigen Rang abseits des internationalen Betriebs. »Italien wird für die neue Architektur eine Führungsrolle zugesprochen, die mit der historischen Tradition und dem Aufschwung unter Mussolini begründet wird.« BB Gegenüber dem Futurismus erhielten in diesen Bewegungen Vergangenheit und Tradition ihre Würde zurück.
zit. nach Kruft 1985, 473f
Die Ästhetik dieser Architektur leitete sich von der konstruktiven Notwendigkeit ab: »[…] la vera architettura deve risultare da una stretta aderenza alla logica, alla razionalità. Un rigido costruttivismo deve dettare le regole. Le nuove forme dell’ architettura dovranno ricevere il valore estetico dal solo carattere di necessità […].« (Die wahre Architektur muss sich aus einem strikten Respekt der Logik und Vernunft ableiten. Ein strenger Konstruktivismus muss die Regeln setzen. Die neuen Formen der Architektur müssen ihren ästhetischen Wert einzig aus dem Charakter der Notwendigkeit gewinnen.)
Die Gesetze der Logik bestimmen die Ästhetik, nicht Individualität. Das ermöglicht eine positive Sicht auf Serienproduktion und Typisierung. Ebenso gewürdigt wurden die neuen Materialen, Stahlbeton etwa, der eine neue Monumentalität verbunden mit rationaler Ästhetik (pura grandiosità) ermögliche. Dabei war durchaus klare Harmonie und Symmetrie gemeint, die man nach Meinung der Exponenten in der alten römischen Architektur vorgezeichnet fand und nun im faschistischen Geist (vero spirito fascista) als italienische Architektur neu gebären könne. Der Kunstcharakter der Architektur läge sozusagen in der Vergeistigung der rationalen Vorgaben.
Gegen die rationale Architektur gab es zeitgenössische Kritik, die ähnlich wie die spätere postmoderne Kritik vor allem ökologische Aspekte ins Treffen führte. Die großen Fensterflächen und die Flachdächer böten keinen Schutz vor Hitze und Kälte und die Gebäude seien ohne Rücksicht auf die Umgebung als geometrische Monolithen in die Landschaft gesetzt – so mokierte sich der Architekt Marcello Piacentini, der zuletzt einem Neoklassizismus huldigte und etliche Aufträge für Mussolini ausführte, in der Besprechung einer einschlägigen Ausstellung. Das antike Rom musste auch als Hintergrund herhalten für eine Synthese der Theorien des Rationalismus und des Faschismus.
1930 bildete sich der Movimento Italiano per l’Architettura Razionale, dessen Mitglieder auch an den CIAM-Kongressen teilnahmen. Die Bewegung organisierte Ausstellungen, etwa eine 1931, die an verschiedenen Orten gezeigt wurde und wo es um die Synthese von Rationalismus und Faschismus ging. Mussolini persönlich wurde durch die Ausstellung geführt.
Immerhin löste die Schau eine breite, teilweise polemisch geführte Debatte um die Grundlagen der modernen Architektur und um die Rolle des Faschismus aus. Standen bei der Architektur die Fragen nach Form und Material im Vordergrund, ging es beim Faschismus um die für viele falsche Gleichsetzung von politischer Ideologie und der römischen Vergangenheit, die in Mussolinis Bewegung als imperialer Baustil aufgenommen wurde.
Frankreich
Die Architekturszene in Frankreich war – aus der philosophischen Tradition nicht weiter verwunderlich – rationalistisch geprägt. Der aus Lyon stammende Tony Garnier war einer der ersten im 20. Jh., der die alte Ambition aufgriff und einen Gesamtentwurf der Stadt bis hin zur Gestaltung der einzelnen Gebäude vorlegte (Une Cité industrielle. Étude pour la construction de villes; 1917). Das natürliche Wachstum der Stadt tat er kurzerhand als anarchisch ab und suchte nach einem Musterentwurf einer Industriestadt des 20. Jh.s. Die Parameter der Stadt ergaben sich für ihn aus den Vorgaben der Industrie: Verfügbarkeit von Bodenschätzen und Energie, Lage an Transportwegen, Rücksichtnahmen auf Wind und Sonneneinstrahlung.
Kruft 1985, 454
Garnier war geprägt vom Rationalismus Julien Guadets, den er an der Ecole des Beaux-Arts als Lehrer hatte, und von der Sozialutopie von Charles Fourier. Er baute mit der Vision eines starken Staates auf einen sozialen Fortschritt, der in eine bessere Zukunft führen sollte. »Die Konsequenz dieses Ansatzes ist es, daß bestimmte Bautypen in seiner Planung fehlen, die eine moralisch bessere Gesellschaft in seinen Augen nicht mehr nötig hat, z.B. Kirchen, Gefängnisse, Gerichtshöfe, Polizeistationen.« Auch er projizierte seine Ideen für die Stadt auf die antike Stadt, wie er sie bei einem Aufenthalt als Stipendiat der Akademie in Rom studieren konnte.
Das Echo auf Garniers Idealentwurf hielt sich in Grenzen, aber die Ideen nahm unter anderem Le Corbusier auf und sie flossen in die Charta zum modernen Städtebau des CIAM ein. Die Hauptthesen dieses Baukonzepts war die Trennung von Lebens- und Arbeitsbereichen, der Vorrang des Verkehrs, worunter damals der Individualverkehr gemeint war, und schließlich eine Art »Melioration« der Städte durch Abriss alter Bausubstanz (was sich in den meisten Fällen in Europa durch die Kriegszerstörungen erübrigte) zugunsten der erwähnten neuen Lösungen. Das führte allerdings bald, vor allem in der jüngeren Generation, zu erheblichen Widerständen und einer Neuausrichtung des Städtebaus in den Sechzigerjahren.