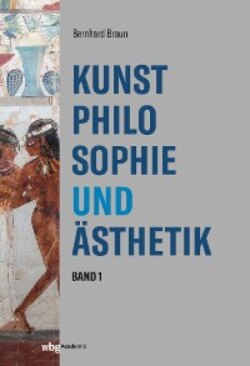Читать книгу Kunstphilosophie und Ästhetik - Bernhard Braun - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.3. Der Kultort Höhle
ОглавлениеDas Phänomen der Höhle ist ein Spezialfall des europäischen Paläolithikums. Außerhalb dieses Bereichs gibt es – von wenigen Ausnahmen abgesehen – nur Felskunst im Freien und im Tageslichtbereich. Die Entdeckung der eiszeitlichen Höhlenkunst brachte einen neuen Schub in die Überlegungen zum Weltbild der frühen Menschen. Es herrscht in der wissenschaftlichen Diskussion ein weit reichender Konsens in der Annahme, dass die Höhle im Zusammenhang mit Kulten zu verstehen ist. Diese Deutung der Höhle als Kultort begann bereits kurz nach den Entdeckungen am Beginn des 20. Jh.s. Einer der Gründe für diese Zuschreibung, der unvermittelt in das Auge sticht, ist (abgesehen von den divergierenden Lesearten der künstlerischen Darstellungen) die schwierige Zugänglichkeit. »Manche Höhlen sind so unzugänglich, so unwegsam, daß nur ein tieferer, im Geistigen wurzelnder Grund Menschen an diese unwirtlichen Stellen gebracht haben kann: der Gedanke an Schmückung ist zu absurd für den, der die Höhlen kennt, als daß er auch nur diskutiert werden könnte.« Vielleicht entstand hier das reale Urbild einer sakralen Höhle, das in metaphorisch-literarischer Form eine große Karriere in der Kulturgeschichte machte und uns von den frühen Hochkulturen über die Mysterienkulte bis in die zahlreichen philosophischen Erzählungen begleitet.
Kühn 1929, 465
3.4.
Jedenfalls war der Impuls, die Abbildungen der Höhle zum Ausgangspunkt der Deutungsversuche zu nehmen, wie er von Max Raphael ausging und von Annette Laming-Emperaire und Andrè Leroi-Gourhan strukturalistisch weiterentwickelt wurde, ein wesentlicher Antrieb für neue Zugänge zum Thema.
Clottes/Lewis-Williams 1996, 57
Angesichts solcher Deutungen darf nicht übersehen werden, dass die Höhle ursprünglich auch als Wohnplatz diente, wie Untersuchungen von Kulturschichten belegen. Wohnsituationen wurden aber nicht immer und wenn, dann nur in den vorderen Bereichen gefunden. Die schwer zugänglichen hinteren Bereiche, aber auch Höhlen, die von größeren Lagerplätzen oft weit entfernt lagen, scheinen vorwiegend oder ausschließlich kultische Funktion gehabt zu haben. Wegen der schwierigen Erreichbarkeit wurden diese Höhlenteile vermutlich selten besucht. Das bedeutet, dass die reichen Malereien vermutlich nicht für menschliche Betrachter geschaffen wurden, sondern entweder für höhere Wesen oder aber der Akt des Kunstschaffens war selbst bereits Teil eines Rituals. »Manchmal drängt sich die Vermutung auf, daß diese Figuren gar nicht von zahlreichen Menschen gesehen werden sollten. Offenkundig war der Schöpfungsakt wichtiger als die Wirkung […].« Erhalten gebliebene Fußspuren und Handabdrücke – jene der Höhle von El Castillo mit einem Alter von 26.000 Jahren sind die ältesten – weisen auf Kinder und jugendliche Besucher hin, sodass der Schluss auf einen Initiationsritus (mit Vorbereitungs- und Hauptritus), auf ein rituelles Beschreiten des Heiligtums, näher liegt als jener auf einen von Massen (z.B. von magisch handelnden Jägern) besuchten Wallfahrtsort.
Burkert 1972, 29
Wenngleich die Übertragung von Ergebnissen ethnologischer Forschungen an rezenten »Primitivkulturen« auf jene des Paläolithikums problematisch ist, könnte man vermuten, dass die Rolle eines Rituals auch für so frühe Kulturen wichtig war. Dies impliziert ritualisierte Tänze, Begehungen, das »Um-Einverständnis-Bitten« des Jägers beim zu jagenden Tier – nach Walter Burkert Folge einer mystischen Solidarität von Jäger und Opfer –, welches Ritual sich bis ins 20. Jh. bei Bauern und Holzfällern fand, bis hin zu Ritualen um jene Körperteile, die mutmaßlich als Sitz der Seele angesehen wurden, wie die Schädelrituale.
Wie genau die Botschaft der Fels- und Höhlenbilder zu verstehen ist, dazu gibt es mehrere Zugänge. Eine der beliebtesten Erklärungen war die von Henri Breuil favorisierte These einer dargestellten Jagdmagie, die metaphysische Vorstellungen beinhaltete. Sie war lange Zeit der präferierte Zugang zur Eiszeitkunst, während man für das Neolithikum den Animismus als beliebtes Erklärungsmuster wählte. Kühn verwandte den Ausdruck Magie allerdings als eine Sammelbezeichnung für jede geistig-spirituelle Deutung, wenn er resümierte: »So ergibt sich abschließend das Bild einer magischen Welt, in die die Kunst der Eiszeit eingebettet ruht.«
Jagdmagie
Kühn 1954, 69f; Kühn 1929, 503
Kühn 1929, 503
van Scheltema 1950, 35f BSG I, 182
In einem so weiten Sinn genommen bedeutet Magie nichts anderes als eine religiös-spirituelle Komponente ganz allgemein. Das ist wenig strittig, während die Magie-Theorie im engeren Sinn, also etwa die Idee der Jagdmagie, seit längerer Zeit an Boden verliert. Der Jagdzauber gilt daher nicht mehr als »vorwiegende Verständnismöglichkeit«. Allenfalls als Teiltheorie können sich solche Ansätze behaupten.
Grundsätzlich gingen die Magie-Theorien nicht nur – in exakt gegenteiliger Einschätzung von Christy und Lartet – von einem Überlebenskampf der Menschen in einer feindlichen Umwelt aus, sondern basierten auf einem eher primitiven Menschenbild, wie die Gegner der These nicht müde werden, darauf hinzuweisen: Magie als eine – nicht besonders hoch reflektierte – Überlebenshilfe!
kosmologische Theorie
König 1973, 216f
Ein anderer Einwand gegen diese Theorie bezieht sich auf die Fundsituation: So gibt es – gemessen an der Gesamtzahl – eher wenige eindeutig als »verletzt« identifizierbare Tiere. Zudem gibt es auch ganz andere Erklärungen für die Verletzung oder Tötung von Tieren durch Pfeile als jene einer magischen Handlung – wenn auch nicht minder abenteuerliche. Im Kontext ihrer kosmologischen Theorie sah etwa Marie König in den Pfeilen ein Sinnbild von Tod und Regeneration. Wie die Sonne gab auch der Mond »dem Zeitlichen des Menschen Ziel und Grenze. Aber wie er das Gesetz des Sterbens vorlebte, so verhieß er zugleich die Aussicht auf einen neuen Anfang. Tod und Leben waren unlösbar verknüpft, und im Überdenken des kosmischen Geschehens könnte der Mensch Hoffnung auf ein Weiterleben nach dem Tode geschöpft haben.«
Ebd., 217
Marie König versuchte, das Gemeinte am Beispiel des großen Stiers in der Höhle von Lascaux zu demonstrieren: »In den Nüstern steckt der tödliche Pfeil, aber dem Maul des Tieres entströmt der Atem des neuen Lebens. Das Ohr steht senkrecht am Halse. Das Sterben des Stieres ist kein natürlicher Vorgang, dieser Stier ist kein irdisches Wesen, er ist der bildhafte Ausdruck der Weltordnung.«
Neigen Theorien des Jagdzaubers zur intellektuellen Abwertung des eiszeitlichen Menschen, legte Marie König die Latte sehr hoch. Ließen sich ihre Spekulationen erhärten, hätten wir eine kulturelle Erzählung im Spätpaläolithikum vor uns, die spätere Weltbilder und Religionen vorwegnimmt.
Animismus
Gleichsam eine Zwischenlösung böte die Erklärung eines Animismus im weitesten Sinn. Gemeint ist eine vage Vorstellung von Seelenwanderung, von beseelten Tieren, die ihrerseits als Schutzgeister auftreten konnten. Symbole dafür wären Zwischenwesen, die auch in Tierfelle gehüllte Schamanen in rituellen Tänzen mit Tiermasken sein könnten, die wiederum als Medien dienen.
Mag sein, dass der paläolithische Mensch in der Höhle einen Ort der Götter und Geister gesehen hat, so wie nach Vorstellung der Schamanen der himmlische und der unterirdische Ort von »besonderen Geistwesen und Tiergeistern« bewohnt werden. Jean Clottes plädiert in diesem Zusammenhang für eine von Schamanen geleitete Religion im Paläolithikum. Grundlage dafür war ihm, dass er alle Stadien der Trance in den Malereien zu finden glaubte. Die Schamanismustheorie von Jean Clottes und David Lewis-Williams erregte einige Aufmerksamkeit. Die beiden Wissenschaftler erforschten nicht nur rezente Praktiken des Schamanismus, sondern berücksichtigten auch den Stand der neurophysiologischen Forschung zum Thema. Demnach gibt es drei Phasen einer durch Tanz und Rhythmus oder durch Rauschmittel ausgelösten Trance. In einem ersten Schritt erscheinen dem Mysten dynamische abstrakt-geometrische Formen, Zickzackstreifen, Mäander, Gitter und Punkte, geradewegs so wie sie Motive der Felsmalerei sind. In einem zweiten Schritt werden diesen abstrakten Gebilden Bedeutungen zugesprochen. Sie können die Gestalt von Tieren oder Gegenständen annehmen. In einer dritten Phase findet man sich in Trichtern oder Strudeln wieder. Man gewahrt ein Licht am Ende dieser tunnelförmigen Gebilde und erlebt erste echte Halluzinationen mit Ungeheuern und Mensch-Tier-Mischwesen, in die man sich selbst zu verwandeln scheint. Dies wird als Vision gedeutet, als angestrebtes Ziel des Schamanen. Die Spuren solchen Erlebens sind nach den Autoren in der Felsmalerei dargestellt.
Clottes/Lewis-Williams 1996, 29
Schamanismustheorie
Zeichentheorie
Anati 1997
3.2.
In allen diesen Zugängen wird versucht, das Dargestellte inhaltlich zu deuten. Es gibt aber auch einen zeichentheoretischen Vorschlag. Demnach wären die Mythogramme als Zeichen und als Urformen der Mythenproduktion anzusehen. Emmanuel Anati setzt die Felskunst mit dem Ursprung des begrifflichen Denkens im Rahmen der Herausbildung des menschlichen Geistes gleich. Anati argumentiert auf der oben angesprochenen Basis der Voraussetzung von Abstraktionsfähigkeit des damaligen Menschen. Die Symbole gelten ihm als Zeugnis der wachsenden Fähigkeit zur Abstraktion, zur Synthese und Assoziation.
Voraussetzung dafür ist die erstaunliche Einheitlichkeit der paläolithischen Kunst, von der auf die Einheitlichkeit ihrer Schöpfer geschlossen werden darf. Vieles von diesen Theorien mag auf unsicheren Beinen stehen, dennoch bleiben manche Betrachtungen anregend und werden im Folgenden immer wieder beigezogen werden.