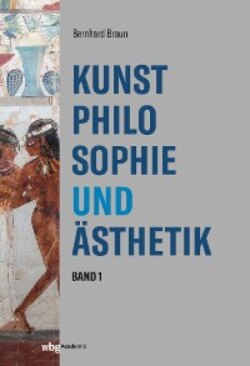Читать книгу Kunstphilosophie und Ästhetik - Bernhard Braun - Страница 30
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4.3. Vom Mythos des Ortes – Der Beginn der Architektur
ОглавлениеMit der Neolithischen Revolution hat sich – wie oben dargelegt – das Verhältnis zwischen Mensch und Natur tiefschürfend verändert. Der sesshaft werdende Ackerbauer stand nicht nur real vor der Aufgabe, sich einen Raum aus der unwirtlichen Natur abzugrenzen, sondern auf diesen nunmehr begrenzten Raum musste er sein gesamtes Vertrauen zur Lebenserhaltung setzen. Es ist ein faszinierender Akt einer historisch erreichten Reife, darauf zu vertrauen, dass der Same, der in die Erde gesetzt wird, Frucht bringt und dass sich dieses Geschehen Jahr für Jahr wiederholt. Hier zeigt sich ein Rhythmus, der das stetige, lineare Vorwärtsschreiten der Zeit durch den Kreis der Wiederkehr des Immergleichen bricht. Es war bereits von der Domestikation von Raum und Zeit die Rede. Nun kann man spekulieren, ob und wie sich das in Formen widerspiegelt. Welche ikonographischen Zeichen auch immer eine solche Erfahrung abbilden, sei es die auf runde Steine geritzte Kreuzform, die Steinschale, die Spirale, bleibt dahingestellt. Es scheint aber nicht völlig abwegig zu sein, anzunehmen, dass dieses Bewusstwerden der Spannung von Linearität, Offenheit und Geschlossenheit in der Zeit räumlich umgesetzt wurde. Denn es hatte eine bewusste Auseinandersetzung mit dem Raum gegeben, der für die Siedlung ausgesucht und markiert wurde. Darin kann man den Beginn der Architektur sehen. Gemeint ist nicht nur das Errichten von Hütten, sondern das gesamte Gründungsritual des Ortes des Hausens. Der Mensch lagert die kosmischen Zusammenhänge gleichsam in ein Stein gewordenes Manifest der Erinnerung aus. Christian Norberg-Schulz sprach von einem »existentiellen Raum« und meinte damit die »Grundbeziehung zwischen dem Menschen und seiner Umwelt«, was auch und vor allem den psychischen Funktionen Orientierung und Identifikation entspricht. Denkt man sich das so, kann man Architektur (griech. arche und tekton/das von Anfängen und Ursprüngen geleitete Machen und Ausführen) in eine primäre Funktion, rein auf den Zweck geschützten Hausens, und eine sekundäre Funktion, eben die angesprochene Reflexion über Raum und Körper, einteilen. Dies verwandelte sich in Funktion und Form (welche die Geschichte des Gebäudes abbildet), die beiden Leitgedanken der Architektur.
Norberg-Schulz 1982, 5
4.3.2.
Zweckorientierte Bauaufgaben traten vermutlich von Anfang an neben die von kosmischer Orientierungssetzung überhöhte zeichenhafte Auseinandersetzung mit dem Raum. Erstgenanntes führte letztlich zur Agglomeration von Siedlungen und Städten, Zweitgenanntes zu faszinierenden Gestaltungen, wo Bildhauerkunst und Architektur miteinander verschwimmen. Auch eine scheinbar noch so sakral anmutende und zweckfreie Motivation für Architektur darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich darin eine technisch-wissenschaftliche Zurichtung von Raum und Zeit auf den Menschen hin verbirgt.
Semper, zit. nach Müller/Vogel 1974, 15
VIII.3.2.1.2./VIII.3.2.2.1.
Le Corbusier, zit. nach Ebd., 21
IX.2.3.5.
X.2.6.1.
Gottfried Semper nannte die Architektur eine »reine Kunst der Erfindung, denn für ihre Formen gibt es keine fertigen Prototypen in der Natur, sie sind Schöpfungen der menschlichen Phantasie und Vernunft«. Diese Sicht der Architektur, die dem Geist- und Fortschrittsglauben des 19. Jh.s entsprang und der Artifizialität des Klassizismus geschuldet war, ist wenig überzeugend. Überzeugender ist heute das, was sich aus langer Geschichte herleitet, nämlich dass der Mensch die Formen der Architektur aus der Natur generierte und sie dann auf seine Zwecke zurichtete. Le Corbusier war der Sache doch deutlich näher gekommen: »Architektur ist das kunstreiche, genaue und wundervolle Spiel der Körper, die unter dem Licht vereinigt werden. Unsere Augen sind dazu da, um die Formen im Licht zu sehen; Dunkel und Hell wecken die Formen; die Kuben, die Kegel, die Kugeln, die Zylinder oder die Pyramiden – dies sind die großen primären Formen, welche das Licht erstehen läßt. Ihre Erscheinung ist für uns rein und faßbar ohne Zweideutigkeit. Deswegen sind es schöne Formen, die schönsten Formen. Jedermann ist sich darüber einig, das Kind, der Wilde, der Metaphysiker.« Die Frage nach der Architektur als Kunst ist demnach berechtigt und sie wird unter systematischen Gesichtspunkten nochmals zu stellen sein.
Gropius, zit. nach Ebd.
Ganz analog zur Philosophie hat das künstlerische Gestalten seine Urformen aus dem natürlich Vorgegebenen gewonnen und in einem Vorgang der Abstraktion und begrifflichen Symbolisierung weiter getrieben. In der Architektur im Besonderen umfasst diese Umsetzung auch noch die Bedingungen, die sich durch die Eigenheiten des Materials und die Gesetze der Schwerkraft ergeben. Auch der Baukörper selbst könnte so als den Raum schaffend oder als ihm unterworfen interpretiert werden. Mit Walter Gropius: »Das Hauptausdrucksmittel der Architektur jenseits aller technischen Belange ist der Raum.« Weil Raum immer mit Licht zu tun hat, könnte man diese Feststellung auf das Licht als wichtigstes »Material« der Architektur erweitern. Davon wird noch öfters die Rede sein.