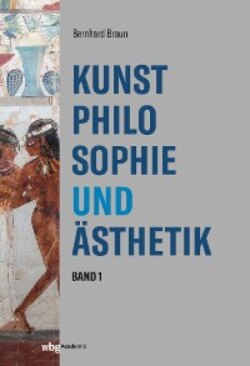Читать книгу Kunstphilosophie und Ästhetik - Bernhard Braun - Страница 35
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5.0. Die Tempelkultur auf dem Maltesischen Archipel
ОглавлениеBei der Tempelkultur des Archipels, der die Inseln Malta mit 247 Quadratkilometern und Gozo mit 67 Quadratkilometern (sowie die reizvolle kleine, kulturgeschichtlich jedoch unbedeutende Insel Comino) umfasst, handelt es sich immerhin um die ältesten Steintempel der Geschichte, wenn man von den Funden in Anatolien absieht, deren Einordnung als Architektur – wie soeben berichtet – alles andere als unbestritten ist. Die maltesische Tempelkultur fand ihren Abschluss, als in der zweiten Dynastie die ägyptischen Herrscher mit den Pyramidenbauten begannen.
Malta war damals noch nicht so erodiert wie heute, sondern weitgehend bewaldet. Kleinere Landverluste durch Abbrüche im Süden und Westen und durch einen Anstieg des Meeresniveaus (Änderung der Küstenlinie vor allem im Norden und Osten) gaben dem Archipel die heutige Form.
Trump 2002, 25
Bereits aus dem Paläolithikum ist Höhlenkunst erhalten (Ghar Hassan), ebenso eine paläolithische Silexproduktion (Clactonian) sowie Pfeilspitzen aus dieser Zeit an verschiedenen Orten. Im Paläolithikum dürfte es eine feste Landverbindung zu Sizilien (aber nicht wie früher vermutet nach Afrika) gegeben haben. Zwischen Malta und Sizilien beträgt die heutige Meerestiefe nicht über 180 Meter, meist weniger.
Trump 2002, 28 Müller-Karpe 1968, 108ff
Die erste feste neolithische Besiedelung lässt sich um 5000 in Ghar Dalam im Süden Maltas nachweisen, wo sich Tonscherben einer Ackerbaukultur fanden, die identisch mit solchen aus Sizilien sind (sich jedoch von nordafrikanischen völlig unterscheiden). Sie gehören zur sogenannten Eindruckkeramik (impressed wares), wo die Verzierungen mit Fingernägeln, Holzstäbchen oder Muscheln eingedrückt wurden. Diese Technik kennt ein weites Verbreitungsgebiet, das von Dalmatien bis Spanien reichte. Von da an wurde die Kultur der vermutlich aus Sizilien eingewanderten Bewohner eigenständig und die weitere Keramik der Skorba-Phase (um 4300) war eine lokale Entwicklung. Aus dieser Zeit stammen weibliche Figurinen, die im unter 3.1. beschriebenen Sinn auf die Verehrung einer Muttergottheit oder zumindest auf einen Fruchtbarkeitskult schließen lassen.
Aus der Zebbug-Phase (um 4000) stammen die ersten aus dem Fels gehauenen Gräber (Mgarr), was neue Bestattungsriten anzeigt. Man begann, die Toten in unterirdischen Gräbern und Katakomben beizusetzen. Manche Forscher schließen von da her und einer deutlichen Veränderung der Keramik auf einen neuen Besiedlungsschub. Das bleibt allerdings spekulativ. Jedenfalls ordnete sich Malta mit diesen Bestattungsformen in den mediterranen Kulturbogen ein mit den mykenischen Schachtgräbern, den ägyptischen Felsgräbern, den Megalithgräbern auf Sardinien. Die Felsgräber waren dauerhaft und ließen sich öffnen, um weitere Mitglieder der Sippe zu bestatten.
Etwa ein halbes Jahrtausend später bauten die Bewohner mit riesigen Steinblöcken den Felsgräbern analoge Anlagen über dem Boden. Die Tempelkultur dauerte nach neuerer Datierung von 3500 (Mgarr, Ggantija auf Gozo) bis 2500 (Tarxien). John Evans hatte noch mit einer 1000 Jahre jüngeren Datierung gearbeitet. Nach dem plötzlichen Zusammenbruch der Tempelkultur um 2500 erfuhr Malta eine rätselhafte Neuausrichtung mit neuen Siedlern am Beginn der Bronzezeit. Die neue Keramik ähnelt jener des helladischen Westgriechenlands und Dalmatiens, aber unstrittige Importe gab es nur aus Sizilien (Castelluccio und Torre d’Ognina bei Syrakus). Die neuen Siedler hinterließen, gemessen an der untergegangenen Kultur, wenig beeindruckende Denkmäler, Dolmen und monolithische Gräber, wie wir sie auch aus der Gegend von Otranto in Apulien kennen. Malta bog erst mit der Ankunft der Phönizier um 1000 in den mediterranen Mainstream ein.
Vorher, von 3500, der Entstehungszeit von Mgarr und Ggantija, an hob sich diese Kultur von der allgemeinen mediterranen neolithischen Kultur (abgesehen von der Grabarchitektur) deutlich ab. Die große Zeit scheint die maltesische Kultur völlig isoliert absolviert zu haben und niemand weiß, weshalb man auf dem kleinen Archipel zwei Dutzend Tempelanlagen errichtete. Dieses Rätsel motivierte viele Forscher, nach Einflüssen Ausschau zu halten, und sie glaubten, solche in einer gewissen formalen Ähnlichkeit der Bauten Maltas mit jenen Ägyptens zu finden. Joachim von Freeden baute darauf seine Theorie von Beziehungen der maltesischen Tempelbauer nach außen auf: »Die Baukunst selbst ist damit […] das wichtigste – Indiz für Beziehungen der Tempelkultur zur Außenwelt.« Das steht freilich auf wackeligen Beinen. Nicht nur ist die behauptete formale Ähnlichkeit kaum restlos überzeugend, es gibt schon Probleme einer eindeutigen Datierung.
von Freeden 1993, 49
Evans 1963, 133
Die spätere strategische Bedeutung der kleinen Inselgruppe an dieser Stelle des Mittelmeeres kann damals noch nicht der Grund für die außergewöhnlichen Tätigkeiten gewesen sein. Diese Leistung in einer Zeit ohne Schrift, Rad und Metall setzt eine hoch entwickelte soziale Organisation und eine enorme religiös-weltanschauliche Motivation voraus. Irritierend ist weiters, dass man aus der Zeit der Tempelbauten bislang keine Siedlungsreste entdecken konnte. Dies könnte mit der dichten Überbauung der jetzigen Städte zu tun haben oder damit, dass die Tempelbauer nur in Zelten und losen Unterkünften gelebt haben und ihre ganze Energie in die Arbeit auf den Großbaustellen gesteckt haben. Auch Kriegs- und Jagdwaffen sind bisher nirgends aufgetaucht. »Nach den Funden erscheinen sie uns als eine ›lotos-essende‹ Bevölkerung, mit sich selber beschäftigt, in bizarren Kulten gefangen und in der Technik zurückgeblieben, auf ihren winzigen Inseln inmitten der weindunklen See, abgeschnitten von dem sie allseitig umgebenden Hauptstrom der Kultur.«
Es standen zwei Steinarten zur Verfügung: der weiche gelb schimmernde (seit römischer Zeit auf Malta als Baumaterial dienende) Globigerinenkalk und der härtere korallinische Kalk, aus dem sich wegen seiner Tendenz zu vertikaler Spaltung große Platten und Blöcke abspalten ließen.
Sieht man heute in den Anlagen von Mgarr und Ggantija den Beginn der Tempelbauten, hat John Evans die eigentlich plausible These vertreten, dass am Anfang kleinere Bauten gestanden haben müssen, bevor man sich die gewaltigen Projekte zutraute. Aber was ist auf diesem Archipel schon plausibel? Die Datierung ist durch das weitgehende Fehlen organischer Materialen schwierig. Man muss häufig entscheiden, ob die Keramik-Lehmschicht aus der gleichen Zeit wie der darüber stehende Tempel stammt. Das ist jedoch alles eher als selbstverständlich.
Ebd., 72ff
Ebd., 85
Nach Evans ist der älteste Bau, der kleinere des Doppeltempels von Mgarr, aufgrund der Keramikschicht Zebbug um 2700a zu datieren. Das wird heute in Frage gestellt, weil man die Zusammengehörigkeit von Bauwerk und Keramikschicht nicht für schlüssig hält. Evans lässt die 1955 entdeckten fünf Felsgräber von Xemxija mit ähnlichen Formen wie Mgarr folgen. Und bei ihm endet die Tempelarchitektur am Höhepunkt um etwa 1800–1600, als Kordin III, Mnaidra, Hal Tarxien und der Doppeltempel von Gigantija entstanden sein sollen. Darauf lässt Evans noch den ganz aus Globigerinenkalk gebauten Tempel Hagar Qim folgen, wo neben dem Hauptgebäude zwei bis drei weitere Bauten in »ungeregeltem Wachstum« entstanden seien. Für Evans ist es das fortgeschrittenste Bauwerk. Die Kammerwände waren mit Lehm verschmiert und mit Kalksteinverputz überzogen und möglicherweise kräftig rot bemalt, die Platten sind sorgfältig bearbeitet. In Hagar Qim scheint eine neue Qualität der Oberflächenbearbeitung Einzug gehalten zu haben. »Die Begeisterung für sauber bearbeitetes Mauerwerk, die sich in Hagar Qim austobt, wurde später durch praktische und auf Beständigkeit gerichtete Erwägungen gedämpft, wenigstens bei den Außenwandungen.« Auch die Inneneinrichtung ist origineller als bislang: mehrere Altartypen, Verzierungen Pflanzen, Spiralmuster. Evans mutmaßt, dass sich hier Einflüsse aus der Ägäis zeigen. Die rote Farbe wurde auch schon (etwa in Çatal Hüyük) mit der Symbolik der Erneuerung des Lebens in Zusammenhang gebracht.
34 Tempel Mnajdra, Malta
Ebd., 105
4.3.4.
Lilliu Giovanni in Thimme u.a. 1968, 105
Ebd., 94
Unschwer ist hinter Evans’ Datierungsvorschlägen das Muster der blühenden und absterbenden Kultur, Beginn, Hochkultur und manieristische Übersteigerung, zu sehen. Die Tempel von Mnajdra und Hal Tarxien datiert Evans auf ca. 1600. Zudem ging er von einer Entwicklung auf dem Archipel aus, die von natürlichen Grotten über das Kammergrab zum Tempel führte. Demgegenüber haben Theorien, die Abhängigkeiten von außen unterstellen, ein anderes Bild. Auch wurde angeführt, dass sich die Tempelarchitektur von einfachen runden Häusern ableitet, die zusammengesetzt »die Kleeblattform der Tempel ergeben.« Das würde nicht ausschließen, dass die »Tempel« eigentlich Paläste mit Kapellen waren.
Ebd., 111
Ein besonderes Juwel ist das Hypogäum von Hal Saflieni. Es ist heute das einzige Beispiel eines dreistöckig nach unten aus dem Felsen gehauenen Felsenmonuments mit weit verzweigtem Grundriss. Die Katakombe ist ein komplexes Labyrinth. Höhepunkte sind die tempelartig gestalteten Kammern mit Scheinfassaden sowie die Malereien: Spiralen und schraubenartige Waben. »In den inneren Hallen von Hal Saflieni scheint sich der Kreis zu schließen: wenn die Tempel ursprünglich als Imitation der Felsengräber begannen, so haben wir hier kunstvolle Felsengräber vor uns, welche ihrerseits nun bewußt Tempel nachbilden.«
Albrecht 2001, 34–38
Die Tempel haben in der Regel nach Süden oder Südosten ausgerichtete monumentale Fassaden, häufig mit Trilithtoren, möglicherweise mit Oberlichten. Der Aufbau der Anlagen, namentlich Zugangstreppen, die durch Steinplatten mit Augensymbolen »gesichert« waren, verrät möglicherweise eine exklusive Zugangsbeschränkung für heilige Bereiche.
Das Eingangstor bildet eine Achse, um die seitwärts kleinere Räume in apsidialen Formen gruppiert sind. Maltas Tempel zeichnen sich durch organisch-runde Formen aus. »Der interessanteste Zug maltesischen Formgefühls ist das auffallende Fehlen aller geraden Linien und spitzen Winkel, das Umsetzen aller Formen in weiche, langgezogene Kurven.«
Evans 1963, 139
von Freeden 1993, 56
Die megalithischen Anlagen Maltas haben in ihrer speziellen Form kein Vorbild. »In keiner der frühen Hochkulturen wurde das Prinzip von Kurve und Wölbung als Grundform linearen und plastischen Gestaltens so stringent durchgeführt wie von den Tempelbaumeistern auf Malta.«
Evans 1963, 105
Albrecht 2001 Agius/Ventura 1980 König 1973
Die Anzahl der Apsiden, zwischen drei und sechs, macht gleichzeitig den Unterschied zwischen den Tempeln aus. Für Evans war die Frage der Orientierung nachrangig, wie er überhaupt nicht an eine dezidierte Planung, sondern eher an ein Wuchern des Bauwerks dachte. »Ebenfalls finden sich keinerlei Anzeichen für ein sonderliches Interesse an einem der Himmelskörper.« Die Untersuchungen von Klaus Albrecht kommen in dieser Frage allerdings zu ganz anderen Ergebnissen und es fehlt ganz generell nicht an entsprechenden astronomischen Deutungen der Anlagen.
Obwohl keine Hinweise auf eine Beleuchtung gefunden wurden, geht die Mehrheit der Forscher davon aus, dass die Tempel mit Holz oder Steindecken versehen waren.
Zammit 1995, 59
Zwar ist man in den Tempeln selbst nicht auf Bestattungen gestoßen, aber sie stehen mehrfach in Zusammenhang mit Grabanlagen. Dies und andere Ausstattungsteile legen es nahe, sie in einen Zusammenhang mit Fortlebensvisionen zu stellen. Im Inneren sind Altäre in Form von Steinblöcken oder als Trilithe erhalten, ebenso Orakelöffnungen und Libationslöcher, sowie etliche Dekorationen. Sie reichen von Punktverzierungen über Reliefs, wovon das Spiralmotiv in großer Variation hervorsticht, bis hin zu Stein- und Tonskulpturen. Themistocles Zammit, der erste bedeutende Ausgräber auf Malta, preist die Dekorationskunst ausdrücklich. Farbreste deuten darauf hin, dass die Ornamente ursprünglich farbig ausgeführt waren.
Manche Objekte sind nach wie vor ungeklärt. Etwa die freistehenden Rundsäulen, die sogenannten Betyls (Steinfetische), von denen bereits die Rede war und die im Nahen Osten häufig als nicht-ikonische Repräsentationen der Gottheit dienten. Umstritten ist auch die sexuelle Konnotation der abstrakten Zeichen: phallische Säule im Zusammenhang mit weiblichen Dreiecken?
35 Punktverzierung
Die Rekonstruktion der religiösen Vorstellungswelt und der Riten ist, wie immer in diesen schriftlosen Zeiten, schwierig. Doch auch vorsichtige Archäologen wie David Trump, Anthony Bonanno oder John Evans halten an einem Grundkorpus von möglichen Charakteristiken fest. Vor den Tempelfassaden gab es offensichtlich einen Bereich für öffentliche Riten unter freiem Himmel. Solche Aktivitäten waren in frühen Kulturen oft kaum von aus heutiger Sicht profanen Bereichen zu unterscheiden: öffentliche Eidesleistungen, Versammlungen verschiedenster Art oder öffentliche Ankündigungen. Der Innenbereich des Tempels umfasst eine Opferzone mit Opferaltären. Zahlreiche Tierknochenfunde in den Tempeln belegen eine solche Zuschreibung. Menschenopfer konnten nicht nachgewiesen werden.
Es gibt Hinweise, dass bei mehrapsidialen Tempeln das erste Apsidenpaar und der hofartige Raum zwischen ihnen einer breiteren gesellschaftlichen Schicht zugänglich waren als die rückwärtigen Apsiden. So ist die Dekoration meist auf diesen Bereich beschränkt (in der paläolithischen Höhle war das umgekehrt). Möglicherweise waren die kleineren Apsiden nur für eine Priester-Elite zugänglich oder es handelte sich doch um einen Palast mit ganz anderen sozialen Verhältnissen. Besonders bei der riesigen Anlage in Tarxien könnte man Vergleiche mit den Palästen auf Kreta ziehen, die sowohl kultische als auch profane Funktion hatten.
III.1.2.3.
Im Tarxien-Tempel existiert ein großer Schwellenstein, dekoriert mit einer doppelten Spirale, am Eingang in den innersten Tempelbereich. Die sogenannten Orakelöffnungen dürften der Kommunikation zwischen diesen Bereichen gedient haben. Solche Orakelöffnungen – die schönste befindet sich im Mnajdra-Tempel – gelten durchaus auch als Indiz für die Existenz einer Priesterschaft.
36 »Fat Lady« im Tempel Tarxien, Malta
Auch wenn unter Archäologen heftig über das Geschlecht der zahlreichen Statuetten und Großskulpturen aus Stein und Ton gestritten wird, gibt es bislang doch kaum ernste Zweifel an einem Fruchtbarkeitskult der Magna Mater. Man hat auch schon auf die frappante Analogie zwischen den Umrissen der sitzenden sogenannten fat ladies und jene der Tempel hingewiesen und deutet die Ausrichtung der Tempel auf den Strahl der Sonne zu bestimmten astronomischen Zeitpunkten gar als symbolische geschlechtliche Verbindung von Himmelsgott und Muttergöttin. Dies ist naturgemäß durch empirische Fakten kaum zu erhärten. Andererseits räumt David Trump zumindest eine zweifelsfreie stilistische Analogie ein.
Trump 2002, 88f
Die These eines existierenden Fruchtbarkeitskultes erhält weitere Nahrung durch gefundene Phallusdarstellungen. Besonders im Tarxien-Bereich fand man Monumentalskulpturen von Fruchtbarkeitsgottheiten. Sie sind die ältesten im mediterranen Bereich. Daneben gibt es zahlreiche eindeutig als weiblich zu klassifizierende Statuetten, darunter die Venus von Malta, ein 13 cm messender Lehmtorso (Hagar Qim) im Stile der üblichen Venusfiguren.
37 Sleeping Lady; NMA
Besonders beeindruckend ist die ohne sekundäre Geschlechtsmerkmale ausgeführte, im ursprünglichen Zustand gegen 3 m hohe Riesenstatue einer Gottheit (?) in Tarxien, weiters eine außergewöhnliche Doppelstatuette des megalithischen Xaghra-Stein-Zirkels, die gerade erwähnte Terrakotta-Venus und vor allem die gut 12 cm messende Sleeping Lady aus bunt bemalter
Terrakotta des Hypogäums. Daneben existieren etliche stehende und sitzende Figuren aus Globigerinenkalk oder Terrakotta, die man im Hypogäum von Hal Saflieni gefunden hat. Die unglaublich fein gearbeiteten Kunstwerke in ihrer ausgewogenen Leibesfülle können kaum anders denn als Ausdruck der Fruchtbarkeit und Lebenskraft gedeutet werden.
Vor allem um die Sleeping Lady entzünden sich reiche Diskussionen. Handelt es sich um eine Priesterin in einem Heilschlaf, einem schamanischen Zustand zwischen Körper und Geist, oder ist der Schlaf hier gleichzusetzen dem Tod als dem Übergang in eine neue Welt? Dieser letzte Aspekt wird unterstrichen durch die schon erwähnte Position der Tempel in der Nähe von Grabanlagen sowie durch Libationslöcher, die Opferungen für eine Erdgöttin nahelegen, und aufgefundenen Schlangendarstellungen, die in der Regel eine chthonische Bedeutung haben. Zudem ist man sich ziemlich sicher, dass das Hypogäum in seinem zentralen Rahmen ein Tempel war. In den umliegenden Räumen wurden die Toten bestattet.