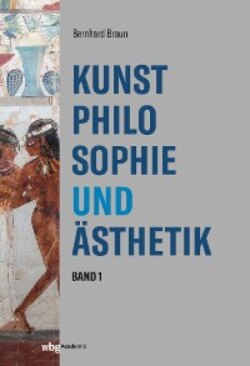Читать книгу Kunstphilosophie und Ästhetik - Bernhard Braun - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.4. Zeichen der Polarität
ОглавлениеIn den letzten Jahrzehnten sorgte die Theorie der Polarität im Zusammenhang mit der Höhlenkunst für einiges Aufsehen. Die Basis dafür bildeten die gründlichen Untersuchungen und statistischen Auswertungen von etwa 60 Höhlen durch André Leroi-Gourhan. Der Archäologe und Paläontologe plädierte für eine religiöse Deutung, spricht im Zusammenhang mit der Höhle sogar vom »paläolithischen Heiligtum« und sah einen gemeinsamen Beginn von Religion und Kunst. Er beschäftigte sich bei seinen Untersuchungen nicht nur mit abbildhaften Darstellungen, sondern auch mit den abstrakten Zeichen als einem besonders aufregenden Kapitel der Kunst.
13 Abstrakte Zeichen in der Höhle von El Castillo (Nachzeichnung)
Leroi-Gourhan 1971, 170–182
Naturgemäß löste kaum etwas so viele spekulative und einander widersprechende Deutungen aus wie solche gegenstandslosen »Kritzeleien«. Die Deutungen – vieles scheint blühender Phantasie entsprungen – reichen von dargestellten Häusern, Tierfallen, Wurfwaffen bis hin zu Wappenschilden oder Warnschildern und Wegweisern in den Höhlen. Eine andere Meinung sieht darin einen prähistorischen Code, der als ferner Vorläufer von Schriftsystemen gelten darf. Es gibt mehrere Hinweise auf piktogrammartige Bilderschriften, etwa in den Höhlen La Pasiega im Berg El Castillo in Nordspanien und in jener von Mas d’Azil in den Pyrenäen, die im Hinblick auf die Schriftentwicklung Aufmerksamkeit erregen.
Ravilious 2013
Leroi-Gourhan 1971, 172
Leroi-Gourhan hält die Zeichen für einen Ausdruck einer Gedankenwelt, die »sich auf Opposition und Ergänzung der männlichen und weiblichen Werte gründete, die symbolisch durch Tierfiguren und mehr oder weniger abstrakte Zeichen ausgedrückt wurden.«
Sowohl aus der Untersuchung mobiler Kunst wie Speere, Harpunen, Lochstäbe, Statuetten, Knochen- und Steinblättchen als auch der Höhlenmalereien zog er Rückschlüsse auf ein Weltbild des Steinzeitmenschen. Es beruhte seiner Meinung nach auf der Vorstellung einer Polarität oder Ambivalenz der Wirklichkeit. Zentral dabei bleibt die sexuelle Polarität. Besonders die Lochstäbe, Geweihstücke des Rentiers mit einem gebohrten Loch – sie dienten vermutlich als Werkzeug –, tragen häufig solche Markierungen oder sind als Penis mit vaginalem Loch gestaltet.
Auffallend bei der Durchsicht der Höhlen war, dass die Maler nicht einfach beliebige, sondern ausgesuchte Tiere malten und dies in einer Häufigkeit, die der Normalverteilung der damaligen Fauna durchaus widersprach. Insekten, Nagetiere, Vögel, Schlangen oder Fische kommen kaum vor, die abgebildeten Tiere schweben ohne Umwelt und in realitätsfernen Größenverhältnissen an der Wand. Die Auflistung der Tiere ermöglicht nach Meinung Leroi-Gourhans die Auswertung im Hinblick auf sexuelle Korrelationen. Signifikant sind Beziehungen von Tier-Mann (Pferd, Bär, Rentier u.a.) und Tier-Frau (Bison, Mammut u.a.).
Berger-Kirchner Lilo in Bandi 1964, 120
Trotz der sexuellen Belegung solcher Abbildungen sind aus dem Paläolithikum kaum unstrittig identifizierbare Kopulationsdarstellung (wie die vermutlich aus dem Mesolithikum stammende Felsgravierung am Horsfieldberg in der Kilwasenke in Jordanien und möglicherweise die Darstellung der Kopulation von Hengst und Stute im Abri Chaire-à-Calvin) bekannt. Erst im Neolithikum wird dieses Sujet zu einem verbreiteten Bildelement. Sehr wohl kommen allerdings neben Vulva- (als älteste Vulva-Darstellung gilt zur Zeit eine 37.000 Jahre alte Gravur im Abri Castanet in Périgord) und Phallusdarstellungen einander zugeordnete abstrakte Zeichen vor, die als sexuelle Symbole interpretiert werden können. Darunter fallen abstrakte grafische Stilisierungen und Umrisszeichnungen (Lascaux), eigenartige Polychromie, ebenfalls in hoher Abstraktion, bis hin zu schwer deutbaren geschwungenen Linien (Altamira).
Auch Marie König stürzte sich auf diesen Zeichenvorrat und entwarf im Rahmen der von ihr präferierten kosmologischen Deutung ein anderes Bild. Demnach hätten wir es mit kalendarischen Zeichen zu tun, die sich vor allem auf die vom Mond geprägte Zeit beziehen. Königs Deutung mündet in die Ansicht, dass es sich bei vielen der weltweit verbreiteten und berühmten Symbole um Zeichen der Wiedergeburt handelt. Das vielleicht berühmteste einschlägige Zeichen dazu ist die Spirale. Ihre Herkunft ist nicht mehr zu bestimmen. Dazu ist ihr Auftreten zu häufig und zu verbreitet. Die meisten Forscher wollen die Spirale nicht nur als Ornament sehen, sondern als Zeichen, das »schon sehr früh einen besonderen Sinnund Bedeutungsgehalt in sich aufgenommen hatte, der als Wasser oder genauer als Kreislauf des Wassers angegeben werden kann und den Gedanken von Leben und Tod und deren ewige Wiederkehr mit enthalten zu haben scheint […].« Auf den Kykladen – in der Ägäis wurde die Spirale häufiger verwandt als anderswo – war die Spirale manchmal zusammen mit Fischen oder Schiffen dargestellt. In Newgrange finden sich gegenläufige Spiralen, die König nicht uninterpretiert lässt: »Die eine Spirale drehte sich nach oben, führte also hinauf zum Licht, zum Himmel, die andere versank im Gegensinn ins Jenseits, ins Dunkel. Es wurde das Problem von Tod und Leben ausgedrückt. Die beiden im Gegensinn laufenden Spiralen setzen den Begriff der beiden polaren Halbkugeln voraus, auf denen sich der Weg abrollt.«
14 Spiralverzierung im Tempel Tarxien, Malta
Thimme Jürgen in Thimme u.a. 1968, 18
Hood 1978, 234
Die Spirale, die stets das »ewige Kommen und Gehen« demonstriere, stünde dann für eine Auferstehungshoffnung und determiniere mit dieser Bedeutung noch das von ihr abgeleitete Labyrinth. Ein Labyrinth, »durch das nur die Eingeweihten hindurchgehen und das die Eindringlinge abhält. Diesen Sinn zeigt sie in der Umrahmung der Investiturszene in Mari (18. Jahrhundert v. Chr.), und ihn besaß sie schon in Kreta.« Die Spirale hatte eine lange Karriere in der Kunstgeschichte vor sich. Sie spielte auch eine Rolle in der islamischen Ästhetik, sowohl im formalen Bildaufbau als auch als Symbol eines esoterischen Wissens.
König 1973, 249
Mahlstedt 2004, 124
III.1.2.2.
Papadopoulo 1977, 192
II.1.2.5.
V.3.4.1.1.