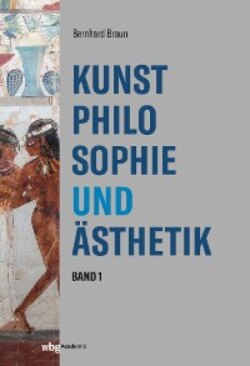Читать книгу Kunstphilosophie und Ästhetik - Bernhard Braun - Страница 32
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4.3.2. Zwischen Architektur und Skulptur
ОглавлениеDie Dolmen- und Megalith-Anlagen sind ein Genre, dessen Einordnung – in kunstgeschichtlichen Begriffen gesprochen – zwischen Bildhauerei und Architektur changiert. Bereits am Beginn der Architektur muss man somit mit jenem Begriffspaar operieren, das den Architekturdiskurs bis zur Gegenwart begleitete.
X.2.6.ff.
Grundsätzlich wird Architektur definiert als ein Schaffen eines durch Mauern und Dach geschützten Raumes, bei dem sich Außen und Innen unterscheiden lässt. Doch Architektur hat immer wieder versucht, diese einfache und funktionale Bestimmung zu unterlaufen. Schon das Licht, später das Glas, diente dazu, die Grenzen von Innen und Außen aufzuheben. Die Gründe dafür waren verschieden. Architektur begann nun nicht einfach mit der Urhütte, sondern mit dem Spiel mit Grenzen und deren Auflösung.
Göbekli Tepe
II.2.4.
Hauptmann Harald/Özdoğan Mehmet in Kat. 2007a, 31
Beispiele für dieses ambivalente Verhältnis sind die in den letzten Jahrzehnten ausgegrabenen Anlagen in Zentralanatolien. In Göbekli Tepe und Nevali Gori umrahmen kreisförmige Steinsäulen ein Pfeilerpaar in ihrer Mitte. Über diese bis zu zehn Tonnen schweren T-förmigen Monolithen gibt es angeregte Diskussionen. Vielleicht handelt es sich um Kultpfeiler ähnlich den späteren Techen-Pfeilern in Ägypten. Die künstlerischen Motive für Skulptur und Relief in Göbekli Tepe umfassen vor allem Raubtiere. Diese »Totemtiere« können als »›Pantheon‹ einer schamanistischen Vorstellungswelt« angesehen werden. Auch in den Kulträumen fanden sich Stelen und Megalithen. Klaus Schmidt, einer der Ausgräber, hält eine anthropomorphe Deutung der T-Pfeiler für möglich. Ian Hodder und Lynn Meskell weisen auf die Phallosform der »stone pillar-beings« mit der erwähnten Bebilderung hin.
Hodder/Meskell 2011, 237
Schmidt 2006, 117
Ebenso möglich wäre aber, dass »Menhire und Mazzeben am ehesten als Behausungen eines Numens – einer verehrten Gottheit oder eines Totengeistes – gedeutet werden können.« Damit beherbergte der Stein Geistwesen. Die Abbildungen auf den Steinen könnten Rituale darstellen. Die Frage, ob es sich um Pfeiler (Architektur) oder Statuen (Bildhauerei) handelt, hat auch deshalb große Relevanz, weil im Falle von Pfeilern eine Dachkonstruktion denkbar wäre, die dann wieder die These nach sich zöge, es handle sich bei Göbekli Tepe nicht nur um einen freien Kultplatz, sondern um einen Tempel oder gar einen Wohnplatz. Letzteres ist unwahrscheinlich, weil bislang keine Spuren gefunden wurden, die auf eine Siedlung sesshafter Bewohner hinweisen.
28 Die Anlage von Göbekli Tepe
Aus der Untersuchung von prähistorischen Felsmalereien in Latmos an der türkischen Westküste entstand eine andere Theorie für die Monolithen in Göbekli Tepe. Demnach wären die Figuren Wetter- und Berggottheiten, die Bergspitze des Latmos-Gebirges wiedergebend. Folgte man dieser Deutung, wäre Göbekli Tepe Architektur und die erste freistehende Kultanlage der Weltgeschichte – für einen Berg- und Wettergott.
Ebd., 127ff
III.2.1.3.
Auffallend ist, dass in der Anlage weibliche Abbildungen gänzlich zu fehlen scheinen. Aus dieser Tatsache zieht Schmidt den Schluss, dass Göbekli Tepe kein Ort einer Lebens- und Fruchtbarkeitssymbolik war, sondern ein Ort des Totenkults. Philosophisch könnte man das Fehlen ausdrücklicher weiblicher Gottheiten unter Umständen dadurch plausibel machen, dass diese Zeit noch keine Trennung von Prinzipien kannte, sondern im Verständnis von Ambivalenzen lebte. Das lässt sich ansatzweise in orphischen Texten noch nachvollziehen.
Die Menschen von Göbekli Tepe waren Jäger. Streng genommen gehört der Ort noch nicht in die Zeit des Neolithikums. Trotzdem muss es ein Ort gewesen sein, der einen Fixpunkt im Leben der Menschen darstellte und an dem man sich immer wieder versammelte. Göbekli Tepe hatte keine Fortsetzung, der Ort verwaiste.
Zurückkommend auf die Ausgangsfrage, gilt das, was im Fall von Göbekli Tepe die Wissenschaftler umtreibt, für zahlreiche neolithische Anlagen: Sind Menhire Zeichen kosmischer Ordnung und müssen figurativ und symbolisch gelesen werden oder sind sie Teil einer Architektur? Es ist sogar unklar, ob die Spuren der Bearbeitung an ihnen bildhauerischen Ambitionen entsprangen und ob erkennbare anthropomorphe Strukturen auch als solche gelesen werden sollten. Die Schwierigkeit dieser Fragen wird eindrucksvoll durch die Funde der schon kurz erwähnten Sandstein-Köpfe aus Lepenski Vir (Alter etwa 5000 Jahre) an der Donau im östlichen Serbien in den Sechzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts unterstrichen. Von diesen ersten Großplastiken (bis 60 cm) gibt es naturalistische, abstrakte und anikonische Varianten. Wegen ihrer Anordnung im Haus, dort vor allem im Umkreis des zentralen Herdes, kann man – nun umgekehrt gewendet – nicht ausschließen, dass sie eine architektonische Funktion hatten. Bislang wurden Großplastiken eher im östlichen Mittelmeerraum und weniger in Westeuropa gefunden. Figurenmenhire hingegen tauchen überall auf.
Klar auf die Seite der bildhauerischen Tätigkeit gehört die aus Ton erzeugte Kleinplastik, die im Neolithikum große Bedeutung erhielt und weite Verbreitung erfuhr. Neben omnipräsenten Spezialkulten wie dem Schädelkult mit modellierten und bemalten Knochen- und Tonschädeln umfasste die kultische Kleinplastik vor allem das weibliche Idol. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist es Träger der bereits angesprochenen Fruchtbarkeitskulte, die in der späteren Zeit durch Mythentexte entschlüsselt werden können.
3.1.
Burkert 1972, 92
Auf die Schwierigkeiten, mit einer universalen Fruchtbarkeitstheorie zu operieren, wurde bereits hingewiesen. Dennoch bleibt eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass die weibliche Sakralität für die Fruchtbarkeit der Erde stand. Walter Burkert sah in den Statuetten ein »bemerkenswertes Zeugnis der Kontinuität von der Jäger- in die Ackerbauernzeit hinein«.
III.2.1.3.1.
Der Erdkult war zu großen Teilen parthenogenetisch. Damit verweist ein zentrales Motiv namentlich der griechischen kulturellen Erzählungen auf frühe Zeit zurück. Allerdings dominiert etwa in den orphischen Mysterienkulten durchaus die geschlechtliche Beziehung von Erde und Himmel. Angewandt auf die Ackerbaukultur fand die Erde ihr phallisches Gegenstück im Pflug und zeigte ihre Fruchtbarkeit am Geschlechtsakt.
Eliade 1976, I, 49
Eine weitere Gruppe von Idolen repräsentiert das Motiv des sterbenden und wiederkommenden Gottes, ein Thema, das mit Eliade »zu den bedeutendsten überhaupt« gehört. Es ist Symbol für das Absterben der Natur im Herbst und dem Wiedererwachen des Lebens im Frühjahr.
Vielleicht könnte man resümieren, dass in der neolithischen Plastik, in der figurative und architektonische Präferenz nicht mehr streng zu trennen sind, sich als wesentlichstes Symbol eine Verortung spiegelt, die zwischen kosmischen Zyklen und denen von Fruchtbarkeit und Leben oszilliert und Verbindungen herstellt.