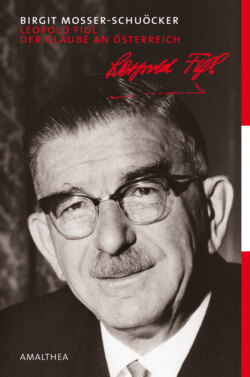Читать книгу Leopold Figl - Birgit Mosser-Schuöcker - Страница 16
Die Verhaftung: 12. März 1938
ОглавлениеDas Warten ist das Härteste. Leopold Figl dämpft seine Zigarette aus. Sein Blick wandert zu Hansl, der am Fenster steht und die Straße beobachtet. Niemand hat dem Kind erklärt, warum die Stimmung in der Wohnung so angespannt ist. Warum der Vater Papiere verbrennt und noch mehr raucht als gewöhnlich. Warum die Mutter so schweigsam ist und sich manchmal verstohlen über die Augen wischt. Warum der Sekretär des Vaters und eine fremde Frau im Wohnzimmer sitzen. Und warum die Erwachsenen ihn und die kleine Liesl immer wieder mit ernsten Blicken mustern. Niemand hat etwas zu Hansl gesagt, aber der Bub hat genug von den Erwachsenen aufgeschnappt, um zu begreifen: Fremde Männer werden kommen und den Vater mitnehmen.
„Wenigstens die Kleine versteht es noch nicht“, denkt Leopold Figl. Liesl sitzt auf dem Boden und spielt mit ihrer Lieblingspuppe. Bei dem Gedanken an die Kinder krampft sich sein Magen zusammen. Sie werden den Vater brauchen, und er wird nicht da sein. Hilde wird stark sein müssen. Sie wird Hansl und Liesl Vater und Mutter zugleich sein müssen. Es klopft an der Türe, laut und herrisch. Obwohl Leopold Figl darauf gewartet hat, zuckt er zusammen. Es ist so weit. Schweigend erhebt er sich. Der Weg zur Wohnungstüre ist kurz, zu kurz. Sie sollen seine Angst nicht spüren, die Nazis. Der Hausherr atmet noch einmal tief durch, dann öffnet er. Drei Männer in Zivil. Sie tragen lange Mäntel und eine Hakenkreuz-Armbinde. „Sind Sie der Reichsbauernbunddirektor Leopold Figl?“, fragt einer der drei noch an der Türe. „Ja“, sagt der Angesprochene und nickt knapp. Was sonst sollte er antworten. Sie drängen ihn ins Wohnzimmer. Der Älteste, der offenbar ihr Anführer ist, schnarrt: „Wir haben einen Haft- und einen Haussuchungsbefehl!“ und zückt zwei maschingeschriebene Papiere. Bevor Leopold Figl Gelegenheit hat, die Schreiben zu lesen, steckt der Gestapo-Beamte sie wieder weg. Unterdessen beginnen die beiden anderen damit, die Wohnung zu durchsuchen. Sie werden nichts finden, ein kleiner Triumph. Die jungen Männer suchen routiniert und brutal. Es genügt nicht, das Ehebett zu durchwühlen. Sie schlitzen auch die Matratze auf. Es genügt nicht, Bilder abzunehmen. Sie reißen sie auch aus dem Rahmen. Bis auf ihr Gepolter herrscht Totenstille in der Wohnung. Der Anführer lässt Leopold Figl nicht aus den Augen. Wird er protestieren, der Herr Reichsbauernbunddirektor? Oder Schwäche zeigen?
Während die fremden Männer die Wohnung durchwühlen, weicht Hansl seinem Vater nicht von der Seite. Sie sollen ihn nicht mitnehmen, den Papa. Der Gestapo-Mann schaut den Sechsjährigen streng an. Immer diese Gefühlsduselei mit den Kindern. „Sollen die Leute doch an ihre Bälger denken, bevor sie sich gegen den Führer stellen“, denkt er verbissen und schiebt den Kleinen grob von seinem Vater weg. Leopold Figl wird blass. Sie sollen ihn mitnehmen, aber Hilde und die Kinder endlich in Frieden lassen. Er will etwas sagen, doch sein Sekretär kommt ihm zuvor: „Lassen Sie doch wenigstens das Kind in Ruhe!“, protestiert Fritz Eckert. Die Augen des Gestapo-Mannes werden schmal. „Name?“, herrscht er Eckert an und beginnt in seinen Papieren zu blättern. „Schade, dass Sie nicht auf meiner Liste stehen!“, sagt er schließlich. Der Verhaftete atmet auf. Er hat es Eckert ja am Vormittag gesagt. Er soll nach Hause gehen, er gefährdet sich doch nur selbst. Aber der Gute hat irgendetwas von Treue, die man halten muss, geredet und ist einfach mitgegangen. Fast hätte er sich damit seine eigene Verhaftung eingehandelt, denkt sein Chef traurig. „Los, verabschieden Sie sich jetzt!“ Die Herren von der Gestapo haben das Interesse an der Figl’schen Wohnung verloren. Ein Händedruck für Eckert, ein flüchtiger Kuss für Hilde. Von den Kindern hat sich Leopold Figl schon verabschiedet, als sie noch unter sich waren. Nur keine Emotionen zeigen vor diesen Leuten. Schon sind sie im Stiegenhaus, schon schlägt die Türe des Polizeiwagens zu. Es ist gut, dass Leopold Figl nicht weiß, was ihm bevorsteht.
Der spätere Bundeskanzler teilt sein Schicksal mit über 70 000 Österreichern. Schon in den ersten Tagen der Nazi-Herrschaft werden Juden, Monarchisten, Kommunisten, Politiker und Intellektuelle des Ständestaates verhaftet. Als der »Führer« am 15. März auf dem Heldenplatz vor der Geschichte den Eintritt seiner Heimat in das Deutsche Reich meldet, sind die Wiener Gefängnisse schon überfüllt.
Leopold Figl sitzt an diesem Tag mit fünf Leidensgenossen in einer Einzelzelle im Polizeigefängnis an der Rossauer Lände, der sogenannten »Liesl«. Die Beamten, die Figl bewachen, haben noch vor wenigen Tagen vor ihm salutiert. Die Behandlung ist unfreundlich, aber nicht unmenschlich.
Am letzten Märztag macht sich Unruhe unter den Gefangenen breit. Sie werden rasiert, Fingerabdrücke werden genommen. Die Männer werden nach Buchstaben sortiert in Transportzellen verlegt. Manche meinen gar, die Entlassung stünde bevor, und versuchen, sich den Wachmannschaften anzubiedern. Franz Olah, als Sozialdemokrat ebenfalls verhaftet, erinnert sich: »Einige haben sich demonstrativ den ›Völkischen Beobachter‹ eingesteckt, ein anderer hat sich ein Hakenkreuz angeheftet, das er noch von draußen gehabt hat. Der mit dem Hakenkreuz hat eine ordentliche Watschen von einem SS-Mann bekommen.«16
Der spätere Bundeskanzler Bruno Kreisky hat an diesem Tag Glück: Er wird für den Transport nach Dachau aufgerufen, aber im »allgemeinen Durcheinander« vergessen und später dank Intervention eines Polizeibeamten nicht mehr dafür eingeteilt.17
Leopold Figl und 150 Leidensgenossen haben kein Glück. Am Abend des 1. April 1938 werden die Gefangenen in sogenannte Überfallsautos gepfercht und über die Ringstraße gefahren. Immer noch wissen sie nicht, wohin. »Da biegen die Wagen in die Mariahilfer Straße ein und nehmen Kurs zum Westbahnhof. […] Da plötzlich schreit einer mit Wahnsinnsstimme: ›Nach Dachau! Ins Konzentrationslager!‹«18 Auch vielen Uniformierten wird dieser Abend in Erinnerung bleiben. So heißt es im Bericht der Kriminalpolizeistelle Wien vom 1. April 1938, der Transport »hinterließ bei allen Sicherheitswachebeamten einen gewissen psychologischen Eindruck, hervorgerufen durch das Dabeisein der eigenen ehemaligen hohen und höchsten Vorgesetzten.«
Am Westbahnhof angekommen, ist Schluss mit der »ostmärkischen Gefühlsduselei«. Die Dachauer SS-Wachmannschaft übernimmt die »Herren Österreicher«, weit weg von den Blicken anderer Reisender, am Frachtenbahnhof. »Lauter junge Burschen, grobe Hunde, die uns gleich mit Gewehrkolben empfangen haben, mit Stiefeltritten usw., mit Faustschlägen ins Gesicht. Wir waren der erste Transport. […] Und da mussten wir dann zu sechst in Coupés sitzen, wo sonst vier sitzen, also ganz eng gedrängt. Das war in der Nacht, und wir mussten ständig ins Licht schauen. Bei der Tür stand ein SS-Mann mit einem Gewehrkolben; wenn einem die Augen zugefallen sind, hat man eine gekriegt.«19
Die Fahrt von Wien nach München dauert zehn Stunden. So lange haben die jungen SS-Männer Zeit, die Gefangenen zu brechen. Aus nationalsozialistischer Sicht macht das nicht nur Spaß, sondern auch Sinn: Die »Schutzhäftlinge« gehören zu einem großen Teil der geistigen und politischen Elite des gerade untergegangen Staates an. Leopold Figl ist Häftling Nummer 143 des »Prominententransportes«, wie die Nazis höhnisch sagen.
Was mag ihm während jener zehn Stunden durch den Kopf gegangen sein? Nach der Ankunft in Bayern bewahrheiten sich alle Befürchtungen, die der spätere Bundeskanzler gehabt haben mag. »Als wir in Dachau ankamen«, schreibt sein Mitgefangener Rudolf Kalmar, »von der Bahn ins Lager geschleift und dort in irgendeine Ecke geprügelt, begann so etwas wie ein öffentliches Verhör vor einer ganzen Gruppe von sogenannten Offizieren. Jeder einzelne von uns wurde vorgerufen und verhöhnt. Jeder schmutzige Witz fand seinen begeisterten Beifall.«20
Einige Stunden später neigt sich der erste Tag, den Leopold Figl im Konzentrationslager überlebt hat, dem Ende zu. 151 Österreicher sind auf dem Dachauer Appellplatz angetreten. Sie haben eine schlaflose Zugfahrt, ein demütigendes Verhör, eine anstrengende Registrierung und jede Menge Prügel hinter sich. Zu essen oder trinken gibt es nichts. Hans Loritz, der Kommandant, mustert die in Doppelreihen angetretenen Häftlinge. »Wir werden jetzt essen gehen und ein gutes Glas Bier auf die Ankunft der Herren Österreicher trinken. Und ihr lasst euch in der Zwischenzeit ein bisschen Sonne in den Bauch scheinen. Das ist gut für den Hunger!«21
Während sich Hans Loritz bei einem Glas Bier von dem anstrengenden Tag erholt, kommt der Friseur auf den Appellplatz. Den Neuzugängen werden die Köpfe kahl geschoren. Dann heißt es weiter stehen. Die Männer starren sich gegenseitig verschämt und entsetzt an. Ohne Haare und in der schäbigen blau-weiß-gestreiften KZ-Montur gleichen sie Zuchthäuslern. Minister stehen neben Kommunisten, jüdische Kaufleute neben jungen Sozialisten. Die erbitterten Gegner von gestern sind jetzt die Opfer eines gemeinsamen Feindes. Irgendwo auf dem Appellplatz steht auch Leopold Figl. In den letzten 24 Stunden hat er erfahren, was es heißt, ein »Schutzhäftling« des sogenannten »Dritten Reiches« zu sein.
Am 17. April schreibt er die erste Karte nach Hause: »Es geht mir gut und ich bin gesund!« Diese barmherzige Lüge wird sich in jedem der Briefe, die der Gefangene in den nächsten fünf Jahren schreiben darf, wiederholen. Seine Frau Hilde kann auch in ihren schlimmsten Befürchtungen nicht ahnen, wie die KZ-Häftlinge tatsächlich behandelt werden. In knappen Worten fragt der Verhaftete nach dem Befinden der Familie. Er verliert kein Wort über seine eigenen Gefühle. Rund zwei Wochen nach seiner Ankunft in Dachau sitzt der Schock über das Geschehene vermutlich noch zu tief. In der kurzen Karte schöpft Figl nicht einmal die zehn vom Lagerkommandanten zugestandenen Zeilen aus; er schreibt nur sechs. In den kommenden Monaten und Jahren wird Leopold Figl lernen, seine Frau mit Worten aufzumuntern, die er sich selbst vermutlich nur schwer abringen kann. Nur hin und wieder wird er sich einen Hinweis auf seine Gefühle erlauben: »Ich kann dir nicht schreiben, was mein Innerstes empfindet«, heißt es in einem Brief aus dem Jahr 1939.22 Selbst wenn es keine Zensur gäbe, würde es der Gefangene kaum über sich bringen, seiner Frau den wahren KZ-Alltag zu schildern. Das Regime, das ihn gefangen hält, zeigt ihm mit allen Mitteln, dass einer wie er nichts mehr zu hoffen hat.