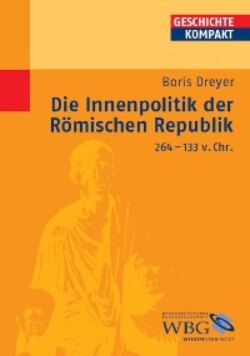Читать книгу Die Innenpolitik der Römischen Republik 264-133 v.Chr. - Boris Dreyer - Страница 28
h) Entwicklungstendenzen und Ausdifferenzierungen seit 350 v. Chr.
ОглавлениеVor den Ständekämpfen
Vor den Ständekämpfen hatten die Patrizier aufgrund der wirtschaftlichen Überlegenheit und des Geblütsrechts die politischen Privilegien. In den Zenturiatskomitien hatten die römischen Bürger Stimmrecht nach Vermögen. Ab der Mitte des 4. Jahrhunderts v. Chr. erlangten die Plebejer Zugang zum Senat sowie zu den Ämtern und Priesterstellen.
Ausdifferenzierung der Gesellschaft
Um 300 v. Chr. war der Unterschied zwischen Plebejern und Patriziern in dieser Hinsicht fast obsolet. Infolge der „Weltherrschaft“ differenzierte sich die Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung aus. Die Proletarier, die Besitzlosen, waren die Konsequenz aus der massenhaften Verarmung der Bauern. Sie wanderten vornehmlich nach Rom ab. Neuer Reichtum trat durch die Möglichkeiten hinzu, die die eben errungene „Weltherrschaft“ boten, besonders für die Mitglieder des Adels, die nicht im Senat versammelt waren.
Ritter/equites
Die equites/Ritter waren in den Komitien eine eigene classis. Der Ritterzensus war Voraussetzung für die (ehrenamtliche) Ämterlaufbahn. So war der Aufstieg in den Senat möglich (meist über das Amt des Quaestors). Die nobiles waren ab dem zweiten vorchristlichen Jahrhundert der engere Kreis des Senatsadels, in deren Familien es ein Mitglied zum Konsulat gebracht hatte. Ab 218 v. Chr., auf der Basis der lex Claudia de nave senatorum, wurden die Mitglieder des Senats auf die Agrarwirtschaft festgelegt. Dadurch wurde langfristig die Aufgliederung des Adligenstandes in einen ordo senatorius und einen ordo equester eingeleitet.
Wirtschaftliche und politische Interessen
Diese Ausdifferenzierung, die aufgrund der unterschiedlichen wirtschaftlichen Interessen einsetzte, wurde durch die Reformgesetze des Gaius Gracchus auch politisch aufgeladen und daher nachhaltig festgeschrieben. Angehörige des späteren ordo equester waren in den neuen Wirtschaftszweigen als Bankiers, Großkaufleute, Großproduzenten und als publicani tätig. Die publicani pachteten zunächst beim zuständigen Statthalter, seit Gaius Gracchus beim Zensor in Rom das Recht zur Eintreibung der Steuern in den Provinzen im Auftrag des Staates. Diese waren schon bald wegen ihrer rücksichtslosen Praxis der Eintreibung (um die eigene Gewinnspanne hoch zu halten) bei den Provinzialen verhasst. Erst ab 149 v. Chr. gab es in Rom Berufungsgerichte gegen die Vergehen gegenüber den Provinzialen.
Tabelle 3: Struktur und Wandel der römischen Gesellschaft nach wirtschaftlichen, rechtlichen und politischen Kriterien
I) etwa 350 v. Chr.
II) etwa 150 v. Chr.
Sklaven
Der Sklave war rechtlich ein Eigentum eines anderen. Für die römische Frühzeit war eine patriarchalische Sklaverei charakteristisch, bei der das unfreie Gesinde ebenso wie die Kinder des Hauses der unbeschränkten vaterrechtlichen Hausgewalt unterstand, aber auch mit der Herrenfamilie lebte und arbeitete.
familia
Der Nukleus der römischen Sozialordnung ist die familia. Ab dem 2. und 1. Jahrhundert v. Chr. stellte sich ein erhöhter Bedarf an Sklaven wegen der sich entwickelnden Wirtschaft ein. Durch die Eroberungen wurde der Bedarf gedeckt. Die deutliche Mehrheit der Sklaven war in der Landwirtschaft beschäftigt (familia rustica). Allerdings waren die Verwendungsarten vielfältig: So gab es zunehmend Haussklaven, Dienerinnen, Köche, Lehrer, Finanzverwalter in den Haushalten besonders der reicheren römischen Bürger auf dem Land und in der urbs (familia urbana).
Freilassungen
Es war dem Sklaven möglich, eigenes Vermögen mit vollgültigem Besitzrecht (als Entgelt für besondere Dienste) zu erwerben (peculium). Damit konnte er sich freikaufen, wenn er nicht ohnehin freigelassen wurde. Damit stieg er rechtlich in den Rang eines römischen Bürgers auf, war aber dem ehemaligen Herrn zu Diensten verpflichtet und gehörte zu seiner Klientel. Das bedeutete, dass er ihn als Konsequenz dieses „fides-haltigen, asymmetrischen Beziehungsgeflechts“, wie es Hölkeskamp (2004, S. 41) formuliert, auch in seinen politischen Ambitionen unterstützte. Erst in der zweiten Generation war das volle Bürgerrecht erwerbbar.
Dass Freilassungen zu einem wirklich bedeutsamen politischen Faktor werden konnten, zeigen nicht erst die Reglementierungen des Princeps Augustus gleich nach seinem Sieg über seine Konkurrenten und die weiterer Kaiser nach ihm.