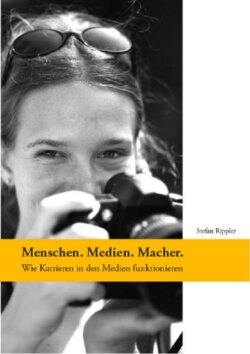Читать книгу Menschen. Medien. Macher. - Branko Woischwill, Stefan Rippler - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеUlrich Brenner
Hineinscheitern kann man nicht!
[cmh] Ulrich Brenner ist ein Kind der „Deutschen Journalistenschule“. Zwischen Unmengen von Büchern, Magazinen und Zeitungen erzählt er uns, wie man von der Schulbank in das Büro des Schulleiters aufsteigt, welches Handwerkszeug man für eine Karriere im Journalismus braucht und wie man den Werkzeugkoffer packt.
Herr Brenner, Sie haben vor über 30 Jahren selbst die „Deutsche Journalistenschule“ in München besucht. Haben Sie damals gleich einen Job gefunden?
Ja, ich hatte Glück. Ich bekam eine Redakteursstelle bei der „Stuttgarter Zeitung“ im Lokalen, wo ich während meiner Ausbildung ein Praktikum absolviert hatte. Das war keine Selbstverständlichkeit, denn in Zeiten der Ölkrise gingen in den Medien die Anzeigeneinnahmen zurück, Personal wurde eingespart.
Sie sind also im Lokalen eingestiegen. Können Sie diesen Weg empfehlen?
Unbedingt. Ich war auch nach der Journalistenschule ein eher langsamer Schreiber, der sich schwer tat, Geschichten zu entlassen. Der Zwang zur tagesaktuellen Schnelligkeit im Lokalen hat mir gut getan und mir meinen Weg geebnet. Ich war schnell als guter Schreiber und Mensch mit Ideen für Geschichten bekannt und konnte dann später in die politische Redaktion wechseln. Dort wollte ich perspektivisch hin und blieb sieben Jahre. Als Horst Stern in den 1980er Jahren die Zeitschrift „Natur“ gründete, wurde ich dort zunächst Chef vom Dienst und später stellvertretender Chefredakteur. Acht Jahre später endete ein Gespräch mit dem ehemaligen Geschäftsführer von „Gruner und Jahr“ in München mit einem Posten bei „P.M.“ Dort blieb ich allerdings nur ein Jahr und ging 1991 als stellvertretender Chefredakteur zum „SZ-Magazin“. Das war eine schöne und freie Zeit, denn das Heft musste nicht mit jeder Ausgabe verkauft werden, sondern lag dem großen Dampfer „Süddeutsche Zeitung“ bei. 1996 stolperte ich zum „BMW Magazin“.
Sie stolperten?
Ja, ich stolperte. Ich hatte keine Ahnung von Kundenmagazinen und Corporate Publishing. Auftragsarbeit für ein großes Unternehmen zu leisten, war doch etwas fundamental anderes als der freie, kritische und relativ unabhängige Journalismus, den ich vorher viele Jahre gemacht hatte. Für meinen jetzigen Job hat es mir jedoch viel gebracht. Ich habe dadurch Einblick in einen Bereich bekommen, den ich vorher nicht kannte: angefangen bei der Beobachtung, wie so ein Weltunternehmen tickt bis hin zur Erfahrung, wie kundenorientierte Kommunikation und die Medien funktionieren. Aber die Marketingabteilung hat uns manchmal schon mächtig eingebremst.
Das heißt?
Unsere journalistische Fantasie und Formulierfreude war eingeschränkt. Manchmal war sogar die Wortwahl vorgeschrieben. Jede Geschichte, jedes Thema und die Ausgabe selbst mussten abgestimmt werden. Das war und ist legitim, aber für mich sehr fremd. Wir hatten allerdings durch den hervorragenden Etat auch Möglichkeiten, die andere Redaktionen nicht hatten. Wir konnten erstklassige Autoren und Spitzenfotografen verpflichten, um die Autos zu inszenieren. Das hat auch große Freude gemacht. Man muss sich nur im Klaren darüber sein, dass man sich in den Dienst eines Auftraggebers stellt. Schwierig wird es, wenn man sich mit den Werten und Produkten dieses Unternehmens nicht identifizieren kann. Ich gehöre aber weiterhin nicht zu denjenigen, die PR für unmoralisch oder zweitklassig halten. Die Zeit war spannend und im Nachhinein möchte ich sie nicht missen.
Heute sind Sie Leiter der „Deutschen Journalistenschule“. Schützt eine solch gute Ausbildung vor Arbeitslosigkeit?
Nein, sicher nicht generell. Heute kommt kein Job mehr angeflogen. Journalistenschulen bieten allerdings ein paar Vorteile. Wir bilden multimedial aus: Print, Hörfunk, Fernsehen und Online. Das ist sehr nützlich, denn ein Journalist muss heute in mehreren Medien zu Hause sein. Das bedeutet nicht, dass unsere Absolventen Alleskönner sind, aber sie sind in der Lage, Themen für mehrere Kanäle aufzubereiten. Crossmedial ist das Stichwort der Zukunft. Ein weiterer Vorteil ist, dass man in ein Netzwerk ehemaliger Absolventen hinein geboren wird. Aber auch das ist kein Freibrief. Man muss durch gute Leistungen in der Praktikumszeit oder durch gute Ideen und Geschichten als Freier auffallen.
Reicht das für eine Karriere im Journalismus?
Wahrscheinlich nicht. Heute muss man jungen Menschen zu einem Studium raten. Ich sage: ein Studium, das Spaß macht. Den journalistischen Schliff bekommen sie dann im Volontariat oder in der Ausbildung an der Journalistenschule. Wenn man aber ein journalistisches Studium machen möchte, rate ich unbedingt zu einer Universität, deren Ausbildungsplan mit vielen praktischen Anteilen gespickt ist. Grundsätzlich setzt sich die Kommunikationswissenschaft, wie es der Name bereits schon sagt, wissenschaftlich mit dem Journalismus auseinander und trainiert nicht praktisch journalistisches Handwerk. Der umgekehrte Weg ist auch praktikabel. Erst Volontariat oder Ausbildung und dann ein Studium. Ohne Studium werden sich viele früher oder später umgucken, wenn sie nicht mehr weiterkommen. Bei großen Zeitungen oder öffentlich-rechtlichen Sendern wird heute ein Studium einfach verlangt. Das ist ein großer Unterschied zu früher.
Was war denn früher anders?
Früher konnte man auch als Seiteneinsteiger im Journalismus Karriere machen. Das ist heute kaum mehr möglich, obwohl das viele interessante Typen in den Journalismus gebracht hat. Ein solcher Weg ist nicht ausgeschlossen, aber seltener geworden.
Welche Eigenschaften muss man dafür mitbringen?
Ein ehemaliger Ressortleiter sagte zu mir: „Den Beruf kann man nicht lernen, in den muss man hineinscheitern.“ Hineinscheitern! Das sehe ich anders: Im Grunde ist es kein großes Hexenwerk – man kann den Beruf lernen. Wichtig sind die handwerklichen Dinge, wie der Umgang mit der Sprache – ordentliche deutsche Sätze sollte man schon schreiben können – und die Recherche. Aber auch das lässt sich perfektionieren. Grundvoraussetzungen sind Neugier und Engagement. Wissen zu wollen, was in der Welt passiert und dies den Lesern, Hörern und Sehern zu vermitteln, das ist es. Engagement ist genauso wichtig. Jemand, der eine Fünf-Tage-Woche oder einen Acht-Stunden-Tag sucht, ist falsch oder muss eine Nische finden.
Journalisten müssen heute vieles auf einmal tun: E-Mails schreiben, sich um Technisches und Organisatorisches kümmern und vieles mehr. Die verlorene Zeit geht auf Kosten der Recherche.
Zweifellos! Sie geht auf Kosten früherer journalistischer Tugenden. Hinzu kommt, dass viele Redaktionen personell ausgedünnt worden sind. Für den Qualitätsjournalismus ist das eine gefährliche Entwicklung, die zu Recht beklagt wird. Recherchezeit fällt weg und immer mehr PR-Texte wandern ungeprüft und ungefiltert auf redaktionelle Seiten. Solche Entwicklungen halte ich für fatal, denn die eigentliche Aufgabe des Journalismus ist es, die Gesellschaft und was in ihr passiert kritisch zu begleiten. Dafür bleibt zu wenig Zeit.
Dieser Wandel gefährdet also die Funktion des Journalismus?
Ja. Hauptaufgabe der Journalisten ist es, so zu berichten, dass Leser, Hörer und Seher möglichst in der Lage sind, sich ein Bild zu machen, um dann auf einer fundierten Informationsbasis Entscheidungen treffen zu können. Dazu müssen verschiedene Aspekte eines Themas erarbeitet und dargestellt werden. Wenn dazu keine Zeit bleibt, ist die Funktion des Journalismus gefährdet.
Hat der Beruf ihren Freundeskreis beeinflusst?
Sehr! Ich bin heute noch eng mit Kollegen befreundet, die ich als junger Journalist bei der „Stuttgarter Zeitung“ kennen gelernt habe. Der Mensch, den ich als meinen besten Freund bezeichnen würde, ist seit vielen Jahren Brüssel-Korrespondent der „Stuttgarter Zeitung“ und des „Tagesspiegels“. Wir haben uns damals sehr geholfen: unsere Artikel gegenseitig gelesen, gemeinsame Strategien entwickelt und einander gestützt. Eine Freundschaft fürs Leben. Nicht alle meine Freunde sind Journalisten, aber eine ganze Menge. Wenn wir uns treffen, ist der Beruf längst nicht immer das Thema – da würden sich unsere Frauen langweilen. Obwohl Journalisten schon sehr gerne über sich und ihr Gewerbe reden.