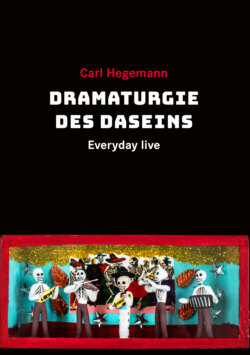Читать книгу Dramaturgie des Daseins - Carl Hegemann - Страница 23
Nichts tun
ОглавлениеZur Metaphysik der Zeitverschwendung
Aus Mangel an Ruhe läuft unsere Zivilisation in eine neue Barbarei aus. Zu keiner Zeit haben die Tätigen, das heißt die Ruhelosen, mehr gegolten. Es gehört deshalb zu den notwendigen Korrekturen, welche man am Charakter der Menschheit vornehmen muss, das beschauliche Element in großem Maße zu verstärken. (Friedrich Nietzsche, Menschliches, Allzumenschliches)
Julian Pörksen hat im Sommer 2011 einen kurzen Spielfilm gedreht, mit dem stutzig machenden Titel Sometimes we sit and think and sometimes we just sit. Der Film lief dann im Februar 2012 bei der Berlinale in der Sektion »Perspektive Deutsches Kino«. Damals war er noch Student der Dramaturgie an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig. Der Film war das Ergebnis eines selbst organisierten Praktikums im Rahmen des Studiums. Das kleine Buch mit dem Titel Verschwende deine Zeit ist eine überarbeitete Version seiner Abschlussarbeit vom Sommer 2012 und liefert sozusagen die Theorie zu diesem Film.
Das unvermeidbare Problem, dass auch ein Plädoyer für das Nichtstun, für die Ereignislosigkeit oder für die nutzlos verschwendete Zeit selbst viel Arbeit und Disziplin erfordert, wenn es überzeugen soll, war Pörksen von Anfang an klar und vielleicht ist das gerade der Witz des ganzen Unternehmens. In einem Programmheft zum Kirschgarten (in einer fast ereignislosen Inszenierung von Luk Perceval am Hamburger Thalia Theater) hat Pörksen über seine Filmarbeit berichtet und am Ende festgestellt: »Eine schöne Paradoxie an dieser Arbeit war, wie viel Planung und Aktivität notwendig war, um einen Untätigen ins Zentrum eines Films zu setzen, wie viel Anstrengungen es bedarf, um der Unterlassung künstlerisch etwas abzugewinnen und ihr im Bewusstsein des Zuschauers Raum zu verschaffen.« Pörksen berichtet dort auch, was ihn überhaupt dazu gebracht hat, sich dermaßen konzentriert und ausdauernd mit dem Thema Nichtstun und Nichtsnutzigkeit zu befassen:
Das Glück winkt denen, die aktiv sind. Freiwillige Untätigkeit hingegen ist mit einem Verbot belegt, sich für Ereignisarmut zu entscheiden, keine Option. Vergangenes Jahr habe ich mir im Theater ein Stück mit dem Schauspieler Peter René Lüdicke angesehen, der mit genau diesem Verbot gespielt hat, indem er eine virtuose halbe Stunde auf der Bühne nichts gemacht hat. Ein Unterlassungskünstler. Für ihn habe ich ein Drehbuch geschrieben, und wir haben gemeinsam einen Film gedreht, der um diese Gedanken kreist: Peter, ein 50-jähriger Mann, reich und aus intakter Familie, zieht in ein Altenheim, um dort für den Rest seiner Tage zu leben. Er ist ein ›freiwilliger Senior‹, der sich in eine Institution begeben hat, die in der öffentlichen Wahrnehmung so etwas wie eine vorletzte Ruhestätte ist, ein Ort zum Sterben, nicht zum Leben. Peter jedoch sitzt, heiter und unproduktiv, bei geschlossenen Vorhängen in seinem Zimmer und macht den ganzen Film über keinerlei Veränderung durch. Stattdessen delegiert er, als Held der Passivität, die Aufgabe einer dramatischen Entwicklung an die Nebenfiguren, die mit seiner Entscheidung und seinem Dasein hadern und sich an immer neuen Deutungen versuchen. Während der Arzt in seinem Verhalten Züge einer Depression zu erkennen glaubt und meint, ihm helfen zu müssen, sieht sein Pfleger in ihm ein Vorbild, einen Aussteiger aus der ermüdeten Gesellschaft. Sein Sohn hingegen sieht darin eine Flucht in die Untätigkeit, die letztendlich einem Suizidversuch gleichkommt, und will ihn retten, ihn zurückholen zur Familie. Eine alte Bewohnerin des Heims verliebt sich schließlich in seine mangelnde Anteilnahme, indem sie genau darin einen Freiraum erkennt, eine wertfreie Zone …
Zu ergänzen wäre vielleicht noch, dass der einzige zusätzliche »Luxus«, den sich der Held dieses Films mit in seine vorletzte Ruhestätte genommen hat, jene »Ultimate Machine« ist, die Pörksen in seinem Buch am Beginn des zweiten Kapitels beschreibt und die keine andere Funktion hat, als sich, wenn man sie einschaltet, sofort wieder auszuschalten. Dieser Vorgang ist grundlegend für die Metaphysik der Zeitverschwendung.
Ein nutzloser Film über das Nichtstun und die Dynamik, die dieses Nichtstun in seiner Umgebung erzeugt. Und jetzt ein kleines, klug kalkuliertes und solide gearbeitetes Buch über die Freuden der Zeitverschwendung und das Ignorieren ökonomischer Selbstverständlichkeiten. Die Lektüre macht Freude, zumindest mir, und lässt einen mit dem beglückenden Gefühl zurück, man wäre Zeuge eines überfälligen Befreiungsprozesses. Pörksen erlaubt sich ein paar einfache Wahrheiten auszusprechen, die immer noch tabuisiert sind, obwohl die meisten Menschen, wenn auch mit schlechtem Gewissen, zumindest gelegentlich danach handeln. Neu sind sie nicht, und es besteht wahrscheinlich auch keine Gefahr, dass sie eines Tages endgültig in Vergessenheit geraten. Aber sie passen als positive Maximen nicht in die Logik der politischen Ökonomie der kreativen Marktgesellschaft, in der rationales Nützlichkeits- und Vorteilsdenken respektive der Privategoismus die Triebfedern allen Handelns sein sollen.
Zeit und Geld sind in dieser Markt- und Leistungsgesellschaft bekanntlich Synonyme, beides darf man nicht verschwenden. Denn an der Zeit bemisst sich die Rationalität jeder ökonomischen Praxis. Die in Relation zum Ergebnis aufgewendete Zeit gibt Aufschluss darüber, ob eine Tätigkeit sinnvoll ist oder nicht. Sie ist nach ökonomischer Auffassung natürlich nur sinnvoll, wenn sie sich rechnet, wenn nicht sofort, dann wenigstens später. Julian Pörksen macht diese scheinbar selbstverständliche Rechnung nicht mit. Er macht die Gegenrechnung auf und versucht, die Notwendigkeit der anderen, dunklen Seite der Ökonomie, die jeder instrumentellen und zweckgerichteten Tätigkeit widersteht, zu erklären. Diese Seite gibt es als negative, als zu überwindende natürlich schon immer, denn wenn es keinen Hang zur Nichtrationalität, zur Verschwendung, zum Exzess und zum Asozialen gäbe, würde jedes zweckmäßige Handeln, jede Selbstdisziplinierung überflüssig sein und ins Leere zielen. Das heißt: All diese schönen Tugenden wie Disziplin, Selbstbestimmung, Optimierung sind nur solange sinnvoll postulierbar, wie es entgegengesetzte Tendenzen gibt, die eingedämmt und in Schach gehalten werden müssen. Wenn Disziplinlosigkeit und Lethargie endgültig abgeschafft wären, wären im selben Augenblick auch ihre Gegenbegriffe sinnlos geworden.
Aber in dem Diskurs, in dem Pörksen sich bewegt, geht es nicht primär um diese Wechselbegrifflichkeit, sondern um eine irritierende Umwertung des Nutzlosen. Die normalerweise nur kritisch gebrauchten Termini werden positiv gewendet. Zeitverschwendung soll nun etwas Wichtiges und Gutes sein. Das erinnert an Kants ästhetische Urteilskraft: Das »interesselose Wohlgefallen« am Schönen, also die Freude an etwas, das für nichts zu gebrauchen ist – eine Freude, die Kant allein der ästhetischen Betrachtung vorbehält. Auch Schiller hat dem »ästhetischen Bildungstrieb«, der uns »von allem, was Zwang heißt, sowohl im Physischen als im Moralischen entbindet«, ein eigenes »fröhliches Reich« zugewiesen, in dem er sich spielerisch jenseits aller Zwecke äußern darf, solange er den Scheincharakter seines Tuns nicht leugnet. Für Pörksen sind Zeitverschwendung, Nutzlosigkeit und Nichtstun jedoch nicht nur ästhetische, sondern auch im täglichen Leben wünschenswerte Positionen.
Ästhetische Positionen außerhalb der Kunst geltend zu machen, gilt aber grundsätzlich als suspekt. Einer der Ersten, die das erfahren mussten, war Dostojewski, der mit der sogenannten Zweckrationalität der politischen Ökonomie explizit auf Kriegsfuß stand und den »Unsinn« dagegensetzte. In den Aufzeichnungen aus dem Kellerloch beschrieb er die Mechanik einer ständigen Vervollkommnung der Menschheit durch konsequenten Vernunftgebrauch als abstoßend und anrüchig. Für den Mann im Kellerloch war die Vorstellung ein Alptraum, alles menschliche Verhalten ließe sich durch rationale Höherentwicklung zwingend und gültig festlegen. Der eigene Vorteil als unbestreitbare Richtschnur allen Handelns erschien ihm als Sackgasse, das Handeln im »wohlverstandenen Eigeninteresse« und die Maxime, sich selbst niemals zu schaden, fand er empirisch falsch und unmenschlich. Solche Maximen hätten langfristig das Ende jeder Art von Überraschung und Unberechenbarkeit zur Folge, also gerade dessen, was menschliche Lebewesen im Unterschied zu Maschinen ausmache. Durch das ökonomische Vorteilsdenken würden die Menschen zu »Drehorgelstiften«, die nichts anderes tun, als zu funktionieren. Es gäbe keine Wahlmöglichkeiten mehr und keine Freiheit, wenn im Fortschreiten der Vernunft ein für alle Mal geklärt würde, was in jeder denkbaren Situation das Vorteilhafteste für uns wäre. Dostojewski war vor 150 Jahren wahrscheinlich einer der Ersten, die diese logische Kehrseite des rationalen Vorteilsdenkens, des planenden Kalküls, beschrieben haben. Er zog dann sozusagen die Notbremse, indem er den größten Vorteil ausgerechnet in der Nicht-Rationalität, im Ignorieren des Kalküls, im Unsinn zu finden meinte:
Nach unserem eigenen, uneingeschränkten und freien Wollen, nach unserer allerausgefallensten Laune zu leben, die zuweilen bis zur Verrücktheit verschroben sein mag? Das, gerade das ist ja jener übersehene allervorteilhafteste Vorteil, der sich nicht klassifizieren läßt, und durch den alle Systeme und ökonomischen Theorien fortwährend zum Teufel gehen.
Dostojewskis These, dass Menschen nur dann beweisen können, »dass sie keine Drehorgelstifte sind, wenn sie nicht tun, was man von ihnen erwartet, sondern etwas Unsinniges«, und dass darin ihre ganze Kraft besteht, würde, wenn man sie ernst nimmt, die gesamte politische Ökonomie torpedieren, die bis heute bei den Marktteilnehmern Nützlichkeit und Effektivität des Handeln als oberste Maximen unterstellen muss.
Hier, im St. Petersburger Kellerloch, kommt ein Gedanke zur Welt, der Nietzsche so begeisterte, dass er Dostojewski »zum Glücksfall seines Lebens« erklärte. Und in dieser Tradition bewegt sich natürlich auch Batailles Theorie der Verschwendung.
Vor diesem Hintergrund stellt Julian Pörksen zwei Modelle der Subjektkonstitution, also dessen, was uns zu Menschen macht, gegenüber: das bei uns immer noch vorrangig geltende »zeitökonomische Modell«, das unsere Autonomie betont und davon ausgeht, dass wir durch gegenständliche Tätigkeit die Welt nach unserem Willen gestalten und dadurch so etwas wie eine Identität erlangen. Das heißt, Selbstbewusstsein konstituiert sich als Bewusstsein unserer Wirksamkeit in der Welt. »Das Wesen des Ich besteht in seiner Tätigkeit.« (Johann Gottlieb Fichte) Und das entgegengesetzte Modell, das Pörksen bei Bataille findet, dass wir uns erst dann selber als selbstbewusste Wesen begreifen können, wenn wir auf gegenständliche Tätigkeit verzichten, wenn wir uns der Weltaneignung entziehen, wenn wir uns und anderes nicht bestimmen, sondern uns bestimmen lassen. Batailles Konsequenz (in Die Aufhebung der Ökonomie): »Selbstbewußtsein […] heißt ein Bewußtsein, das nichts mehr zum Gegenstand hat.«
Pörksen macht das zweite Modell stark, er setzt es mit Bataille gegen die Produktionslogik der »vita activa« und entwickelt einen qualitativen Zeitbegriff, mit dem sich zumindest temporär ein anderer Lebensmodus realisieren lässt: Faulheit, Nichtstun, Trödeln, Schwänzen, Flanieren, Warten auf nichts Bestimmtes – alles, was zur Zeitverschwendung geeignet ist, alles Unproduktive schafft Identität. Der Zustand der ästhetischen Kontemplation, der nicht auf das Reich des ästhetischen Scheins beschränkt bleibt, ist entscheidend: Passivität wird als Bedingung der Subjektidentität und nicht, wie im ersten Modell, als deren Verhinderung gesehen.
Der einzige lebende Philosoph, der etwas Ähnliches vertritt, ist Boris Groys, der wie Dostojewski aus St. Petersburg stammt und schon vor Jahren bei einem Gespräch über Dostojewski, Bachtin und Bulgakow folgendes Subjekt- oder Seelenmodell vorstellte (abgedruckt in Einbruch der Realität – Politik und Verbrechen):
Ich würde sagen, dass die Seele allgemein ein ruhiges Element ist. Das Einzige, was der Mensch tun möchte, ist sich entspannen, sonst nichts. […] Man muss sich ein Seelenmodell wie das folgende vorstellen: Man befindet sich ursprünglich im Gleichgewicht, wird aus diesem Gleichgewicht hinausgeworfen, tut etwas, um es wiederherzustellen – und dieses Ritual wiederholt sich ständig. Das ganze Leben ist mehr Inszenierung dieser Anstrengung als die Anstrengung selbst.
Ob das, was hier beschrieben wird, ein Modell der »russischen Seele« ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall widerspricht es zutiefst der Produktionslogik westlichen Denkens, in der die Seele ein unruhiges Element ist, das nur zur Wiederherstellung der Unruhe oder zur Regeneration der Arbeitskraft gelegentlich eine Pause einlegen muss. Auffällig ist, dass weder Boris Groys noch Julian Pörksen selber diesen von ihnen propagierten Gegenmodellen zu folgen scheinen. Groys ist als unruhiger Künstler, Denker, Schriftsteller und Kurator ein höchst produktiver intellektueller Arbeiter, und Julian Pörksen habe ich als gut organisierten, zuverlässigen persönlichen Mitarbeiter von Christoph Schlingensief kennengelernt, bevor er sein Studium in Leipzig begann. Von einem besonderen Hang zur Zeitverschwendung haben die Lehrenden, ich war einer von ihnen, während seines Studiums nichts bemerkt.
Pörksen und Groys scheinen selbst ein anderes Subjekt- oder Lebensmodell zu verfolgen als das von ihnen vertretene und propagierte. Es ist aber auch nicht das ökonomische Autonomiemodell. De facto vertreten sie beide Modelle gleichzeitig, obwohl diese sich gegenseitig ausschließen. Sie wollen gleichermaßen passiv und aktiv sein. Das ist ein Widerspruch, aber vielleicht ein unvermeidbarer. Denn wenn sich überhaupt so etwas wie ein Subjekt, ein lebendiges selbstbewusstes Wesen konstituieren soll, ist dies nur im Konflikt, im Widerspruch zwischen diesen beiden Modellen möglich, weil erstens Autonomie und Determination Wechselbegriffe sind, die darauf verweisen, dass das eine nicht ohne das andere möglich ist, und dadurch zweitens beide Subjektmodelle interdependent und somit nicht substituierbar sind. Oder einfacher gesagt: Selber bestimmen und sich bestimmen lassen sind zwei gegensätzliche Arten des Weltbezugs, die sich gegenseitig bedingen. Keins geht ohne das andere. Das Subjekt konstituiert sich im notwendigen Selbstwiderspruch.
Dass beide Seiten notwendig sind, wissen auch Groys und Pörksen, sonst würden beide nicht so viel arbeiten. Warum setzen sie sich dann so vehement für Faulheit und Verschwendung ein, und warum wirkt das so befreiend? Ganz einfach: Unsere Gesellschaft hat die eine Seite hypertrophiert und versucht, der anderen Seite die Berechtigung zu nehmen. Es handelt sich bei ihren Aufrufen zur Zeitverschwendung oder zum Nichtstun um eine strategische Intervention zugunsten dessen, was die Leistungs- und Kreativitätsgesellschaft sträflich vernachlässigt. Für Pörksen wäre das Theater für solche Strategien der ideale Ort, denn es ist eine der Zeitverschwendung gewidmete Institution, hier wird mit großem Einsatz jenseits aller rationalen Zeitökonomie etwas hergestellt, das kein vorgängiges Interesse bedient und keinen Nutzen kalkulieren muss, und die Zuschauer gucken sich das an, ohne einen bestimmten Nutzen davon zu erwarten.
Boris Groys antwortete auf die Frage, ob sein Modell nicht ein bisschen einseitig die Kontemplation ins Zentrum stelle: »Da stimme ich zu. Aber man kann sicher sein, dass andere aktiv sind – und mit der Zeit noch aktiver werden. Auf Aktivität und Kreativität ist immer Verlass.«
Wir haben es also hier gar nicht nötig, uns an Karl Marx’ schwer zu bestreitende Einsicht zu erinnern, dass eine Nation, die auch nur wenige Wochen die Arbeit einstellen und sich der Faulheit ergeben würde, eine tote Nation wäre. Dass so etwas wirklich passiert, ist in der westlichen Zivilisation nicht zu erwarten. Und deshalb, so Groys weiter, »kann man sich auch entspannen in Bezug auf seine eigene Positionierung in der Welt. Die anderen werden dich schon positionieren, auch wenn du das nicht willst. Also, man braucht sich darum nicht zu kümmern.« Vor diesem Hintergrund kann man dann auch die folgenden Äußerungen von Groys nachvollziehen, die ich gerne vollständig wiedergeben möchte:
Wir müssen uns nicht sorgen, dass nichts mehr kreiert wird, die ganze Menschheit kreiert, alle sind vital, alle sind voller Kraft. Wir müssen daran arbeiten, keine Kraft zu haben, nichts zu tun, nichts zu produzieren, […] um eine Position zu bewahren, die zentral für eine Zivilisation und Kultur bleibt, in der nur eines gefordert wird: aktiv zu sein. Diese unglaubliche Aktivität, dass alle Menschen sich zeigen wollen und permanent etwas tun wollen, warum geschieht das? Weil die Menschen denken, dass jemand sie beobachtet und das, was sie tun, gut findet. Lange Zeit war das Gott. Er saß im Himmel und schaute sie an, und dieses Gefühl hat sie vorangebracht, deswegen haben sie sich so angestrengt. Jetzt ist der Gott tot. Was tun? Jetzt müssen wir diese kontemplative Position selbst produzieren, damit die Aktivität weitergeht. Die Aktivität geht weiter, weil Duchamp, Warhol und Schlingensief die Menschen beobachten – anstelle Gottes. Wenn das nicht so wäre, würde niemand etwas tun. Sie vertreten den unbewegten Gott, der alles bewegt.
Dieser metaphysische Aufruf, der Künstler und kontemplative Nichtstuer zu »unbewegten Bewegern« erklärt, die an die Stelle Gottes treten sollen, begreift sich als Rettungsversuch der Aktivität. Pörksens Film über das reine Nichtstun illustriert das ganz gut: Wenn einer sich hinsetzt und nichts mehr tut, beginnen alle anderen, wie verrückt aktiv zu werden, wir brauchen uns um die Aktivität keine Sorgen zu machen. Könnte das aber auch heißen: Zeitverschwendung, Nichtstun bis hin zur Asozialität sind temporär notwendige Zustände, auf die sich das Subjekt selbstbewusst und angstfrei einlassen sollte, wenn es nicht verkümmern will? Es sieht ganz so aus. Aber diese außerökonomischen Erfahrungsweisen der Kontemplation gedeihen nur, wenn sie nicht ihrerseits funktionalisiert und in den ökonomischen Prozess eingespeist werden. Der Zwang zur Selbstoptimierung, das heißt zur Durchökonomisierung der gesamten Lebenszeit, ist eine Sackgasse, selbst für die Ökonomie.