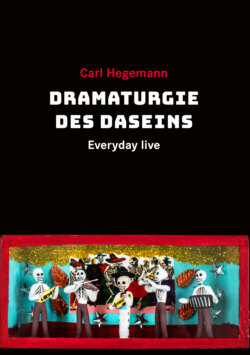Читать книгу Dramaturgie des Daseins - Carl Hegemann - Страница 31
Leben als Selbstwiderspruch
ОглавлениеHölderlin formuliert den Höhe- und Endpunkt der Philosophie und streicht ihn durch
Am Tage, da die schöne Welt für uns
Begann, begann für uns die Dürftigkeit
Des Lebens und wir tauschten das Bewußtsein
Für unsre Reinigkeit und Freiheit ein. –
Der reine leidensfreie Geist befaßt
Sich mit dem Stoffe nicht, ist aber auch
Sich keines Dings und seiner nicht bewußt,
Für ihn ist keine Welt, denn außer ihm
Ist nichts. – Doch, was ich sag’, ist nur Gedanke. –
Nun fülen wir die Schranken unsers Wesens
Und die gehemmte Kraft sträubt ungeduldig
Sich gegen ihre Fesseln, und es sehnt der Geist
Zum ungetrübten Aether sich zurück.
Doch ist in uns auch wieder etwas, das
Die Fesseln gern behält, denn würd in uns
Das Göttliche von keinem Widerstande
Beschränkt – wir fühlten uns und andre nicht.
Sich aber nicht zu fühlen, ist der Tod,
Von nichts zu wissen, und vernichtet seyn
Ist Eins für uns. – Wie sollten wir den Trieb
Unendlich fortzuschreiten, uns zu läutern,
Uns zu veredlen, zu befrein, verläugnen?
Das wäre thierisch. Doch wir sollten auch
Des Triebs, beschränkt zu werden, zu empfangen,
Nicht stolz uns überheben, denn es wäre
Nicht menschlich, und wir tödteten uns selbst.
Den Widerstreit der Triebe, deren keiner
Entbehrlich ist, vereiniget die Liebe.
Das ist ein Teil aus der Fragment gebliebenen, metrischen Fassung des Hyperion aus dem Jahre 1795. Hölderlin entwickelt hier unter dem Eindruck von Fichtes Vorlesungen in Jena die spekulative Grundlage seines ganzen poetischen Schaffens, die vielleicht auch der Kulminationspunkt der gesamten klassischen deutschen Philosophie ist. Schiller hat ihm später geraten, er solle in seinem Roman alles Philosophische weglassen, es ginge in der Poesie um das Konkrete und nicht um solche abstrakten Überlegungen. Diese Stellen sind dann auch tatsächlich in der endgültigen Fassung des Hyperion nicht mehr vorgekommen. Auch in allen Vorwörtern, die Hölderlin geschrieben hat, um das Prinzip seines Hyperion zu erklären, hat er unter dem Einfluss von Schiller und Goethe die theoretischen Erklärungen größtenteils weggestrichen. Und dann hat Schiller für seine Briefe zur ästhetischen Erziehung des Menschen genau die theoretischen Überlegungen verwendet, von deren Veröffentlichung er Hölderlin vorher selbst abgeraten hatte. Hölderlin muss das ziemlich aufgeregt haben. Er kündigte an, im Gegenzug Neue Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen unter seinem Namen veröffentlichen zu wollen. Das wurde aber allgemein als Arroganz oder Konkurrenzverhalten vonseiten des Jüngeren empfunden, keiner hat sich dafür interessiert. Nach 150 Jahren ist die Forschung so weit, dass Hölderlin als die entscheidende Figur für diesen Kulminationspunkt der Geistesgeschichte gilt – wie man zum Beispiel bei Violetta Waibel nachlesen kann (in Hölderlin und Fichte 1794–1800).
Im Grunde genommen steht alles schon im ersten Satz. »Am Tage, da die schöne Welt für uns begann« – für uns begann! Die Welt hat also schon vorher begonnen, aber irgendwann haben wir die Augen aufgeschlagen und die Welt wahrgenommen. Und zwar nicht irgendeine Welt, sondern die schöne, also gerade nicht-dürftige Welt. Trotzdem begann an eben diesem Tag »für uns die Dürftigkeit des Lebens«, zack, da haben wir schon den ganzen Schlamassel. Schönheit heißt begriffslose Vollkommenheit – also dass man etwas wahrnimmt oder etwas kreiert, von dem man sich nicht vorstellen kann, dass man es noch besser machen könnte. Und dieses Vollkommene ist schon im ersten Satz unmittelbar verknüpft mit der Dürftigkeit, also mit dem Mangel. In dem Moment, wo die Welt für uns begann, wo wir aus dem Paradies vertrieben wurden, kamen wir zum Bewusstsein und die ganze Reinheit, Harmonie und Freiheit des paradiesischen Zustands gingen flöten. Das kann man in den nächsten Zeilen auch bestätigt finden.
»Der reine leidensfreie Geist befaßt sich mit dem Stoffe nicht, ist aber auch sich keines Dings und seiner nicht bewußt.« Leidensfreiheit, Nichtdürftigkeit, Reinheit gibt es nur bewusstlos. Auch Kleists Prinz von Homburg spricht von dem schönen Jenseits, von dem behauptet wird, dass auch dort eine Sonne scheint »Und über buntre Felder noch, als hier«. Und dann sagt er diesen Satz: »Ich glaubs; nur schade, daß das Auge modert, das diese Herrlichkeit erblicken soll.« Diese Herrlichkeit des Jenseits ist leider für uns nicht erfahrbar. Erlösung ist möglich, sagt Giorgio Agamben, aber nicht für uns. Denn die Erlösung gibt es zwar im Tod, aber wir selbst haben nichts mehr davon. Denn wir sind dort nicht nur von allen Leiden, sondern auch von uns selbst erlöst. Das ist – auch wenn das erstmal so platt klingt wie in einem Kitschroman – die Tragik des Lebens. Und das ist die Grundlage der deutschen Philosophie nach der Französischen Revolution – da, wo sie sich wirklich entfaltet hat und nicht von Hegel schon wieder in Richtung eines absoluten Idealismus glattgebügelt worden ist, der am Ende beim absoluten Begriff landet und mit der Identität von Identität und Nichtidentität zum Stillstand eines geschlossenen Systems führt. Diese Absolutheit gibt es bei Hölderlin gerade nicht. Wir können die Schönheit erfahren nur in Verbindung mit Dürftigkeit, mit Mangel, mit Schrecken, weil wir ohne Dürftigkeit bewusstlos wären. »Der reine leidensfreie Geist befaßt sich mit dem Stoffe nicht. […] Für ihn ist keine Welt, denn außer ihm ist nichts.« Der leidensfreie Geist ist eins mit allem, deshalb gibt es in ihm nichts zu unterscheiden.
Und dann kommt gleich dieser kleine wichtige Satz: »Doch, was ich sag’, ist nur Gedanke«. Das verweist darauf, dass alles, was Hölderlin bis hierhin gemacht hat, ein Gedankenspiel ist, jenseits unserer gewöhnlichen Erfahrung. Diese philosophische Spekulation ermöglicht uns aber zu verstehen, was jetzt im weiteren Text entwickelt wird: die Beschreibung unserer Lebensbedingungen als Künstler und Menschen. In dieser Beschreibung finden wir den Kern der spekulativen Philosophie und ihrer transzendentalen Fragestellungen: Wie ist der Mensch strukturell verfasst? Was ist an ihm spezifisch menschlich? Welche Bedingungen oder Voraussetzungen sind nötig, damit wir uns als menschliche Wesen begreifen oder, wie die Philosophen sagen, überhaupt erst als Subjekte konstituieren können? Das sind im Grunde die Fragen Kants, und auch Kant hatte schon ähnliche Vorstellungen: Die Menschwerdung des Affen, die Vertreibung aus dem Paradies beginnt mit der Erfahrung von Mangel, weil wir einer äußeren Welt gegenüberstehen und nicht mehr mit ihr identisch sind. Dieser Prozess der Trennung von Mensch und Welt ist der Zivilisations- und Kulturprozess. Kant hatte, das will ich noch kurz in Parenthese anmerken, einen Gegenspieler in Polen, den Philosophen Salomon Maimon. Dessen Polemik gegen Kant kulminierte in dem Satz: »Ich denke von meinen täglichen Verrichtungen her.« Und dieses anschlussfähige Denken vermisste er bei Kant, für den Philosophie eine autonome und abgehobene Sportart zu sein schien.
Also, spekulative Philosophie ist schön und gut, aber solange wir mit unseren philosophischen Abstraktionen nicht an unserem konkreten Alltag andocken können, kann uns die ganze Philosophie gestohlen bleiben.
Diese Beziehung auf die täglichen Verrichtungen gelingt Hölderlin im Fortgang der metrischen Fassung des Hyperion aber, anders als Kant, exemplarisch: »Nun fülen wir die Schranken unsers Wesens und die gehemmte Kraft sträubt ungeduldig sich gegen ihre Fesseln.« Wir wollen ins Paradies zurück. Wir wollen diese Beschränkung und diese Dürftigkeit beseitigen. Und das geschieht normalerweise durch Arbeit, mit der man die verlorengegangene Harmonie mit der Welt wiederherzustellen trachtet – und sei es noch so partiell. Arbeit ist das Medium zum Überwinden von Schranken, Fesseln und Hemmnissen. Das weiß jeder aus seinem Alltag, es zeigt sich direkt oder indirekt in so gut wie allem, was wir tun.
Denn: »Es sehnt der Geist zum ungetrübten Aether sich zurück«. Man mag sich darüber im Klaren sein oder nicht, wenn man überhaupt arbeitet, will man Probleme, will man Dürftigkeit beseitigen und damit zielt man natürlich – wie seltsam sich das auch anhört – auf die Abschaffung der Welt. Denn die gibt es ja, wie die Philosophie lehrt, für uns nur als dürftige, das heißt als uns nicht wirklich entsprechende, als widerständige. Der »ungetrübte Aether«, also die unterschiedslose Einheit von Ich und Welt, ist für uns nicht erfahrbar.
Deshalb kommt jetzt die Gegenthese: »Doch ist in uns auch wieder etwas, das die Fesseln gern behält, denn würd in uns das Göttliche« (das All-Eine, das Vollkommene …) »von keinem Widerstande beschränkt – wir fühlten uns und andre nicht. Sich aber nicht zu fühlen, ist der Tod, von nichts zu wissen, und vernichtet seyn ist Eins für uns.« Das ist schon die ganze zentrale und folgenreiche These. Und damit tut sich der konstitutive Selbstwiderspruch unserer Erfahrungswelt auf, der sogar den gewöhnlichen Alltag durchzieht. Wir streben zum einen danach, durch Arbeit, durch Verbesserung der Verhältnisse die Widersprüche aufzulösen, um nicht mehr zu leiden und uns nicht mehr durch die äußere Welt bestimmen zu lassen. Zum anderen stürzen wir uns in den Widerspruch und akzeptieren den Mangel und die Fesseln und behalten sie sogar »gern«, lassen uns also bestimmen und genießen das auch noch. Es gibt einen Selbstwiderspruch, den man nicht beseitigen kann, ohne unsere Welt oder die Welt für uns zu beseitigen, zumindest wenn man dieses theorische Modell ernst nimmt. Das ist nicht trivial, wie meistens beispielsweise die Selbstverständigungsprozesse in der analytischen Philosophie, sondern das hat weitreichende Konsequenzen und ist auch heute noch alles andere als selbstverständlich: Oder ist es etwa selbstverständlich, dass wir an der erfolgreichen Realisierung unserer Pläne arbeiten und sie dann gleichzeitig wieder durchkreuzen? Aber wenn diese Pläne wirklich durchschlagenden und dauerhaften Erfolg hätten, dann würden wir in den Bereich der Gegenstandslosigkeit, der Bewusstlosigkeit kommen, schneller als wir es uns vorstellen könnten. Und diese Behauptung betrifft eben nicht einen theoretischen Ansatz, sondern unmittelbar unsere Lebenspraxis.
Und jetzt kommt die Synthese: »Wie sollten wir den Trieb unendlich fortzuschreiten, uns zu läutern, uns zu veredlen, zu befrein, verläugnen? Das wäre thierisch.« Rückfall ins Tierreich: Wenn wir nicht daran arbeiten würden, unsere Verhältnisse zu verbessern, wäre das Regression. Dieser Trieb markiert also die Seite des Fortschritts.
»Doch wir sollten auch des Triebs, beschränkt zu werden, zu empfangen, nicht stolz uns überheben, denn es wäre nicht menschlich, und wir tödteten uns selbst.« In diesem Satz, der dem vorherigen entgegengesetzt ist, haben wir tatsächlich etwas, wovon man jetzt platt sagen könnte: Das haben liberale und marxistische Theorien übersehen. Wir sind eben nicht nur die Menschen, die den Fortschritt herbeiführen, sondern auch die, die im Sinne einer christlichen Metanoia den Wechsel zulassen. Das heißt, wir bestimmen nicht nur, wir sind nicht nur autonome Wesen. Wir müssen auch akzeptieren, dass wir bestimmt werden durch irgendetwas, das wir nicht im Griff haben. Das ist ja die ursprüngliche Bedeutung von Leiden, sich als von außen bestimmt zu erfahren, als passiv. Es gibt eine Instanz, die stärker ist als wir. Und wenn meine StudentInnen das nicht glauben wollen, wenn sie sagen, wieso, wir haben doch die Naturwissenschaft, wir haben doch alles durchschaut, dann antworte ich: Solange man über seine Geburt nicht bestimmen kann, ist man fremdbestimmt. Damit verwandelt sich das empirische Problem, dass wir nie alles im Griff haben können, auch gleich in ein logisches – in eine strukturelle Lebensnotwendigkeit.
Und jetzt kommt die umstrittene nächste Wendung in dieser Geschichte. Es gibt nämlich doch eine Auflösung dieses konstitutiven Selbstwiderspruchs, die wir bei lebendigem Leibe erfahren können. Das wird am Ende dieser Hyperion-Passage mit folgender Behauptung ausgesprochen: »Den Widerstreit der Triebe, deren keiner entbehrlich ist, vereiniget die Liebe.« Es soll also einen Zustand geben, Hölderlin nennt ihn hier Liebe, in dem sich der konstitutive Widerspruch unseres Daseins auflöst. Man kann sich das vielleicht an der Liebe von Romeo und Julia klar machen, wenn Julia staunend über ihre Liebe sagt: »Je mehr ich gebe, je mehr auch hab ich.« Oder: »Ich wünsche nur, was ich bereits besitze. So grenzenlos ist meine Liebe«. In der Liebe (oder vielleicht eher im Liebesakt) hat man offenbar – und sei es auch nur für Augenblicke – die Empfindung, dass dieser Selbstwiderspruch auf einmal stillgestellt ist, weil kein Unterschied zwischen Fessel und Freiheit, zwischen Mangel und Überfluss mehr da zu sein scheint. Allerdings ist es für manche Interpreten nicht nachvollziehbar, dass Hölderlin der Liebe, die sich ja wesentlich auch als Sehnsucht und Zweifel äußert, diese Auflösung allen Widerstreits zutraut. Müsste man da nicht eher Schönheit hinschreiben, fragen sie und verweisen auf den »ästhetischen Schein«, in dem wir das Widersprüchliche spielerisch auflösen können. Schiller hat genau das in seinen Briefen Über die ästhetische Erziehung des Menschen behauptet. Und auch Hölderlin hat es an anderer Stelle, in einem ebenfalls verworfenen Vorwort zur vorletzten Fassung des Hyperion, so gesehen:
Weder unser Wissen noch unser Handeln gelangt in irgendeiner Periode des Daseins dahin, wo aller Widerstreit aufhört, wo alles eins ist; die bestimmte Linie vereinigt sich mit der unbestimmten nur in unendlicher Annäherung. Wir hätten auch keine Ahnung von jenem unendlichen Frieden, von jenem Sein, im einzigen Sinne des Worts, wir strebten gar nicht, die Natur mit uns zu vereinigen, wir dächten und wir handelten nicht, es wäre überhaupt gar nichts (für uns), wir wären selbst nichts (für uns), wenn nicht dennoch jene unendliche Vereinigung, jenes Sein, im einzigen Sinne des Worts vorhanden wäre. Es ist vorhanden – als Schönheit.
Die Schönheit ist das für uns erfahrbare Vollkommene, das wir, wie Schiller dann sagt, als »schönen Schein«, also als nur Gespieltes erfahren können. Und wenn wir diese Erfahrung der Schönheit im Spiel nicht hätten, dann würden wir, so das Argument, auch gar nicht danach streben, so etwas wie vollkommene Vereinigung zu erreichen. Wenn wir nicht irgendein Restgefühl von Vollkommenheit hätten, dann würden wir überhaupt nicht arbeiten, um Dinge zu verbessern. Wir würden uns einfach mit den schrecklichen Verhältnissen zufriedengeben, weil wir die Vorstellung einer Alternative gar nicht entwickeln könnten.
Was wir hier bei Hölderlin vor uns haben, ist so etwas wie die Vollendung der Erkenntnistheorie in ihrem unvermeidlichen Übergang zur widersprüchlichen ästhetischen Praxis. Es ist das Grundmodell einer sich selbst überschreitenden Theorie, deren Entwicklung man dann mindestens bis zu Nietzsches Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik verfolgen kann, wo sie als dionysisch/apollinisches Tragödienmodell wieder neue Facetten entwickelt. Man kann jetzt begriffsgeschichtlich verfolgen, was aus diesen beiden Trieben wird. Schon bei Fichte, Hölderlins Lehrer in Jena, findet man sie in der Dialektik von Selbstbestimmung und Fremdbestimmung: »Das Ich setzt sich als bestimmt durch das Nicht-Ich«, und »das Ich setzt sich als bestimmend das Nicht-Ich«. Beide Seiten sind notwendig interdependent und gegensätzlich, ihr Widerspruch kann theoretisch nicht aufgelöst werden. Auch bei Schiller gibt es natürlich eine Fußnote in seinen Briefen Über die ästhetische Erziehung des Menschen, wo er zugibt, dass er das alles aus Fichtes Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre (1794/95) hat. Bei ihm taucht dieser Gegensatz in der Differenz von »Formtrieb« und »Stofftrieb« wieder auf. Der Stofftrieb ist der Trieb, sich bestimmen zu lassen von etwas, über das man keine Macht hat. Und der Formtrieb zielt umgekehrt darauf ab, das Material nach den eigenen Vorstellungen zu modeln, es eben zu formen. Die Form wird übrigens oft und auch schon bei Schiller mit dem Tod in Verbindung gebracht, weil alles Geformte festgelegt und nicht mehr lebendig ist. Der Formtrieb generiert die ein für alle Mal gültige Idee, nach der ich die Dinge umgestalte, etwas, das als Realisiertes aber nur mit Tod enden kann. Der Stofftrieb hingegen wird mit der Lebendigkeit assoziiert, also mit etwas, das sich einfach so, spontan entfaltet. Das ist ganz wichtig nicht nur für die ästhetische Theoriebildung, sondern auch für das Leben. Man kann sich mit diesem Modell nicht nur erklären, wie sich Bewusstsein im Widerspruch konstituiert, sondern auch, wie diese merkwürdige Widersprüchlichkeit in unserem alltäglichen Verhalten zustande kommt. Ein permanenter und unauflösbarer performativer Selbstwiderspruch erweist sich als konstitutiv für die Erfahrungs- und Handlungsfähigkeit lebendiger Menschen. Die paradoxe Aufgabe, die uns am Leben hält, lautet, dass wir in zwei verschiedene Richtungen arbeiten müssen, die sich eigentlich gegenseitig ausschließen. Man könnte sagen, der Fehler jeder Kunst- und Lebenspraxis, die scheitert, ist, dass sie entweder nur in die eine Richtung geht oder nur in die andere. Der dionysische Barbar bei Nietzsche ergibt sich einfach dem Rausch, also ausschließlich dem Stofftrieb, und ist dann nicht mehr in der Lage, eigenständig zu gestalten, auch wenn er die Einheit oder Vereinigung, von der oben die Rede war, vielleicht sogar auf krude Art erreicht – nämlich im Vollsuff, vollkommen glücklich in einer Pfütze liegend. Umgekehrt merkt der, der ausschließlich vom Trieb ausgeht zu formen und zu gestalten und dadurch dem Paradies näher zu kommen, vielleicht irgendwann, dass er seine eigene Lebendigkeit eingebüßt hat und stattdessen in einem formalistischen toten Normensystem krepiert, dass er seine lebendigen Impulse, die nicht selbstbestimmt sind, die keine Form sind, unterdrückt hat und sich dadurch von dem Leben als Stofftrieb, als Entfaltung der unabhängig von ihm vorhandenen Lebendigkeit abgelöst hat. Das sind, grob gesagt, die beiden Alternativen verfehlten Daseins (wenn es nicht noch eine dritte gibt, die man vielleicht als Indifferenz bezeichnen könnte). Dabei scheint es keine Frage zu sein, dass es in unserer Gegenwart der Stofftrieb ist, der zu kurz kommt. Das Ungeformte, das uns lebendig macht, wird bedroht von der toten Form. Das Rationale vergisst, dass es auf »Stoff« angewiesen ist, ohne den es leerläuft. »Denn das ist das tragische bei uns, daß wir ganz stille in irgend einem Behälter eingepakt vom Reiche der Lebendigen hinweggehn, nicht daß wir in Flammen verzehrt die Flamme büßen, die wir nicht zu bändigen vermochten«, schrieb Hölderlin bereits vor 220 Jahren an seinen Freund Casimir Ulrich Boehlendorff.