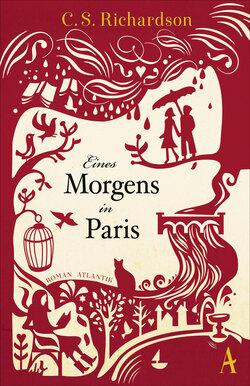Читать книгу Eines Morgens in Paris - Charles Scott Richardson - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление
Nachdem er Beauvais verlassen hatte, sammelte sich der Dezemberwind und schlängelte sich in das 4. Pariser Arrondissement. Ein Junge stand fröstelnd in einem engen Durchgang, neben ihm kauerte sein Großvater.
Konzentrier dich, sagte der alte Mann.
Henri Fournier würde in einem Monat zehn Jahre alt werden. Er stand mit beiden Füßen auf einem aufgeschlagenen Buch, und seine Brille rutschte ihm ständig von der Nase.
Breite die Arme aus, Henri.
Das Buch war in eine Tierhaut gebunden, die, blutorangenrot gefärbt, zu den Kanten hin schon seit langem durch den Schweiß vieler Hände nachgedunkelt war. Der Deckel wies eine Blindprägung auf: eine Raute, die vier Ecken mit Nadelstichen markiert. In der Mitte der Raute war ein Paar exotischer Pantoffeln mit aufwärts gerollter Spitze in das Leder geprägt. Die Verzierung war verblasst, durch das Alter abgeflacht, aber sie war noch immer auszumachen, wenn man sie schräg ins Licht hielt. Aufgeschlagen war das Buch breit genug für Henris Füße, einen pro Seite.
Der Großvater hielt das Buch – das in einer Schriftart gesetzt war, die der alte Mann in siebzig Jahren nirgendwo auf den Quais gesehen hatte – für magisch. Henris Vater, Eigentümer des Bücherstands der Familie, wünschte sich, das Ding würde endlich den Würmern zum Opfer fallen; schon viel zu lange hatte es Platz weggenommen, ohne einen Centime einzubringen. Monsieur Fournier erinnerte seinen Sohn gern daran, dass heutzutage niemand mehr an das Unsichtbare glaubte, und je weniger Magie, desto besser. Woraufhin Henri seinem Großvater aber umso mehr glaubte.
Weiter auseinander, Henri, Handflächen nach oben. Die Finger spreizen.
Der Fournier’sche Bücherstand enthielt zu viel Lyrik, vermischte Philosophie mit Mechanik und versteckte Reiseberichte zwischen der schönen Literatur. Er bot ein Sortiment von zerfledderten Partituren, alten Nummern von illustrierten Zeitschriften und für Reisende gedachten Bildkarten: Mademoiselles im Zehnerpack. Der Stand war in einem besonderen Grünton gestrichen, der jedem Buchhändler auf beiden Ufern der Seine vertraut war. Sie behaupteten, der Lack sei eine mysteriöse Fournier’sche Mixtur, die, mit Sicherheit feuergefährlich, je nach Jahres- und Tageszeit anders leuchtete. Als sei der Stand in der Lage, sein eigenes Licht zu produzieren: lindgrün frühmorgens, smaragden am Mittag, moosgrün gegen Abend.
Wenn man sich auf die Zehenspitzen stellte, konnte man über den Stand wegsehen und einen Blick auf den Pont des Arts erhaschen.
Jetzt nicht bewegen, mein Junge. Mach die Augen zu.
Henri runzelte sein Gesicht; Sterne schwammen hinter seinen Lidern. Der Alte flüsterte ihm ins Ohr.
Spürst du etwas?
Ich glaube nicht, Großvater.
Deine Füße, Henri. Sind sie genau ausgerichtet?
Der Junge kniff die Augen hinter seinen Brillengläsern zusammen. Ich kann sie nicht sehen.
Sei dir sicher, Henri. Ohne Präzision sind wir –?
Verschwommen und verloren, Großvater.
Exakt. Jetzt still. Keine Grimassen.
Der Großvater beugte sich tief hinunter und überprüfte die Position von Henris Füßen. Links auf dem Verso, rechts auf dem Recto, murmelte er und tippte gegen die Spitze des rechten Stiefels des Jungen. Henri ließ den Fuß vorsichtig zurückgleiten, um nicht über die dicken Seiten zu reiben.
Vorsichtig, Junge. Und jetzt?
Henri öffnete ein Auge. Nichts, Großvater.
Der alte Mann richtete sich ächzend auf. Henri senkte die Arme und atmete laut aus. Seine Mutter, die von der Fournier’schen Wohnung im dritten Stock aus zugeschaut hatte, rief zu Henri hinunter.
Genug, junger Mann. Es gibt schon so mehr als genug Fourniers in diesem gottverlassenen Buchgewerbe. Keine Spielchen mehr, ihr beiden. Kommt rauf zum Abendessen, bevor ihr erfriert.
Ab mit dir, sagte der Großvater. Wir versuchen es nächsten Sommer noch mal.
Der sommerliche Wolkenbruch hatte sich zu einem feinen Nieseln eingeregnet. Die Fournier-Männer zogen los, um die Antiquariatsstände in der Nähe der Universität abzugrasen. Henri, auf halbem Weg zu seinem elften Geburtstag und nach wie vor ohne die bessere Brille, die er eigentlich gebraucht hätte, wurde als Standwache zurückgelassen. Verbliebene Pfützen tröpfelten von der Klappe herunter.
Henri klatschte nach einem Tropfen auf seinem Hinterkopf, rückte dann seinen Hocker vom Stand ab. Vielerlei machte ihm zu schaffen: die Hitze, der Himmel, der sich schon wieder zuzog, die Bücher, die hinter ihm aufquollen, die schimmelnden Bildkarten, das Jucken in seinem Hintern. Er stand auf, setzte sich wieder hin, krümmte sich, kratzte sich, schüttelte seine Beine aus. Er rückte sich die Brille zurecht, schaute die Uferpromenade entlang, flussauf, flussab. Vom Vater und Großvater war nichts zu sehen, ebenso wenig vom Karren zu hören, knarrend unter der Last weiterer Bücher, die kein Mensch kaufen würde. Henri fing an, hin und her zu gehen, vom einen zum anderen Ende des Standes, ließ eine Hand über die Bücher gleiten und die Finger von Rücken zu Rücken hüpfen.
Es war ein Spiel, das Henri, zum großen Ärgernis seines Vaters, von seinem Großvater gelernt hatte, als er noch kaum groß genug gewesen war, um an die Bücher heranzukommen. Nicht gucken, hatte der alte Mann gesagt. Fühle die Bücher. Wenn du meinst, du bist so weit, triff eine Wahl.
Henri tat wie befohlen, zog zuletzt einen schmalen Band aus den Reihen im Stand und hielt ihn sich an die Stirn. Ziel des Spiels war, die Buchdecke zu beschreiben, ohne sie zu sehen.
Das Material, Henri. Was spürst du? Raues Leinen oder feines Leder? Oder beides? Und die Prägung? Blind, farbig oder vergoldet? Du kannst daran riechen, wenn du glaubst, dass es hilft.
Kann man wirklich ein gutes Buch riechen, Großvater?
Natürlich nicht, brauste der alte Mann auf. Der Käufer braucht nichts anderes zu tun, als es in der Hand zu halten. So wie du jetzt. Es in seiner Hand ruhen lassen. Die Finger um den Rücken schmiegen, als sei das Buch ausschließlich für ihn gebunden worden. Den Daumen über die weichen Kanten seiner Seiten gleiten lassen. Wenn er es erst mal in der Hand hält, Henri, dann hast du ihn. Danach kann er so viel daran schnuppern, wie er will.
Henri wählte ein Buch aus und hielt es an die Nase. Ein Hauch Lavendel. Henri stellte sich vor, er stehe in einem Feld von violetten Blumen. Beim Geräusch von klappernden Hufen drehte er sich um. Ein riesiges schwarzes Pferd preschte in vollem Galopp an ihm vorbei, der Reiter dicht über die Mähne gebeugt, in einer Hand ein schweres Schwert. Henri sah das auf dem Rücken des Reiters prangende Symbol eines Kreuzritters. In der Ferne schwelte eine belagerte Burg.
Henri dachte an Violett.
Er öffnete die Augen. Der Bezug war aus Kalbsleder, so schwarz wie Teer. Die Prägung auf den Deckeln war aufwendig: winzige Blumen in Blüte, ein Gewinde von Stängeln und Blättern, das vom Vorderdeckel über den Rücken auf den Hinterdeckel floss. Geprägt war der Titel mit – jetzt durch Feuchtigkeit fleckigem – Blattkupfer. Henri schnupperte noch einmal. Es roch leicht nach Rauch.
Sein Großvater hätte den Kopf geschüttelt. Violett, Henri? Wie bist du bloß auf die Idee gekommen?
Henri rückte den Hocker dichter an den Stand heran und streckte seine Beine aus. Er lehnte sich gegen das grüne Holz, drückte sich die Brille an die Nase und schlug das Buch auf.
Erstes Kapitel
Henris Blick blieb immer wieder hängen, während sich die ersten Sätze träge zu einem Anfang hinschleppten. Ein Pärchen spazierte munter und unbeschwert entlang einem ländlich beschaulichen Flussufer. Es kam aus einiger Entfernung heran, sie in einem zauberisch reizenden Kleid, von der Farbe wie des Lenzes Butterblumen; ihr Haar so satt und leuchtend wie glänzende Kastanien. Ein breitkrempiger Strohhut von paradiesischer Anmut beschirmte ihr jugendfrisches, von der Sonne geküsstes Gesicht vor der Hitze. Ihr Begleiter war flott herausgeputzt in Ausgehanzug, Handschuhen, Halsbinde, blütenweißen Halbgamaschen. Seine Hand suchte, romantisch, sehnsuchtsvoll, die ihrige zu halten. Und dennoch waren mürrische und hasserfüllte Wolken am Himmel, die den frischesten Liebes-Rosengarten bedrohten.
Als er des Lenzes Butterblumen las, zuckte Henri innerlich zusammen.
Auf Seite zwanzig hatte der Verfasser endlich die Dinge in Gang gebracht. Henri spürte förmlich, wie Schwierigkeiten von der Seite aufstiegen, die Dornen zu Speerspitzen wurden.
Das Liebespaar näherte sich, die Stimmen wurden lauter. Die Frau wies das Geschenk ihres Verehrers zurück. Sie werden mir vergeben, forderte der Mann in blinder Wut. Die Frau war furchtlos. Sie würde keinen Gedichtband von einem falschen Schuft annehmen, der sie warten ließ. Er protestierte, aufgebracht, verächtlich ihren närrischen Kleinmädchenstolz verdammend. Nein, Monsieur, sagte sie mit scharfer, höhnischer Stimme, Sie sind der Narr. Eintausend Strophen werden einem Mann, der hintergeht, niemals Pardon verschaffen. Die bedrohlichen Wolken wurden todesschwarz, die Frau im gelben Kleid riss ihre Hand aus seiner.
Hintergeht, dachte Henri. Gutes Wort.
Über dem Liebespaar taten sich des Himmels Schleusen auf.
Henri sah auf. Sein Vater war dabei, Bücher vom Karren in den Stand zu werfen. Sein Großvater raffte mit beiden Armen Textblätter zusammen. Binnen Minuten waren die drei Fourniers durchweicht. Henris Vater stellte die Vorderwand des Standes hoch, ließ die Klappe herunter und hantierte mit den Schlössern. Der Großvater wischte sich mit dem Ärmel über das Gesicht und sah auf das Buch in Henris Händen.
Was ist aus ihr geworden?
Wer?, sagte Henri.
Wem, junger Mann. Der Frau im gelben Kleid.
Ich weiß nicht. Sie waren dabei, in den Regen zu geraten.
Sein Großvater wandte das angegraute Gesicht zum Himmel. Na so was, sagte er.
Das Hochwasser von 1910 erreichte seinen Scheitelpunkt an den Dachkanten der Bücherstände. Als die Seine sich wieder zurückzog, kehrten ein paar Hartgesottene zurück und bahnten sich auf Zehenspitzen einen Weg durch den Schlick, der die Quais bedeckte. Sie fanden die grünen Kästen größtenteils geschlossen vor, die Klappdeckel sich langsam verziehend und gegen ihre Schlösser stemmend, Ecken und Ritzen fauligen Schlamm absondernd, die eingesperrten Buchbestände unter Brechreiz erregendem Gestank verrottend.
Ein Stand schien, mit hochgeklapptem Deckel, alles andere als verlassen zu sein. Aus seinen dunklen Tiefen sah man zwei Beine emporragen. Am Ende der Beine – magere Knöchel nackt und bleich in der kalten Luft, an den Knien geraffte, bespritzte Hosen – zwei Füße in Schnürschuhen, von denen schwarzer Schleim tropfte.
Kopfunter im Stand, schrie Henri seinem Vater zu: Tot, Papa!
Monsieur Fournier lüftete kurz die Mütze vor einem verdutzten Passanten und brüllte zurück: Wer ist tot?
Eine Katze, Papa! Ertrunken! Unterm Voltaire!
Welche Ausgabe?
Die dicke!
Ein gnädiger, sofortiger Tod also. Raus mit dir. Nimm das arme Vieh mit.
Henri wand sich aus dem Stand heraus, seine Schuhe quietschten auf dem Kai. Den Schwanz der leblosen Straßenkatze in der einen Hand, schob er sich mit der anderen die Brille an die Nase.
Also machen wir uns an die Arbeit, sagte Monsieur Fournier. Die Bücher ziehen heute wieder ein.
Ausgezogen waren sie auf den Rat des Großvaters hin. Der alte Mann kannte seinen Fluss wie ein Hafenmeister seine Untiefen. Eine Woche, bevor das Wasser zu steigen begann, fragte er, ob jemand es riechen konnte. Was riechen?, hatte Henri gefragt. Unheil, kam die Antwort.
Die Bücher wurden eingepackt, die Karten gebündelt, die Zeitungen zu Ballen verschnürt. Alles wurde auf den familieneigenen Karren gestapelt, und die Fourniers, beide Männer und der Junge, schoben und zogen ihn über den Pont des Arts. Während sie die Brücke überquerten, hörten sie Strudel um die Pfeiler schäumen. Henri bemerkte, dass sein Großvater über den Fluss zurückschaute.
Wir haben sie alle gerettet, nicht, Großvater?
Alle außer den Einhörnern, mein Junge.
Nicht jedes Buch würde der Flut entgehen. Diejenigen, die auf den ersten Blick wie alle anderen in dem Stand ausgesehen hatten, sich aber bei näherem Lesen als andersartig erwiesen, nicht. Ihre magische Handlung und seltsame Syntax hatten sie gezeichnet, wie ein Horn mitten auf einer ansonsten normalen Stirn. Anders und missverstanden: kurz angeblättert, um wieder zurückgestellt, völlig ignoriert und am Ende zurückgelassen zu werden, ein Opfer der steigenden Fluten.
Einhörner?, sagte Henri.
Die Bibel, Henri. Erinner dich an die Geschichte von Noah.
Und der Arche?
Exakt. Welches Tier reiste nicht mit?
Du hast mir doch erzählt, die Einhörner hätten überlebt. Sie mögen schwer zu sehen sein, sagtest du, aber sie wären noch immer bei uns.
Der Großvater lächelte. Das sind sie auch, Henri. Und wo würdest du wohl eines finden, jetzt, wo der Fluss sie mit sich gerissen hat?
Henri tippte sich mit einem Finger an die Schläfe.
Exakt, sagte der alte Mann.