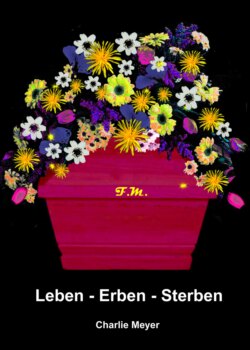Читать книгу Leben - Erben - Sterben - Charlie Meyer - Страница 4
2.
ОглавлениеIch hatte eine unruhige Nacht verbracht, was zum einen am roten Inhalt einer Flasche mit dem Aufdruck Shiraz Cabernet, South Eastern Australia lag und zum zweiten an den ungelösten Mysterien des Vortages. Ohne mich als moderne Sibylle ausgeben zu wollen, rumorten in meinem Innersten die widersprüchlichsten Ahnungen und sorgten für ein zerwühltes Bettlaken und ein schweißnasses Kopfkissen. Gegen halb vier, als die Vögel munter zu tirilieren begannen und sich die Dunkelheit lichtete, war ich über mein Bett gerollt und hatte dem Polski Owczarek Nizinny das gestickte Deckchen vom Hocker, der mir als Nachttisch diente, über den Kopf gehängt. Mir war gewesen, als starre mich Frankensteins Monster an. Am Abend zuvor hatten Churchill und ich ab einem bestimmten Glas Cabernet gemeinsam vor der Mattscheibe gehockt und uns einen hirnlosen Film namens Dead Man on Campus angesehen, in dem zwei durchgeknallte Studenten danach trachteten, andere durchgeknallte Studenten in den Selbstmord zu treiben. Der Plot gefiel weder ihm noch mir, daher hatten wir eine nette kleine Plauderei angefangen, von der mir allerdings nur noch ein einseitiges selbstmitleidiges Jammern durch die Erinnerung geisterte. Ich hätte vor dem Entkorken der Rotweinflasche etwas essen sollen. Wie Churchill mit seiner hängenden Zunge neben meinem Bett gelandet war, wusste ich nicht mehr, nur noch, dass er, mit dem Fingerknöchel beklopft, seltsam tönern klang und sich überhaupt nicht kuschelig, sondern hart und sperrig anfühlte, sobald man ihn umarmte.
Es beschämte mich sehr, wie tief eine einsame Frau sinken konnte.
Nach dem Aufstehen bestrafte ich mich mit einer kalten Dusche, Toast Hawaii und dem festen Vorsatz, meinen Filius aufzuspüren und ihm ein für alle Mal die Flausen auszutreiben. Er brauchte eine Wohnung und einen Schulabschluss - er brauchte ein geregeltes Leben unter mütterlichen Fittichen. Und eine Gebrauchsanweisung für seinen Verstand. In selbstkritischen Momenten quälte mich die Frage nach meinem ganz eigenen Beitrag zur Flucht des Jungen. Stimmten die Vorwürfe meines Ex, ich sei eine egomanische und machtbesessene Mutter und Lebensgefährtin gewesen, die niemanden in der Familie hochkommen ließ? Hatte ich allen beiden tatsächlich nur die Wahl gelassen, aus meinem Umfeld zu fliehen oder sich totzustellen wie der verdammte Hund? Eiko war am Morgen seines fünfzehnten Geburtstags auf das klapprige Fahrrad seines Vaters gestiegen, in der Plastiktüte auf dem Gepäckträger nicht mehr als ein paar Socken und eine Unterhose zum Wechseln, und in die Welt hinausgeradelt. Meiner Kontrolle entschwunden. Und alles nur, weil ich ihn mit einer kerzenbestückten Torte weckte und Happy Birthday sang, als er die Augen aufschlug. Er beklagte sich - über das frühe Wecken, das unbefugte Eindringen in seine Privatsphäre und meinen Gesang - und ich lachte ihn als Langweiler und Spielverderber aus und riet ihm, sich in der Wüste ein Iglu zu bauen, wenn er seine Ruhe haben wollte.
Wie sollte ich auch ahnen, dass er meinen Scherz aufgreifen und auf seine ganz eigene Art umsetzen würde.
Im Laufe der Jahre war entlang der Weser ein durchgehender Radwanderweg entstanden, der von Hannoversch-Münden bis runter zur Nordsee führte. Ein Teilstück davon war zu Eikos neuer Heimat geworden. Hameln lag etwa in der Mitte dieser Strecke und diente ihm als Versorgungsstützpunkt. Seit dem letzten Sommer pendelte er zwischen Holzminden und Minden unermüdlich hin und her. Mittlerweile besaß er ein Paar Satteltaschen und übernachtete auf Campingplätzen oder wo immer sich ein Eckchen für das Zweimannzelt fand, das er seinem Vater aus dem Keller stibitzt hatte. Schlösser waren für meinen Sohn von klein auf ebensowenig ein Problem gewesen wie das Knacken der E-Mail-Passwörter seiner Lehrer oder das nahezu perfekte vom Blatt spielen Carulli’scher und Carcassi’scher Gitarrenetüden. Falls sich Eiko irgendwann einmal entscheiden sollte, seinen IQ von 162 mit Verstand zu händeln - den ich ihm mittlerweile gern auch gewaltsam einbleuen würde - könnte der Welt ein neuer Nobelpreisträger entgegenwachsen, der erste Mensch auf dem Mars, ein begnadeter Dichter oder Paganini auf der Gitarre. Oder einfach nur der raffinierteste Hacker des Universums.
Stattdessen strampelte er Tag für Tag mit dem Wind und gegen den Wind den Weserradweg entlang. Flussaufwärts von Holzminden nach Minden, dann Kehrtwendung um hundertachtzig Grad und flussabwärts zurück zum Ausgangspunkt. In schwachen Momenten sah ich ihn direkt in die Psychiatrie des Landeskrankenhauses strampeln. Am Anfang hatte ich in meiner Wut und Hilflosigkeit erst das Jugendamt und dann sogar die Polizei auf ihn gehetzt, aber wie ein Aal schlängelte er sich zwischen all den Händen hindurch, die ihn aufzuhalten suchten. Immerhin konnte ich mich damit trösten, nicht vollends aus seinem Leben verbannt zu sein. Wenn er etwas brauchte, brach er bei mir ein.
Dem Himmel sei Dank lag ihm offenbar nichts daran, mich oder seinen Vater durch einen langsamen Drogenselbstmord zu bestrafen. Er nahm weder Crack noch Heroin noch experimentierte er mit Fliegenpilzen oder Purpurweiden herum. Er las auch nicht Huxley oder Carlos Castaneda. Er holte sich seine psychedelischen Kicks schlicht und ergreifend beim Radfahren.
Seine einzige Verbindung zur realen Welt bildete eine kleine rechteckige Plastikkarte, mit der er Schlösser knackte und Geld aus dem Automaten holte. Sein Vater überwies ihm Unterhalt auf ein Konto, und ich stockte auf, soweit ich konnte. Von dem Geld auf dem Konto zahlte er seine Übernachtungen, aber für den sonstigen Bedarf zog es Eiko vor einzubrechen, unsere Kühl- und Kleiderschränke zu plündern, Seife vom Wannenrand und die Käsecracker direkt vom Teller zu klauen. Er lebte sparsam.
Keiner von uns beiden hatte ihn je in flagranti erwischt. Erwischt hatte ich mich lediglich selbst, und zwar bei der Eifersucht, dass er nicht nur mich, seine leibliche Mutter beklaute, sondern auch diesen Kerl, der mich zwei Monate nach Eikos Ausstieg endgültig gegen ein gemütliches Junggesellenleben mit wechselnden Freundinnen eintauschte. Ausgezogen war er schon vorher. Nach siebzehn Jahren friedlichen Zusammenraufens, in denen wir nie auf die Idee gekommen waren zu heiraten. Wir lebten einfach unter einem Dach und zogen unser Kind groß. Bis Hartz IV kam und mir die staatliche Unterstützung zu streichen drohte, weil Uwe nach Meinung des Staates ausreichend verdiente, seine kleine Familie allein durchzufüttern. Da zog er aus und suchte sich Hals über Kopf eine eigene Wohnung, so schnell, dass mir ganz eigenartige Gedanken kamen. Sie bewahrheiteten sich an dem Tag, als er seine DVD-Sammlung abholte und ganz nebenbei unter unsere Beziehung einen Schlussstrich zog. Er habe eine andere.
Ich schlich durchs Treppenhaus in der Hoffnung, mit meinen verschwiemelten Augen ungesehen entkommen zu können. Dann schlich ich wieder hoch, weil mir die offenen Dachfenster einfielen und die Kaffeemaschine, die noch immer leise vor sich hinröchelte. Ich taperte von Zimmer zu Zimmer, und wieder überkam mich das deprimierende Gefühl, durch eine verlassene Leprastation zu irren. Alle anderen waren als geheilt entlassen worden, nur ich Aussätzige hatte zu bleiben, bis mir Nase, Ohren und Brüste abgefault waren.
Zugegebenermaßen war es eine Leprastation mit Ausblick. Aus den Giebelfenstern überblickte ich ab dem Süntel nordwärts alle Hügel des Wesergebirges und darüber einen Himmel, der Zweidrittel des Bildes für sich beanspruchte. Trotzdem kam ich mir vor wie Hermann der Cherusker, der an der Porta Westfalica auf immer zu steinerner Untätigkeit verbannt seinem Sieg über Varus hinterhertrauert. Die guten alten Zeiten waren vorbei. Es gab Stunden, da geriet ich in Versuchung, Eiko nachzueifern und aus diesem Jammertal des Lebens einfach auszusteigen. Es musste ja nicht der Radweg sein, ich könnte zum Beispiel den Kamm des Wesergebirges entlangwandern, Hügel für Hügel, bis ich auf dem letzten Hügel, dem Jakobsberg oberhalb von Porta, ankam. Dann könnte ich über die Weser aufs Wiehengebirge spucken, auf den Hacken kehrtmachen und zurückwandern. Tag für Tag und Jahr für Jahr.
Doch im Gegensatz zu Eiko fehlte mir der Mut.
Es war ein Fehler, einen letzten Blick in den Spiegel zu werfen, bevor ich erneut die Tür hinter mir ins Schloss zog. Rotäugig, x-beinig und die Schultern auf Höhe der Brüste, das typische Bild der Delia A. Pusch an einem depressiven Katermorgen wie diesem. Es nützte auch nichts, mir die fahlblonden Haare zu einem Pferdeschwanz hochzubinden oder mich mit meinen haselnussbraunen, von schwarzen Wimpern beschatteten Augen zu trösten, denen es nicht besonders schwer fiel, One-Night-Stands an Land zu ziehen, auch wenn ihnen die Fähigkeit festzuhalten offenbar abging. An diesem Tag allerdings mochten sie nicht einmal einen Blinden becircen, verborgen in all dem aufgedunsenen Fleisch.
Mein Hollandfahrrad lehnte wie gewöhnlich an der Garage zum Nachbargrundstück. Während alle anderen Fahrräder unter Büschen und Bäumen im tiefen Schatten standen, ließ ich meins in praller Sonne leiden. Warum sollte es ihm besser gehen als mir? Meistens sah es ohnehin so aus, wie ich mich fühlte: alt, verschlissen und schmutzig.
Wie immer, bevor ich auf Jagd ging, hatte ich vorher herumtelefoniert. Daher wusste ich, dass Eiko die vorletzte Nacht in Polle und die letzte auf dem Campingplatz des Grohnder Fährhauses verbracht hatte, demnach also weserabwärts Richtung Hameln unterwegs war. Ob ich ihn erwischte, hing von seinem Instinkt ab. Es konnte sein, dass er mir ahnungslos entgegengeradelt kam, es konnte allerdings auch sein, dass er mich mehr oder minder erwartete und mit Uwes Fernrohr irgendwo auf der Lauer lag und den Radweg beobachtete. Als ich ihn das erste Mal, kurz nach seinem Verschwinden, jagte - es war ebenfalls Hochsommer gewesen - begegneten wir uns tatsächlich. Auf dem schnurgeraden Weserdamm bei Tündern. Er radelte Richtung Hameln, ich kam von dort. Wir erkannten uns zur selben Zeit und reagierten beide hektisch. Eiko mit einer abrupten Kehrwendung, bevor er - ein Zentaur aus Fleisch, Reifen und Rost - davonraste, und ich mit Gebrüll und verzweifeltem Hinterherstrampeln. Ich stand in den Pedalen und nahm, jenseits aller Vernunft, von ohnmächtiger Wut getrieben, die Verfolgung auf. Vierzig Kilometer lang schnaufte ich wie ein Walross hinter ihm her, obgleich ich ihn die letzten dreißig Kilometer nicht einmal mehr sah. Wahrscheinlich hatte er sich längst seitwärts in die Büsche geschlagen. Am Fähranleger in Polle, der Burg geradewegs gegenüber, fielen das Fahrrad und ich einfach um und wurden mit Hitzekrämpfen ins Krankenhaus nach Holzminden abtransportiert. Ich hätte eine Flasche Wasser einpacken sollen, bevor ich bei über dreißig Grad den Schatten eines Phantoms jagte.
Die Fahrradsaison war längst in vollem Gange. Ich hatte noch nicht einmal die Stadtgrenze erreicht, als mir auch schon die ersten Radwanderer mit entschlossenen Mienen und dickem Gepäck entgegenstrampelten. Sie mussten vor Tau und Tag aufgebrochen sein und sahen so proper und fit aus, dass ich mich noch elender fühlte. Fröhliche Grüß Gotts, Hallos und Hi‘s schallten mir entgegen - einmal sogar ein Pfiat di von jenseits der Weißwurstgrenze - doch ich fühlte mich nicht in der Stimmung zurückzugrüßen. Mir war danach, mein Kind zu verprügeln, meinem Exmann mit einer Schrotflinte den Kopf wegzublasen und anschließend mit mir selbst die Flusskrebse zu füttern. Sogar die Krähe, die sich mit einem kleinen Aal im Schnabel kopflastig gerade noch ans Ufer rettete, bevor sie wie ein Lehmklumpen auf die Kiesel klatschte, vermochte mich an diesem Tag nicht aufzumuntern. Die Moral dieser Aktion - du kannst alles schaffen, wenn du es nur willst - widerte mich an.
Der erste Teil des Weserradwegs führte unmittelbar am Fluss entlang, und beim Anblick der glitzernden Wasseroberfläche überkam mich die katermäßige Gier, ihn restlos auszutrinken. Um ein Haar wäre ich bereits im Biergarten der Tündern’schen Warte vor einer eisgekühlten Apfelschorle gestrandet, doch zu Eikos Pech hatte er noch geschlossen.
Dann kam Tündern, ein großes Dorf mit jeder Menge Neubauten in Sicht, und ich hatte die ersten sieben oder acht Kilometer geschafft, ohne mich besser zu fühlen. Auf dem Tündern’schen Weserdamm wühlte ich mich durch eine Herde blökender Schafe und hob willig meinen Hintern aus dem Sattel. Wenn die Evolution geplant hätte, dass sich der Mensch eines Tages aufs Fahrrad schwang, hätte sie mit Sicherheit seine verwundbarste Stelle nicht gerade zwischen den Beinen plaziert. Während die Schafe um mich herumblökten, besah ich mir die Villen, die wie Schnüre aufgereiht hinter dem Damm lagen. Ich würde es mir niemals leisten können, ein viergiebeliges Haus in vornehmer Schräge auf einem großen Gartengrundstück mit Teich und quakenden Fröschen zu bauen. Mit Balkonen im Obergeschoss, die in alle vier Himmelsrichtungen wiesen und der Sonne keine Chance zum Entkommen ließen.
Es gab keinen Zweifel, ich spielte im falschen Film die falsche Rolle. Statist statt Akteur. Wenn man von dem Glückstreffer absah, dass ich mir am Vortag einen Tausend-Euro-Scheck verdient hatte. Ich würde ihn bar bei der Post einlösen, damit der Betrag nicht auf einem meiner Kontoauszüge erschien. Im Internet kursierte die Geschichte eines Göttinger Hilfeempfängers, der bei der Abgabe seines Hartz IV-Folgeantrags sämtliche Kontoauszüge des letzten Vierteljahres hatte vorlegen müssen. Er wurde prompt der Schwarzarbeit überführt.
Ich versuchte so wenig wie möglich über die Hundeangelegenheit nachzudenken, doch das flaue Gefühl blieb. Tausend Euro im ersten Monat, tausendfünfhundert für jeden weiteren, das ergab summa summarum für - sagen wir mal ein halbes Jahr - achttausendfünfhundert Euro, ein Vermögen für eine arme Arbeitslose. Doch was tat ich als Gegenleistung? Ich hütete einen ausgestopften Hund, der weder fressen noch trinken noch Gassi gehen wollte und im Gegensatz zu mir nicht einmal bellte. Ich hütete einen toten Hund, den ich später an einen Erben weiterreichen sollte, der angesichts des Gegenstandes seiner Erbschaft mit Sicherheit einem Herzschlag erlag.
Als mich eine Gruppe Pfadfinder in der Neunziggradkurve unter der Emmerthaler Eisenbahnbrücke in die Brennesseln abdrängte, ärgerte ich mich gerade über F.C.‘s alberne Geheimniskrämerei bezüglich ihres Namens. Und wie ließ sich die kryptische Andeutung interpretieren, ihr Tod werde in den Medien Aufsehen erregen? Üblicherweise erregte das Ableben derjenigen Aufsehen, die im Rampenlicht der Öffentlichkeit standen. Wer war F.C.? Eine schrullige, inkognito lebende Schriftstellerin, die außer mir jeder im Land kannte? Oder eine Milliardärin? Ich nahm mir vor, das Rätsel zu lösen. Als Anhaltspunkt gab es immerhin zwei Buchstaben, einen Butler namens Bruno und eine Adresse.
Die Eurobahn donnerte auf ihrem Weg nach Bad Pyrmont über die Brücke, und ich zog wie üblich den Kopf ein. Manchmal quälte mich die Vorstellung einer begierig vor sich hinschnaufenden Lokomotive, die nur darauf wartete, dass sich eine gewisse Delia A. Pusch der Unterführung einer Eisenbahnbrücke näherte, um sich von oben auf sie herabzustürzen. Eine Art Pendant zu Stephen Kings menschenmordenden Trucks.
Ich trug nur Bermudashorts, und meine nackten, von den Brennesseln juckenden Waden brachten mich schier zur Verzweiflung, als ich in Hagenohsen, dem nächsten Dorf, wieder auf die Landstraße traf und einen langgezogenen Berg in Angriff nahm. Aus den Wipfeln des bewaldeten Huckels jenseits der Straße ragten Baukräne. Halbfertige Villen lugten zwischen den Bäumen hervor. Auch wer dort oben baute, besaß einen wohlgefüllten Sparstrumpf.
Aus den Kleingärten unten an der Weser winkte mir ein Mann in Badehose zu. Er hielt einen Rechen in der Hand, und Heugeruch lag in der Luft. Ich seufzte unwillkürlich und blickte rasch wieder weg. War ich tatsächlich schon so tief gesunken, mich am Anblick eines Siebzigjährigen in Badehose aufzugeilen oder einen ausgestopften Hund zu umarmen? Beides war mit Sicherheit keine Lösung für meine Einsamkeit. Ich wollte meinen Sohn zurück, ich wollte Uwe zurück, und es gab sogar Phantasien, in denen ich mir zusätzlich zu Uwe Angelo in der Vorratskammer hielt.
Mein Problem bestünde darin, nicht loslassen zu können, hatte mir eine Bekannte vor wenigen Monaten erst erklärt, als wir uns auf ein Glas Bier im Sudhaus trafen. Es war unser letztes gemeinsames Bier gewesen, was sie hoffentlich den Unsinn ihres psychologischen Geschwafels lehrte. Ich betrat die Gaststätte nie wieder, aus Angst, Ilona könne nach meinem Gebrüll noch immer wie angenagelt auf ihrem Stuhl hocken.
Ich wollte schließlich nur, was mir gehörte!
Hinter dem letzten Haus ging es wieder zur Weser hinunter. Weg von der Landstraße und rein in die Felder. Vom Rausch der Geschwindigkeit inspiriert, passierte ich in flottem Tempo die Kühltürme des Kernkraftwerkes Grohnde, die jenseits der Weser als rauchspuckende Wächter aus einer Schafherde aufragten. Der Zweck dieser Schafe war mir gleich nach Inbetriebnahme des Reaktors klargeworden. Sie dienten dem Direktorium des AKW als lebende Indikatoren für den drohenden Super-GAU. Als unbestechliche, wollige Instrumente auf vier Beinen, die bei Stromausfall nicht abstürzten und keine roten, hektisch blinkenden Lämpchen brauchten. Sie fielen einfach tot um. Beim ersten toten Schaf packte das Management die Aktenköfferchen, beim zweiten schlich es sich durch die Hintertür davon, und wenn es zum Knall kam, zeugte nur noch ein Kondensstreifen am Himmel von seiner Flucht.
Als ich in der Ferne die schnurgerade Allee ausmachte, die von der Landstraße abging und sich feldergesäumt zur Fähre hinunterzog, begann es in meinem Magen zu kribbeln. Das Fährhaus mit seinem Campingplatz rückte in greifbare Nähe, und ich schickte ein schnelles Stoßgebet zu den Göttern, sie mögen mich mit Erfolg segnen und mir einmal, nur ein einziges Mal, erlauben, meinen abtrünnigen Sohn in die mütterlichen Finger zu bekommen. Allerdings schien mir eher, dass sie sich auf meine Kosten über die erfolglosen Jagden amüsierten. Eiko auf seiner Route zwischen Holzminden und Minden telefonisch zu orten, war dabei das kleinste Problem. Ein Fünfzehnjähriger mit roten Rastalocken und einem Gesicht voller Sommersprossen, der allein auf einem klapprigen Fahrrad durch die Gegend strampelt und immer wieder auf denselben Campingplätzen nächtigt, ist niemand, der sich leicht übersehen lässt. Das Problem bestand lediglich darin, seiner tatsächlich habhaft zu werden. Bisher war es mir nicht gelungen. Die tragikomische Geschichte der Jägerin Delia A. Pusch und ihres windschlüpfrigen Opfers Eiko war wahrscheinlich längst aus der Weser in die Nordsee geschwappt und verbreitete sich gerade über Atlantik und Pazifik in die letzten ahnungslosen Refugien des Erdenrunds. Zur allgemeinen Belustigung oder zum Zwecke der Abschreckung, je nachdem, aus welcher Sicht man es betrachtete.
Ob es im Internet einen Chatroom für Versager gab?
Es war Viertel vor elf. Dass mir Eiko auf dem Radweg noch nicht entgegengekommen war, konnte zweierlei bedeuten. Er sauste, von seinem Instinkt gewarnt, längst in Gegenrichtung davon, oder die Campingplatzbetreiber hatten mit ihrer Behauptung recht, er bräche seit einiger Zeit erst gegen Mittag auf und fände sich bereits am frühen Abend wieder auf dem nächsten Platz ein. Die Monate seines ersten Dahinhetzens von Sonnenaufgang bis zur Abenddämmerung gehörten, Gott sei’s gelobt, offenbar der Vergangenheit an. Je strammer seine Waden wurden, desto mehr Tempo nahm er raus.
Uwe, der Spender des Samens, aus dem diese Unrast entstanden war, schickte mir vor vierzehn Tagen den Computerausdruck einer Hochrechnung zu. Eine unerwartete Antwort auf meine zahlreichen Telegramme, mit denen ich seit zwölf Monaten vergeblich versuchte, sein väterliches Verantwortungsgefühl zu wecken. Vorausgesetzt, Eikos Pensum betrage täglich nur noch sechs Stunden, werde unser Sohn, selbst wenn er seine Fahrzeit um nur eine Minute pro Tag kürzte, in weniger als einem Jahr (genauer gesagt in dreihundertsechzig Tagen) ganz von selbst zum Stillstand kommen. Zumindest interpretierte ich die Zahlenkolonnen dementsprechend, denn ein schriftliches Fazit hatte sich Uwe gespart. Es war auch so der perfekte Freibrief für meinen Ex, den Hintern im Sessel und die Fernbedienung in der Hand zu lassen. Ich hingegen plante keineswegs, Eiko ein weiteres Jahr dabei zuzusehen, wie er mich für was auch immer bestrafte. Darüberhinaus fehlten in Uwes Hochrechnung die geographischen Koordinaten, an denen Eiko aufhören würde, in die Pedalen zu treten. In Minden? In Bodenwerder? In Rinteln oder Hessisch Oldendorf? Oder einfach irgendwo mitten im Nichts? Und was kam als Nächstes? Was schwebte ihm für den Rest seines Lebens vor? Stieg er in ein Paddelboot um? Entschied er sich dafür, in einem Franziskanerkloster Weißbier zu brauen? Oder rammte er an Ort und Stelle einen dicken Pfahl in den Boden und wurde Säulenheiliger?
Erst kamen die Ponys auf der Weide in Sicht, dann das Grohnder Fährhaus selbst. Das eigentliche Dorf Grohnde, einschließlich des alten Gemäuers der Domäne, lag am jenseitigen Ufer. Die Wellen eines Ausflugsdampfers schwappten gegen das Holz der Fähre. Der Fährmann, kaum älter als Eiko, hob grüßend die Hand, als ich zu ihm hinüberblickte. Ein alter Bauer hockte in seinem Blaumann auf einer Bank im Schatten, eine Bierflasche zwischen den Knien, und biss in ein Butterbrot. Ich stieg ab, überquerte die schmale Straße zum Fähranleger und schlich mich samt Fahrrad um die Ecke der Gastwirtschaft. Im Biergarten, gleich hinter dem Torbogen, schmetterte eine Schar Radwanderer fröhlich unter den alten Bäumen: Schnaps, das war sein letztes Wort, dann trugen ihn die Englein fort ... Es war heiß, das Bier ölte die Kehlen, und niemand schien es eilig zu haben. Ich knabberte verärgert an meiner Unterlippe - ausgerechnet heute schien mir die ganze Welt zeigen zu wollen, wie sehr sie sich amüsierte - und drehte ihnen demonstrativ den Hintern zu.
Der Campingplatz schloss unmittelbar ans Fährhaus an, durch den Weserradweg in zwei ungleiche Hälften geteilt. Auf dem Hauptplatz links standen die Wohnwagen der Dauercamper, rechterhand gab es heckengesäumte Nischen für das durchziehende Volk. Ich steckte meine Nase um jede Hecke einzeln, ich blickte zwischen und hinter die Wohnwagen und war verzweifelt genug, selbst unter sie zu spähen. Eiko fand ich nicht. Er war weg. Mit hängenden Armen stand ich mitten auf dem Radweg, während Hitze und Enttäuschung meine Knochen verflüssigten. Dank Uwes Fernrohr, dank Eikos siebtem Sinn, dank meiner Sturheit, ihn wieder und wieder jagen zu müssen, wahrscheinlich jedoch dank einer Kombination aus all dem, war mir mein Sohn erneut durch die Finger geflutscht und längst über alle Berge. Vielleicht die Allee hoch nach Frenke, ein Stück die Landstraße hinunter und dann einen der Stichwege zurück zur Weser, um mich elegant zu umschiffen. Vielleicht auch einfach in Gegenrichtung auf und davon. Doch es spielte eigentlich keine Rolle, wie er mich ausgetrickst hatte. Wieder einmal war der Versuch meiner Annäherung mit Flucht bestraft worden, und mittlerweile fühlte ich mich weniger wütend als gedemütigt.
Ich versuchte mich wie die Bezaubernde Jeannie nach Hause zu blinzeln, doch als selbst das misslang, schleppte ich mich niedergeschlagen in den Biergarten - trotz meines Widerwillens gegen die fröhlichen Zecher. Ich parkte mein Fahrrad neben dem Pulk der übrigen Fahrräder, die ausnahmslos unter überladenen Gepäckträgern ächzten. Ein Schild mit Pfeil, auf dem Selbstbedienung stand, lotste mich in die Gaststätte und dort an den langen Tresen. Eine ältere Frau blickte mir erwartungsvoll entgegen.
„Hallo. Ich hätte gern ein Radler. Ein großes Radler.“ Ich deutete mit den Händen die Größe an. Obgleich ich während der Fahrt einen halben Liter Wasser getrunken hatte, war meine Kehle vom Nachdurst wie ausgetrocknet. „Außerdem würde ich Sie gern was fragen. Ich weiß nicht, ob Sie das waren, mit der ich heute Morgen telefoniert habe, aber ich suche den Jungen mit den Rastalocken.“
Sie lachte. „Eiko? Sie sind seine Mutter, nicht? Die Ähnlichkeit ist unverkennbar. Ihr Sohn sitzt draußen im Garten. Haben Sie ihn denn nicht gesehen?“
„Er sitzt draußen? Eiko? Wo denn?“
Sie verrenkte sich den Hals, um aus einem der Fenster zu spähen, und ich tat es ihr gleich. Sie deutete auf einen abgelegenen Tisch am Zaun zur Ponyweide. Ein halb ausgetrunkenes Spezi hielt einsam Wacht. Der Gesichtsausdruck der Wirtin änderte sich. Für das Mitleid in ihrem Blick hätte ich ihr gern gegen das Schienbein getreten, doch sie und mich trennten der Ausschank. „Tja, tut mir leid, eben war er noch da.“
Ich musterte den Tisch, das Spezi und den leeren Stuhl, auf dem Eiko gesessen haben sollte, ich musterte die dicke Kastanie, hinter der der Stuhl stand. Die Erkenntnis traf mich wie ein Vorschlaghammer, und ein, zwei Züge lang bekam ich nur mit offenem Mund Luft. Über eine Stunde hatte ich stramm in die Pedalen getreten und alles nur, um in meinem Ärger über die fröhlichen Zecher, durch das verächtliche Abwenden vom Trubel, meinen Sohn einfach zu übersehen. Er hingegen hatte mich natürlich auf der Stelle erblickt und Hals über Kopf die Flucht ergriffen.
„Sein Spezi ist noch da“, bemerkte die Wirtin, im vergeblichen Bemühen, dieser Versagerin von Mutter etwas Tröstliches zu bieten.
„Ja, das sehe ich, aber es wird mir wohl kaum antworten, wenn ich es frage, wo sein Besitzer abgeblieben ist. Irgendwelche Vorschläge?“ Eine rein rhetorische Frage, auf die ich nicht ernsthaft eine Antwort erwartete.
Die Wirtin zuckte die Achseln. „Richtung Hameln auf dem Radweg. Oder hoch ins nächste Dorf. Oder er setzt mit der Fähre über.“
„Die Fähre!“ Natürlich! Vor meinen Augen mit der Fähre überzusetzen, während die genasführte Mutter am Ufer vor Wut brüllte, würde Eiko gefallen. Es war sein Stil.
Ohne mich, du Satansbraten, dachte ich erbost, stürmte jedoch im selben Augenblick auch schon los und sprintete zum Anleger hinunter.
Sollte ich ihn wider Erwarten doch noch erwischen, würde ich einfach das tun, was ich in seiner Kindheit offenbar versäumt hatte. Ihn mir übers Knie legen und nach Strich und Faden vermöbeln.
Die Fähre jedoch tuckerte bereits das gegenüberliegende Ufer an. Mitten drauf stand eine einsame Gestalt. Sie hielt ein Fahrrad mit schwarzen Packtaschen am Lenker, hatte rote Rastalocken und drehte mir den Rücken zu.
„Eiko Pusch! Auf der Stelle kommst du ...“ Ich brüllte, wie ich noch nie gebrüllt hatte, und meine Stimme überschlug sich noch vor dem letzten Wort. Es gab kein zurück mehr.
Es war der Fährmann, der reagierte. Er schoss alarmiert aus seinem Kabäuschen, sagte etwas zu dem Jungen und deutete mit ausgestrecktem Arm auf mich. Ich sah Eikos verfilzte Rastalocken fliegen, als mein Sohn vehement den Kopf schüttelte, dann gab ich auf. Dem Bauern auf seiner Bank war der Bissen im Hals stecken geblieben. Er starrte mich beunruhigt an. Ich schleppte mich zum Fährhaus zurück, holte mir das Radler vom Tresen, ohne der Wirtin in die Augen zu blicken, und versteckte mich ganz hinten im Biergarten. Weit entfernt von den glücklichen Menschen. Als die Fähre am jenseitigen Ufer anlegte, hob ich das Glas und prostete meinem Sohn zu, der sich in den Sattel schwang und in Richtung AKW davonradelte. In fünf Tagen, am kommenden Sonntag, wurde er sechzehn Jahre alt, und gleichzeitig jährte sich seine Flucht.
„Du kannst mich mal.“ Dann verschwamm mir die Sicht.