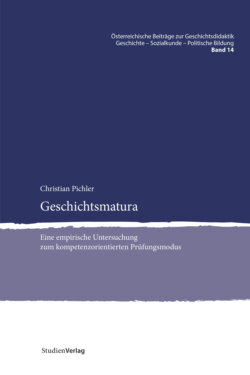Читать книгу Geschichtsmatura - Christian Pichler - Страница 9
2.3 Kompetenzorientierung im Fach Geschichte 2.3.1 Ein langer Weg: Von Inhaltszentrierung über Schlüsselprobleme zu fachlichen Kompetenzen
ОглавлениеDie Kritik namhafter Proponenten der Geschichtsdidaktik mag den Anschein erwecken, dass der Paradigmenwechsel überraschend erfolgt ist. Tatsächlich beschleunigte der behördliche Druck zwar das Elaborieren der Kompetenzmodelle, dem war aber eine 40jährige Diskussion vorausgegangen, die um die Frage nach der Ausrichtung des Unterrichts (eher inhaltlich oder kategorial) geführt worden war.93 Im Zuge dieses Diskurses wurden wesentliche Vorarbeiten für die Implementierung der Kompetenzorientierung im Fach Geschichte geleistet. Zur Ausgangslage: In den 1950er- und 1960er Jahren stand das Schulfach Geschichte im Ruf das „Bildungsfach par excellence“94 zu sein. In Österreich war es zudem integraler Bestandteil der staatlich gewünschten Entfaltung einer österreichischen Identität in bewusster Abgrenzung zu deutschnationalen Traditionen des 19. und 20. Jahrhunderts, aber auch zum Habsburger-Mythos.95 Marko Demantowsky spricht von einem etatistisch-intentionalen Paradigma, dessen Ziel die Vermittlung gesellschaftlicher Normen und Werte gewesen ist. „Guter Geschichtsunterricht ist eine Agentur der Herrschenden zur Produktion von MitläuferInnen und MittäterInnen.“96 Die Fachdidaktik jener Jahre sah ihre Rolle in der wissenschaftlichen Methodenlehre und definierte Stoffkataloge, deren Abarbeitung den Lehrer*innen über Bildungspläne aufgetragen wurde, ohne dass man diese Syllabi einer kritischen Reflexion unterzogen hätte, „weil deren durch Tradition und Herkommen ausgewiesene Gültigkeit“97 für unumstößlich gehalten wurde. Es gehörte zum Selbstverständnis der Disziplin, den Transfer der Ergebnisse der Fachwissenschaft auf die Ebene der Schüler*innen in Form einer „Abbilddidaktik“ zu planen und durchzuführen. Der Entwicklungsstand junger Menschen, Resultate der Unterrichtsarbeit und deren Folgen fanden wenig Beachtung.98 Unterrichtsziele befanden sich in den Präambeln der Lehrpläne und wurden kaum wahrgenommen. Diese Verhältnisse erwiesen sich als ausgesprochen stabil, weil Geschichte in der Gesellschaft kaum Emotionen weckte. Der gymnasiale Geschichtsunterricht, abgeleitet von den Nominalfächern der universitären Studiengänge, löste keine kritische Betrachtung gesellschaftlicher Entwicklungen aus, sondern diente der Stabilisierung des errungenen freiheitlich-demokratischen Grundkonsenses in dessen nachkriegszeitlichem Erscheinungsbild. Weder in Deutschland noch in Österreich wurde der die 1950er Jahre kennzeichnende Transfer obrigkeitsstaatlicher Prinzipien in junge Demokratien ernsthaft in Frage gestellt. Alfred Heuß hatte wegen des unkritischen Umgangs mit Geschichte 1959 sogar vom „Verlust der Geschichte“99 gesprochen.
Den Anstoß zu einer Diskussion über Sinn und Ziele des Geschichtsunterrichts hatte 1964 Georg Picht gegeben. Bezüglich der Inhalte und Ziele des Geschichtsunterrichts hatte er von einer „deutschen(n) Bildungskatstrophe“ gesprochen100 und damit eine Debatte angeregt, die die Sinnhaftigkeit des Faches grundsätzlich in Frage stellte.101 Damit wurde der Geschichtsdidaktik die „Chance (zu) disziplinärer Modernisierung und fachautonomer Lernzielsetzung“102 eröffnet, die durch die kurz darauf mit Vehemenz einsetzende 1968er Bewegung und die daraus erwachsene Auflehnung gegen die Bildungsvorstellungen der damaligen Eliten an Dynamik gewann.103 Theoriebildung war in Bewegung geraten. Während die konservative Geschichtsdidaktik vom Nutzen des Umgangs mit Geschichte an sich überzeugt war (Rohlfes, Jeismann), betonte die linke Geschichtsdidaktik dessen soziale Emanzipationsaufgabe (Bergmann, Kuhn).104 Thomas Hellmuth beschreibt den fachdidaktischen Diskurs der 1960er Jahre105 als Prozess einer allmählichen Hinwendung des Geschichtsunterrichts zum Individuum (Erich Weniger, Karl Dietrich Erdmann). Der Bogen reichte vom Wunsch nach „[...] Herausbildung des ‚Citoyen‘ (als) emanzipierten, gesellschaftlich sowie handlungs- und partizipationsfähigen Individuums […]“106 (Schulz-Hageleit) bis zur Anerkennung der Bedeutung der Gegenwarts- und Zukunftsgebundenheit schulischen Umgangs mit Geschichte (Kuhn) reichte.107 Zur Krise des Geschichtsunterrichts gehörte aber auch, dass Konzepte entwickelt wurden, die ihn entweder durch sozialwissenschaftliche Fächer (Z. B. „Staatsbürgerkunde“,108 „Politik“, „Gesellschaftsbildung“) ersetzt oder in Fächerbündel (z. B. Geografie mit Geschichte) integriert wissen wollten.109 Erstes Ergebnis der Debatte war ein Konsens über die Umkehrung der Perspektive. Das Planen von Unterricht aus dem Blickwinkel der Politik wurde zu Gunsten eines Denkens von Unterricht aus Schüler*innenperspektive abgelöst, für Schönemann et all. „eine veritabel didaktische Revolution“, die in die Lernzielorientierung der Bildungsarbeit münden sollte.110 Von da an war die Auswahl von Inhalten und deren Bearbeitung zu begründen, Schwierigkeitsgrade hatten überlegt und die Bedeutung des Unterrichtsgegenstandes in seiner Relation zur Wissenschaft kritisch hinterfragt zu werden. Unterricht war an Konzepte, Überlegungen und Planungen zu binden. Es galt, die Leistung des Fachs Geschichte mit Blick auf Weltverstehen und Lebenspraxis der Schüler*innen neu zu definieren. Demantowsky sieht im Kant’schen Diktum vom „mündigen Bürger“ die Kompromissformel der Debatten jener Jahre.111 Das geänderte Selbstverständnis von Geschichtsunterricht fand seinen Ausdruck aber auch in der Berücksichtigung von Taxonomien, die Lernziele beschrieben und operationalisierten,112 in der Planung von Unterricht und in dessen Wahrnehmung als komplexem einem Vorgang, den es zu analysieren und zu verstehen galt. Die auch diskutierte Konstruktion eines Gesamtcurriculums für alle Fächer scheiterte jedoch,113 und „damit hatte die Stunde der Fachdidaktik geschlagen“.114 Ihrem Selbstverständnis nach sollte sie die Anordnung von Lehr- und Lerninhalten, deren Vermittlung und Grenzen so gestalten, „dass die Fachwissenschaften auf pädagogisch formulierte Fragen antworten“115 zu liefern in der Lage sein würden. Damit war der Paradigmenwechsel von der Beschränkung des Unterrichts auf Wissensvermittlung durch „Meistererzählung“ zur Lernzielorientierung und didaktischer Arbeit erfolgt. Die aus der existenziellen Bedrohung des Fachs Geschichte resultierende Theoriearbeit der Fachdidaktik mündete in einen Grundkonsens über Ziele und Methoden des Geschichtsunterrichts. Nahm man das übergeordnete Bildungsziel einer Vorbereitung auf die selbstständige Bewältigung des Lebens ernst, musste Schule das Erreichen von „Einsichts-“ und „Fähigkeitszielen“ anstreben. Der methodische Ansatz dazu wurde, Piaget und Bruner folgend,116 in den Verfahren eines konstruktivistisch konzipierten, explorativen Lernens (entdeckender Unterricht117) identifiziert. Es entstanden bedeutende Initiativen, die dem Fach Geschichte Wege in Richtung Kompetenzorientierung wiesen. Hans Döhn legte bereits 1968 einen „Lernzielkatalog“ vor, dessen zentrale Aussagen als Kompetenzen gelten könnten (z. B. Zeitsinn entwickeln, Zusammenhänge sehen lernen, Verständnis für soziale, politische, wirtschaftliche Gegebenheiten der Gegenwart wecken etc.).118 1974 schlug Anette Kuhn einen Paradigmenwechsel in der Begrifflichkeit vor und sprach nicht mehr von „Zielen“, sondern von „Qualifikationen“. Sie definierte fünf Fähigkeiten, die eine soziale Emanzipation der Individuen bewirken sollten: Kommunikation, ideologisches Denken, gesellschaftliche Analyse, Parteinahme und Identitätserweiterung.119 Kuhn strebte zwar einen „historisch-kritischen Lernprozess“120 bei Schüler*innen an, historisierte die zu entwickelnden Fähigkeiten jedoch nicht, sondern wollte sie als „überhistorisch“ verstanden wissen, sodass sie in der Domäne nur am Rande wahrgenommen wurden. Demgegenüber hatte Hans Süssmuth 1972 die Beachtung der Aspekte „Lebenswelt“ und „Handlungsorientierung“ für Geschichte eingefordert, eine Klassifikation der Lernziele gemäß der Bloom’schen Taxonomie vorgenommen und sie in ihrer historischen Tiefe gestaffelt.121 Damit hatte er de facto Kompetenzen formuliert. Eine vielversprechende Initiative mit ähnlichen Zielen wurde 1973 von der Bildungspolitik des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen gesetzt.122 In Form einer Empfehlung wurden zehn „Qualifikationen“ für die gymnasiale Oberstufe formuliert, die von der Idee getragen waren, mit Hilfe von Methodennutzung Einsichten in die Geschichte zu ermöglichen und Fähigkeiten zum Umgang mit ihr zu evozieren. Die Hinwendung zu analytischer Arbeit mit Materialien blieb zwar auf Quellen beschränkt, markierte aber erstmals den Versuch, im Unterricht die Spannungen zwischen Zeitgebundenheit und Gegenwartsbezug zur Erkenntnisgenerierung und zur Reflexion zu nutzen. Sogar eine Graduierung war ersichtlich. Noch fehlten jedoch die Aspekte Geschichtsbewusstsein und Kommunikation. Einen Schritt dorthin setzte Joachim Rohlfes, der die Substituierung der von Klafki propagierten Hierarchisierung der Lernziele in Richt-, Grob-, Fein- und Feinstziele123 zu Gunsten von „Qualifikationen“ verlangte,124 um Schüler*innen dazu zu befähigen, „[…] sachgemäß, kritisch und selbstständig mit historischen Sachverhalten umzugehen und der Bedeutung der Geschichte […] für die Gegenwart gerecht zu werden.“125 Damit wurde erstmals die Kategorie „Geschichtsbewusstsein“ als Bildungsziel in die Diskussion eingebracht. In Summe schuf die Curriculumsdebatte der 1970er Jahre kein befriedigendes Theoriekonzept, denn die inhaltliche Neubestimmung des Geschichte-Lernens in Form der entwicklungslogischen Erarbeitung von Sinnbildungsmuster war noch nicht erkannt worden. Noch dominierten politische Parameter – u. a. die Polarisierung zwischen einem von der Frankfurter Schule (Anette Kuhn) beeinflussten Denken und dem des vom französischem Strukturalismus (Hans Süssmuth) angeleiteten – die Theoriedebatte.126 Wichtige Vorarbeiten zur Klärung des Verständnisses von Kompetenzorientierung im Geschichtsunterricht waren jedoch geleistet worden.