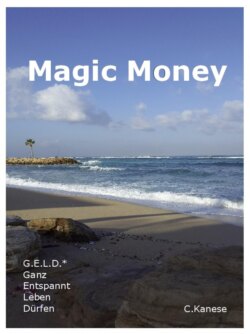Читать книгу Magic Money - Christina Kanese - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.7 Geldpolitik
Оглавление„Die Tätigkeit ist das Glück, und für den, der die Freuden eines ununterbrochenen Bestrebens empfinden kann, ist der erworbene Reichtum ohne Bedeutung.“
Johann Wolfgang von Goethe
In der Geldpolitik wird die Geldmenge gesteuert, damit die Geldmenge der Wirtschaftsmenge entspricht und so Inflation oder Deflation verhindert werden. Vielleicht haben Sie schon einmal davon gehört, dass die Zentralbank oder der Staat Geld druckt und somit die Geldmenge erhöht wird. Tatsächlich ist der Zusammenhang etwas komplexer. Es gibt nämlich drei Geldmengen die statistisch erfasst werden: Diese werden M1, M2 und M3 genannt.
M1 ist kurz gesagt alles Bargeld und die Girokontenbestände (sogen. Sichteinlagen), an die jeder täglich herankommt.
M2 beinhaltet M1 sowie alle Festgelder (Spareinlagen) bis zu zwei Jahren und mit einer Mindestlaufzeit von drei Monaten (Kündigungsfrist drei Monate).
M3 schliesslich ist M1 und M2 plus die sogenannten Repogeschäfte (= Vermögenswerte / Wertpapiere im Rahmen einer Rückkaufvereinbarung), sowie Geldmarktfonds und Schuldverschreibungen bis zu zwei Jahre.
Nur ein Teil der Geldmenge M1, nämlich das Bargeld, kann tatsächlich vermehrt, gedruckt oder geprägt werden. Damit hier kein Missbrauch entsteht, wurde die Gelddruckhoheit einer von der Politik unabhängigen Instanz übertragen, bei uns der Bundesbank bzw. der europäischen Zentralbank (EZB). Diese ist in ihren Entscheidungen unabhängig von der Politik und vertraglich nur an das Preisstabilitätsziel gebunden. Nur das Münzprägerecht ist beim nationalen Finanzminister geblieben, so dass ab und zu mit Sonderprägungen (die berühmten 100 DM-Münzen) ein wenig mehr Geld in die Kassen der Politik gespült werden kann.
Das Münzgeld machte jedoch mit 25,7 Tausend [11] bei einer gesamten Geldmenge von 10,8 Billionen € im Jahr 2015 nur einen sehr geringen Teil aus (weniger als 0,00000001 %) und spielt deswegen für Geldbeschaffungsmaßnahmen der Politik nur eine untergeordnete Rolle.
Der Hauptteil der Geldmengensteuerung kann nur von der EZB mittels geldpolitischer Maßnahmen, z.B. der Zinsfestsetzung, übernommen werden. Diese Zinsfestsetzung bestimmt die Geldschöpfung der Geschäftsbanken.
Die Geldschöpfung der Geschäftsbanken wird vielleicht durch folgendes Bild klarer: Geld ist wie ein leeres Paket. Stellen Sie sich vor, Sie bekommen ein Paket geliefert. Auf diesem Paket steht drauf, dass darin das Versprechen auf Mobilität und zusätzlich für ein gesundes Leben z.B. ein Fahrrad geliefert wird. Nun stellen Sie sich weiterhin vor, dass Sie das Fahrrad im Moment gar nicht brauchen oder benutzen wollen, da Sie ein Auto haben und im Winter ins Sportstudio für die Gesundheit gehen. Sie freuen sich also über diese Möglichkeit zur gesunden Fortbewegung, beschließen aber, es im Paket verpackt in den Keller zu stellen. Sie haben bis dahin gar nicht nachgesehen, ob auch wirklich ein Fahrrad drin enthalten ist. Nach ein paar Monaten merken Sie, dass Sie das Fahrrad doch nicht nutzen werden und beschließen, das Paket weiterzugeben. Solange das Paket nicht ausgepackt wird, kann im Prinzip auch ein leeres Paket mit dem aufgedruckten Versprechen weitergegeben werden. Solange das Paket immer verpackt weitergegeben wird, ist auch jeder, welcher es zwischendurch einmal besitzt, damit glücklich und zufrieden. Jedenfalls solange, bis ein Besitzer tatsächlich das Fahrrad nutzen möchte, im Paket keines vorfindet und deshalb das aufgedruckte Versprechen einfordert.
Mit dem Geld funktioniert das ähnlich. Das Geld wird immer weitergegeben, und erst, wenn das Geld nicht mehr eingetauscht werden kann, gibt es Probleme.
In der Geldpolitik ist also die EZB in unserem Beispiel mit den Paketen dafür verantwortlich, diese herzustellen. Die Geschäftsbanken können diese Pakete auf Konten verwalten und neue virtuelle Pakete schöpfen. Virtuelle Pakete schöpfen bedeutet, dass die Geschäftsbanken auf Konten eine Menge von neuen Paketen als Kredit gutschreiben dürfen, wenn sich dafür der Kreditnehmer dazu verpflichtet, dafür etwas zu leisten oder eine materielle Sicherheit (z.B. ein Haus) hinterlegt. Jedem Kredit, also jedem virtuellen Paket, steht das Versprechen einer Gegenleistung gegenüber. Zusätzlich gibt es zu jedem Kredit ein entsprechendes Guthaben. Für unsere Pakete heißt das, dass auf dem Kreditkonto ein Minusbetrag für Pakete steht und dafür auf dem Guthabenkonto ein Plusbetrag für Pakete steht.
Die Verwaltung der Pakete als Betrag bedeutet für das Unterbewusstsein, dass die Abstraktion auf die Spitze getrieben ist. Diese Abstraktion ist für das tägliche Wirtschaften völlig in Ordnung, und es ist sozusagen gar nicht mehr nötig, dass Irgendjemand in die Pakete schaut oder prüft, ob es zu dem Betrag auf den Konten eine entsprechende Anzahl von leeren Paketen gibt.
Dieses virtuelle Konstrukt gibt der Wirtschaft sehr große Freiheiten und keine Begrenzung des Wirtschaftswachstums. Es muss allerdings dafür gesorgt werden, dass es insgesamt mit einem Gegengewicht, z.B. der volkswirtschaftlichen Leistung bzw. dem Bruttoinlandsprodukt gedeckt ist. Für jedes leere Paket sollte es also irgendwo ein Fahrrad oder etwas gleichwertiges geben, damit das aufgedruckte Mobilitätsversprechen im Fall der Fälle eingelöst werden kann.
Damit dieses ganze System nicht aus dem Ruder läuft, gibt es bestimmte Gesetze für die Geschäftsbanken, z.B. dass 2% der Kredite durch (echtes) Guthaben gedeckt sein müssen. Der Kreditnehmer muss nun dafür Zinsen zahlen, dass er das Geld oder in unserem Beispiel leere Pakete bekommt und erst später wieder zurückgeben muss. Der Kreditgeber erhält diese Zinsen dafür, dass er Geld verleiht, also während der Zeit der Leihgabe nichts für das Geld eintauschen kann und eventuelle Wünsche auf später verschieben muss. Und außerdem erhält er Zinsen, weil er das Risiko eingeht, dass der Kreditnehmer seinen Verpflichtungen eventuell doch nicht nachkommen kann.
Je nach dem wie niedrig der Zins ist, ist es für den Kreditnehmer einfacher, das Geld wieder zurückzuzahlen, weil er dann nicht übermäßig viel mehr zurückzahlen muss. Bei einem höheren Zins bekommt der Kreditgeber eine höhere Entschädigung für den entgangenen jetzigen Konsum und sein Risiko. Damit ist der Zins sozusagen der Preis des Geldes. Je höher der Preis des Geldes, desto höher ist der Anreiz, etwas davon zu verleihen und dafür mehr zurück zu bekommen. Entsprechend geringer ist allerdings der Anreiz, sich Geld zu leihen, weil für die Rückzahlung entsprechend mehr bezahlt werden muss. Geld ist dann teuer.
Über die Festsetzung des Zinses von der EZB wird so indirekt die Schöpfung von Geld durch die Geschäftsbanken gesteuert. Bei niedrigem Zins werden mehr Kredite nachgefragt und mehr virtuelles Geld geschöpft.
Solange das Verhältnis von Wirtschaftsmenge und Geldmenge im Laufe der Zeit stabil bleibt, ist das kein Problem. Wenn also viel Geld geschöpft wird und parallel auch viel erwirtschaftet bzw. viele Güter oder Dienstleistungen erstellt werden und/oder parallel wichtige (Verbrauchs-)Güter (wie z.B. Energie) günstiger werden, ist alles in Ordnung.
Natürlich ist dieses Zusammenspiel durch viele Faktoren beeinflusst und deshalb sehr komplex und kann immer nur indirekt bestimmt werden. Also ist die Geldpolitik nicht wie das Fahren eines Autos. Das Auto reagiert direkt beim Drehen des Lenkrades, und fährt sofort nach links, wenn nach links gesteuert wird. Das Ergebnis von geldpolitischen Maßnahmen wird aber erst zeitverzögert sichtbar, also eher wie ein Schiff, das bei einer Richtungsänderung durch die Schiffsruder nur zeitverzögert reagiert.
Deshalb ist es für eine krisenfreie Wirtschaft so wichtig, dass die EZB bei geldpolitischen Entscheidungen möglichst viele Faktoren bedenkt und in möglichst kleinen, bedachtsamen Schritten handelt. Nur so kann der Tauschwert des Geldes über möglichst lange Zeit stabil gehalten werden, wenn auch gleichzeitig die Geldmengenentwicklung der Wirtschaftsmengenentwicklung in der langen Sicht und über Jahre angepasst ist.
[11] Statista September 2015