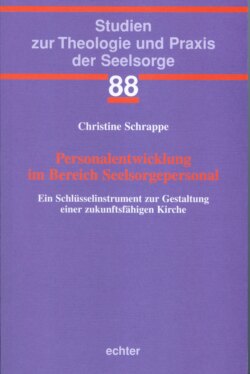Читать книгу Personalentwicklung im Bereich Seelsorgepersonal - Christine Schrappe - Страница 15
2.1 „... dabei hatte ich mir solche Mühe gegeben.“ – Relevanzverlust durch Pluralisierung als Anfrage an das Selbstverständnis von Seelsorgern
Оглавление„Die territorial verfassten Ortsgemeinden sind als Sozialform des Glaubens ungenügend und leiden unter hochgradiger Irrelevanz. Da sie immer noch lokal gebunden und somit wohnraumorientiert sind, verfehlen sie die größeren Lebensräume, in denen sich Menschen mit wechselnden Kombinationen ihrer Lebensorte und Beziehungen bewegen.“28 Viele Pfarreiseelsorger fühlen sich damit auch in ihrer Rolle als „hochgradig irrelevant“.29
Kirche steht unter dem Zustimmungsvorbehalt ihrer eigenen Mitglieder. Anders als in Zeiten der herkunftsbezogenen religiösen Schicksalsgemeinschaft steht damit auch der einzelne Seelsorger mit seiner fachlichen und personalen Kompetenz unter Beobachtung und wird als Vertreter der Institution Kirche beurteilt. Das kognitive Wissen um eine Pluralisierung der Anbieter auf dem Gebiet der Sinnstiftung, der Kultur- und Freizeitgestaltung nimmt dem einzelnen Seelsorger als „Mitanbieter“ nicht den Schmerz, selbst mit großem Zeitaufwand und hoher Profession eine Predigt oder einen Elternabend vorbereitet zu haben und dann zu erkennen, dass alternative Angebote oder die häusliche Entspannung attraktiver waren. Heterogene Ansprüche in der Pastoral sind Ausdruck einer Deregulierung. Es ist kaum vorhersehbar, welche Gottesdienste gut besucht sein werden, welche Bildungsangebote auf Resonanz stoßen.
Die „Marktsituation“ der katholischen Kirche zu akzeptieren, fällt vielen Mitarbeitern, insbesondere im pastoralen Bereich schwer. Bucher unterscheidet dabei verschiedene Motive: Diese kritische Position gibt es in einer „konservativen, institutionsstolzen“ wie in einer „progressiven, kapitalismuskritischen Variante“.30 Die Abwehrreaktion ist verständlich, wenn der Eindruck entsteht, die Kirche hätte ein „austauschbares Produkt“ anzubieten, was zugleich impliziert, dass auch die Anbieter und Verkäufer austauschbar sind.
Als ein weiterer, nicht zu unterschätzender Kränkungsfaktor ist in diesem Zusammenhang die steigende Zahl der Kirchenaustritte zu nennen. Die „Transformation der Kirche von einer Zwangs- in eine Freiwilligengemeinschaft“31 bedeutet, dass die Kirchenmitgliedschaft dem Kosten-Nutzen-Kalkül des Einzelnen unterstellt wird.
Sowohl eine Organisation als auch der einzelne in ihr und für sie Tätige muss damit umgehen, dass man nichts, oder zumindest nicht viel von ihr wissen will. Der Stolz „dazuzugehören“ schwindet bei haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern. Hier unterscheiden sich Institutionen nicht allzu sehr von Personen: Beide sind gekränkt. Als nahe liegende Möglichkeit der Deutung und Reaktion nennt Bucher die depressive Passivität, welche die Ausgetretenen als „Abgesprungene“ und „Abtrünnige“ denunziert; als Gegenstück dazu findet sich bei nicht wenigen, insbesondere jüngeren Seelsorgern die Flucht in den betriebsamen Aktivismus, welcher auf Kränkungslinderung durch betäubende Selbstbeschäftigung hofft. Beide Kränkungsstrategien sind theologisch wenig reflektiert, sozialpsychologisch jedoch verständlich.
Die rückläufige Zahl der Gottesdienstbesucher, die weder durch ansprechende Predigten des Pfarrers noch durch kindgerechte Gestaltung der Gemeindereferentin oder durch lange Vorbereitung im Liturgieausschuss aufgehalten wird, birgt hohes Kränkungspotenzial für die pastoralen Mitarbeiter. Die aufwändig vorbereitete liturgische Nacht für die Jugend war nicht für eine Kleingruppe gedacht, die sich am Ende, trotz schummrigen Lichtes und abgeteilter Kirchenbänke noch im Kirchenraum verliert. Der Jugendkreuzweg, der überwiegend aus Teilnehmern des Vorbereitungsteams besteht, ist eine Enttäuschung für den Dekanats- oder Diözesanjugendseelsorger.
Pluralisierung der Geschmacksmilieus und der spirituellen Bedürfnisse führt zur Notwendigkeit pastoraler Differenzierungen und Pluralisierung auch innerhalb der Pastoral. Dabei muss die bestehende kirchentreue „Klientel“ gehalten und „gepflegt“ werden, neue Adressatenkreise, Milieus und Zielgruppen gilt es zu erschließen und anzusprechen. Seelsorger sehen sich heute einer großen Bandbreite an liturgischen Erwartungen gegenüber: Da ist die „relativ stabile und große Zahl von motiviert praktizierenden Gliedern der Kirche, die sich für eine lebendige und glaubwürdig gefeierte Liturgie am Ort ihres kirchlichen Lebens einsetzen. Unübersehbar ist aber zweitens die nicht zu unterschätzende Zahl der traditionell oder traditionalistisch eingestellten Gemeindemitglieder, die sich in der Tridentinischen Messe beheimatet fühlen und oder zu ihr wegen einer überbordenden liturgischen Experimentierwilligkeit in Pfarreien und anderen kirchlichen Gemeinschaften Zuflucht nehmen. Daneben gibt es drittens eine große und stets größer werdende Zahl von Kirchenmitgliedern, die ihre Kirchenzugehörigkeit weitgehend passiv leben und vor allem oder nur an den Hochfesten und an den Knotenpunkten ihres Lebens unter Tatbeweis stellen und die deshalb vor allem passagerituelle Erwartungen an den Gottesdienst der Kirche herantragen. Viertens ist an jene Kirchenglieder zu denken, die zwar getauft sind, aber sich eigentlich in einem präkatechumenalen Zustand aufhalten und die man am ehrlichsten als getaufte Katechumenen bezeichnet. Nicht zu vergessen ist fünftens die bedrängend große Zahl von Randchristen und Fernstehenden, von Konfessionslosen und Ungetauften in der heutigen säkularen Gesellschaft, die dennoch relativ hohe Erwartungen an die gottesdienstliche „Dienstleistung“ der Kirche haben.“32 Wenngleich in allen genannten Erwartungsmilieus die Sehnsucht nach „Wandlung“ und „Verwandlung“ zu spüren ist – in je eigener Ausformung und Ausdrucksweise –, wissen der Priester und die Seelsorger vor Ort um die Unmöglichkeit der Befriedigung aller Bedürfnisse. Es gilt der Gefahr überzogener Partizipationsansprüche gegenüber Menschen mit geringer Kirchenbindung zu begegnen.
Das breite Panorama der Spiritualitäten wird in jeder Eucharistiekatechese deutlich, wenn die Bandbreite der elterlichen Gestaltungsvorschläge vom esoterischen Naturerleben einer Nachtwanderung mit Baumverehrung bis hin zur verpflichtenden Teilnahme an wöchentlichen Rosenkranzandachten für Kinder reicht. Der einzelne Seelsorger kann sich nun entscheiden, von welcher Seite er Kritik, Lob, Unterstützung oder Widerstand im Gemeindealltag riskieren, ertragen und theologisch verantworten kann.33 Und immer sieht er sich unter dem Erwartungsdruck, Positionen vertreten zu müssen, die er selbst kaum verantworten kann.34
Eine Pluralität der Kirchenbilder impliziert auch divergierende Vorstellungen von Leitung und Kirchlichkeit: Der Wunsch nach mehr Strenge und klarer Struktur steht neben der Forderung nach mehr Freiheit und Selbstbestimmung. Der Seelsorger vor Ort sieht sich selbst innerkirchlich einer Vielzahl von Spiritualitäten, Leitungswünschen, Zukunftsvisionen und Ansprüche an Leitung gegenüber.35 Die Anforderungen „von außen“ werden pluraler und unübersichtlicher, die innerkirchlichen Zeichen stehen auf Straffung und Bündelung. Personalabbau, Rückgang finanzieller Ressourcen und gewandeltes Ehrenamt betreffen wieder direkt den Seelsorger als Person. Pfarreien werden zusammengeführt, diözesane Arbeitsstrukturen gestrafft, Abteilungen und Dienstleister innerhalb der Diözese werden aufgelöst oder umgelegt.
Zielgruppenorientierung und Ständepastoral, mit der der gesellschaftlichen Pluralisierung begegnet wurde, werden nun zur „Altlast“ für die vor Ort Tätigen. Unter den Jungsenioren (im Unterschied zu den klassischen „Alten“, die am Seniorennachmittag zum Pfarrsaal gefahren werden, bis hin zu den Pflegebedürftigen) befinden sich zufriedene Vorruheständler, enttäuschte Langzeitarbeitslose, hochaktive Freiberufler, glückliche Großeltern, Singles, die nie verheiratet waren, tief religiöse, aber zunehmend auch kirchlich desinteressierte, vielleicht aber kulturell aufgeschlossene Menschen. Die Pluralisierung in diesem Fall bedeutet für die Pastoral, dass Schwerpunkte gesetzt werden müssen, dass Prioritäten und Posterioritäten zu bestimmen sind, dass im Sinne einer lebensraumorientierten Pastoral delegiert und kooperiert werden muss. Die Praxis zeigt aber, dass in Veränderungsprozessen derjenige, der notwenige Schritte (z.B. die Reduktion der Anzahl von Eucharistiefeiern oder die Zusammenführung von Katechesen im pastoralen Raum) proaktiv und zukunftsträchtig umzusetzen beginnt, dafür angefeindet und bestraft wird, im schlimmsten Falle als faul oder „untreuer Hirte“ gilt, der ohne Not die „Weide eng macht“ und die „Herde“ im Stich lässt.
Viel mehr als Theologen in Referaten und Abteilungen eines Ordinariates klagen Territorialseelsorger über mangelnde Freiräume zum Experimentieren. Eine Gemeinde, die sich treu Jahr für Jahr an den vorgegebenen Diözesan- und Weltkirchenmottos „abarbeitet“36, ist irritiert und überfordert, wenn nun von der Diözesanleitung eine „Gemeindeanalyse“, „lebensraumorientierte Schwerpunktsetzungen“ und „Kooperationsvereinbarungen“ erwartet werden. Neben diesen Interventionen von außen ersinnen die praktischen Theologen als die von der Gemeinde freigestellten Denker ständig Modelle und neue Anregungen für die Gemeinden. „Dieses Hase-Igel-Spiel ermüdet auf Dauer jeden Praktiker.“37
Die diözesanen Themenvorgaben des „zweiten Kirchenjahres“ halten in Bewegung, ohne zu bewegen. Das „zweite Kirchenjahr“ symbolisiert die Gemeinschaft mit der Diözese und der Weltkirche, birgt aber die Gefahr für dauerhaften „thematischen Stress“. Die bunt zusammengewürfelte, oft ohne innere Logik zusammengestellte Mischung der Plakate im Schaukasten, die gehäuften Aufrufe zu Spenden und Sonderaktionen im Pfarrbrief und schließlich die mühsam „gedehnten und gebogenen“ Predigten, die versuchen das vorgeschriebene Sonntagsevangelium mit dem jeweiligen Diözesanmotto zusammenzubinden, sind mehr Zeugnis von Überforderung und Hilflosigkeit, denn von lebendiger Vielfalt.
Nicht nur die Praktiker in den Gemeinden verzweifeln an dem Vielerlei und manchmal auch an der Banalität der Alltagsanforderung. Auch Leitungsverantwortliche der Diözesen leiden unter dem Sog des Alltagsgeschäftes, dem operationalen Druck, unter welchem theologische Reflexion, das Entwerfen eines langfristigen Veränderungsmanagements und Lenkungsstrategien zu kurz kommen.