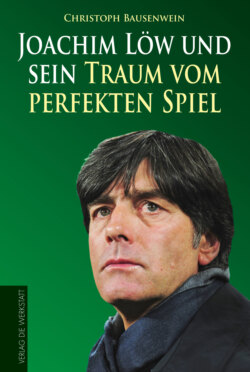Читать книгу Joachim Löw und sein Traum vom perfekten Spiel - Christoph Bausenwein - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKAPITEL 2
Als Lehrling in der Schweiz
oder: Ein Erweckungserlebnis in der Fußballprovinz
Vor der EM 2008 bezog der DFB-Tross unter dem Bundestrainer Joachim Löw Quartier im Hotel Giardino in Ascona am Lago Maggiore. Ausgesucht hatte man es bereits zu einem Zeitpunkt, als die Gruppengegner und Spielorte noch gar nicht bekannt waren. So kam es zu dem eigentlich unglücklichen Zusammentreffen, dass die im Süden der Schweiz wohnende deutsche Auswahl in den Flieger steigen musste, um zu den im östlichen Österreich liegenden Stadien zu gelangen, in denen ihre Vorrundenspiele angesetzt waren. Ein schlimmer Planungsfehler, möchte man meinen. Halb so schlimm bzw. gar nicht schlimm, meinte hingegen der Bundestrainer Löw. Er wollte eben einfach gern in der Schweiz wohnen. Weil es im Tessin so ruhig ist. Und natürlich auch – aber das sagte er so natürlich nicht –, weil er eine besondere Beziehung zur Schweiz hat. Der Trainer Löw ist in der Schweiz sozialisiert worden, ja man könnte sagen, ohne Löws Schweizer Erfahrung wäre aus dieser Nationalmannschaft niemals jene geworden, die sie heute ist. Die fulminante Entwicklung der deutschen Nationalelf in den letzten Jahren lässt sich nicht nachvollziehen, wenn man nicht auf das besondere Verhältnis ihres Trainers zur Schweiz eingeht. Geboren ist Löw zwar in Baden, seiner Seele nach ist er aber auch ein Gefühlsschweizer.
Worum es bei diesem helvetischen Einfluss geht, konnte man bereits im Genfer Trainingslager vor der WM 2006 erleben. Löw war damals noch Assistent und als solcher für die taktische Neuausrichtung des Teams zuständig. Einmal ließ er die deutsche Elf testhalber gegen die U17 von Servette Genf antreten. Die deutschen Elitekicker gewannen standesgemäß mit 12:0. Aber der Sieg war den Klinsmännern schwerer gefallen als gedacht. Ungefähr eine halbe Stunde lang hatten die Schweizer Jugendlichen sehr gut standgehalten. Ihre Viererkette funktionierte, das gesamte Team beherrschte das ballorientierte Verschieben mit schlafwandlerischer Sicherheit. Deutsche Beobachter waren verblüfft. »Das kann hier in der Schweiz jede U17«, erklärte Löw. Und er sah sich bestätigt in dem, was er seit seiner Ernennung zum Bundestrainer-Assistenten immer wieder gepredigt hatte: dass der deutsche Fußball sich öffnen müsse und endlich reagieren müsse auf taktische und trainingsmethodische Änderungen im internationalen Fußball.
Der Assistent Löw zeigte sich 2006 in Genf als akribischer Arbeiter, der sich nicht davor scheut, selbst mit routinierten Profis noch das Fußball-Einmaleins zu üben. »Wir müssen in Deutschland lernen, im Training noch seriöser zu arbeiten. Das sind oft einfache Dinge«, bemerkte er. Und so ließ er gestandene Nationalspieler wie Arne Friedrich, Per Mertesacker, Christoph Metzelder und Philipp Lahm die Grundlagen einer Vierer-Abwehrkette üben – also das, was die U17 von Servette bereits sehr gut beherrschte.
Dieses Spiel war eine Art Anschauungsunterricht für das, was er tags zuvor bei einer Pressekonferenz ganz im Geiste Rudi Völlers erklärt hatte. Die Ansprüche der sogenannten Experten an den deutschen Fußball seien im Verhältnis zu dessen überschaubarer Qualität viel zu hoch, in Deutschland sei die Ausbildung rückständig. Die Quintessenz also: »Wenn einer die Grundrechenarten nicht beherrscht, kann man auch nicht sagen: Du wirst später mal Professor.« Als der Satz fiel, lachten die Journalisten. Aber Löw meinte es durchaus ernst. Die deutsche Nationalmannschaft, wollte er damit sagen, beherrsche nicht einmal die Grundrechenarten. »Wir üben hier elementare Dinge, die eigentlich zum Trainingsprogramm jeder U16 oder U17 gehören.« Er musste also nachholen, was man in Deutschland jahrzehntelang versäumt hatte. Nämlich Fußballspielern eine Grundausbildung verpassen. Ihnen zeigen, wie eine Viererkette funktioniert, wie man sich ballorientiert verschiebt, wie man mit vertikalen Kurzpässen das Spiel eröffnet. Und so ließ Löw die ihm anvertrauten Bundesligastars üben wie ABC-Schüler: Abstände einhalten, Verschieben, die richtigen Laufwege antizipieren. Immer wieder. Verschieben! – Laufwege, Abstände einhalten – Verschieben! – Laufwege, Abstände einhalten – Verschieben! – Laufwege, Abstände einhalten …. und so weiter und so weiter. Damit sie es irgendwann so gut beherrschen würden wie eine Schweizer U17.
Und irgendwann, in den Pausen zwischen dem Üben, erklärte er seinen Spielern wie einst Klinsmann die Vorteile der Viererkette, vielleicht in zwei Minuten, etwa so:
Die Viererkette ist ein Defensivsystem, in dem jeder der vier Abwehrspieler in der Grundformation etwa ein Viertel der Spielfeldbreite abdeckt. Jeder orientiert sich im Raum und am Mitspieler; Gegenspieler, die ihre Position wechseln, werden übergeben; die Kette verschiebt sich kompakt, immer am Ball orientiert. Die Vorteile: Erstens: Da er sich im Raum und am Mitspieler orientiert, weiß jeder Abwehrspieler immer, wo er verteidigen muss. Zweitens: Weil die Verteidiger auf Manndeckung verzichten und die Laufarbeit rochierender Gegner nicht mitmachen, sparen sie Kraft. Drittens: Durch das kollektive Verschieben zum Ball – nicht nur in die Breite, sondern auch in die Tiefe – wird der Abwehrraum optimal verdichtet, die Passwege des Gegners werden zugestellt. Und viertens: Im Zusammenwirken des gesamten Defensivverbundes ergeben sich weitere Vorteile. Durch den Verzicht, weitab stehende Gegner zu decken, werden Mitspieler frei, den ballführenden Spieler in Überzahl zu attackieren – er kann »gedoppelt« oder sogar »getripelt« werden –, die Chance auf Ballgewinn wird dadurch erhöht; und weil man den Raum aktiv beherrscht und deswegen die bei der Manndeckung nach dem Ballbesitzwechsel nötige Phase der Neuorientierung entfällt, ist immer ein schnelles und geplantes Umschalten auf die Angriffspositionen gewährleistet.
Fußball-Neuland in Rheinfall-Nähe
Deutsche Beobachter rieben sich in Genf ungläubig die Augen: Da stand der Assistenztrainer einer Fußball-Großmacht am Rande des Trainingsplatzes, um aus hochdotierten, aber taktisch rückständigen Bundesligastars versierte Viererketten-Versteher zu formen – und behauptete, dass man von der kleinen Schweiz fußballerisch einiges lernen könne! Das war ein geradezu ungeheuerlicher Vorgang. Aber er ist erklärbar. Die Ursache liegt in Löws sechsjähriger Trainerlehrzeit in der Schweiz.
Erstmals mit dem »Schweizer System« konfrontiert wurde der spätere Bundestrainer beim FC Schaffhausen, zu dem er 1989 als Spieler gewechselt war. Der 1896 gegründete Klub zählt zu den ältesten Schweizer Fußballvereinen, wenngleich nicht zu den erfolgreichsten. Die meiste Zeit spielte der Verein nur zweitklassig, nämlich in der Staffel Ost der Nationalliga B. So war es auch, als sich der deutsche Fußballroutinier Joachim Löw den an Borussia Dortmund erinnernden gelb-schwarzen Dress überstreifte. Immerhin: Der Verein aus dem nur 20 Kilometer jenseits der deutschen-schweizerischen Grenze liegenden – und nur 80 Kilometer von Schönau entfernten – kleinen Städtchen am Oberrhein spielte in der 2. Liga oben mit. Nach Platz eins im Jahr 1992 scheiterte das Team, in dem Löw eine Hauptrolle übernommen hatte, erst in der Aufstiegsrunde. In einem fremden Land sei man mehr gefordert als in heimatlicher Umgebung, erinnert sich Löw an sein drei Jahre währendes Engagement in Schaffhausen. »Als Ausländer und Mannschaftskapitän haben die Leute besonders viel von mir erwartet.« Aber das habe auch sein Gutes gehabt. Er sei »vom Egoisten zum Mannschaftsspieler gereift«, er habe gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Sein Mannschaftskollege Joachim Engesser bestätigt diese Selbsteinschätzung. Der Kapitän sei sehr zielstrebig und ehrgeizig gewesen, dabei aber immer auch kollegial, ein perfekter Führungsspieler eben. Ein anderer Mitspieler, der Verteidiger Mirko Pavlicevic, meint gar: »Löw hat schon damals auf dem Platz wie ein Trainer gedacht und den jungen Spielern viel geholfen.«
Wichtig für diesen späten Reifeprozess war nicht zuletzt der Trainer in Schaffhausen, Rolf Fringer. Der im schweizerischen Adliswil geborene Österreicher, ganze drei Jahre älter als Löw, sieht sich selbst rückblickend als Lehrmeister des späteren Bundestrainers. »Wenn man heute wie selbstverständlich in Deutschland Pressing und 4-4-2 spielt«, so seine Feststellung, »muss man sagen, dass diese Art des Fußballs Mitte der Neunziger Neuland war. Deutschland hatte zwar immer eine starke Nationalmannschaft, war aber hausbacken in punkto Kreativität und Taktik. Löw hat da Pionierarbeit mitgeleistet, und das geht klar auf unsere damalige Arbeit in der Schweiz zurück.« Der junge Trainer, erst seit Kurzem mit einem Diplom ausgestattet, war Vertreter einer neuen, innovativen Generation von Fußball-Lehrern. Der Titel seiner Abschlussarbeit – »Möglichkeiten des offensiven Zonenspiels« – hätte auch als Überschrift für sein Trainingsprogramm gepasst, das dem neusten Stand der fußballtaktischen Entwicklung entsprach. Fringer schätzte den »unbedingten Siegeswillen« seines deutschen Schülers und erkannte in ihm sofort »eine absolute Führungspersönlichkeit, auf und neben dem Platz«. Und bald wurde ihm klar, dass der Zweitligaspieler aus Deutschland nicht nur ein »Leader« war, der für das Kapitänsamt perfekt taugte, sondern dass er auch ein ausgeprägtes Verständnis für die Feinheiten des Mannschaftsspiels mitbrachte.
Für den Lehrling Joachim Löw tat sich eine neue Welt auf. Bis dahin hatte ihm im geradezu hinterwäldlerischen Deutschland, in dem die übliche Traineransprache von Begriffen wie Manndeckung und Grätsche oder Rennen und Kämpfen dominiert war, noch keiner zeigen können, wie man das Spiel strategisch und taktisch durchdringt. Die typisch deutsche Trainermethode ging laut Löw etwa so: Der »Übungsleiter« nimmt eine Handvoll Kieselsteine vom Boden auf und wirft dann ein Steinchen nach dem anderen weg. Bis 50 Runden gelaufen sind. Eine typische Anweisung vor dem Spiel hatte die Form: »Jogi, du spielst heute im Sturm und guckst, dass du ein Tor machst.« Aufklärung über Systeme und Taktik? Fehlanzeige. Und wenn der Jogi dann kein Tor gemacht hatte, fiel manchem Trainer nur die Aufforderung ein, nun eben noch mehr zu kämpfen und sich den Arsch aufzureißen. Für den Empfänger der Botschaft war das aber unbefriedigend. »Oft hatte ich das Gefühl, durchaus schon alles aus mir herausgeholt zu haben«, berichtet Löw über seine Ratlosigkeit als Spieler, »also musste es doch ein anderes Problem geben.«
Als Profi hatte Joachim Löw zum Teil unter durchaus namhaften Trainern gekickt, etwa Jürgen Sundermann, Lothar Buchmann, Werner Olk oder Jörg Berger. Immer hatte er sehr genau hingehört auf die Anweisungen und nachgefragt, wenn er etwas nicht genau nachvollziehen konnte. Richtig überzeugend aber fand er nur Jörg Berger. Und natürlich Rolf Fringer. »Fringer war ein Trainer, der mir Antworten auf meine Fragen geben konnte«, lobt Löw seinen Lehrmeister. Und der lobt zurück, dass er den Joachim nicht nur als einen Menschen mit untadeligem Charakter erlebt habe, immer offen, ehrlich und aufrichtig, sondern auch als Spieler »mit sehr viel Verstand«. Für seine spätere Trainerkarriere hätten ihm die Erfahrungen in der Schweiz sicher sehr geholfen. Da habe er seinen taktischen Horizont erweitern und lernen können, dass es auch andere Wege gibt als Hauruck-Fußball. »Er hat mich sehr oft befragt, wie bestimmte Dinge funktionieren. Das war eben alles Neuland für ihn. Da habe ich gemerkt, dass er sich schon als Spieler sehr viele Gedanken über solche Dinge macht.«
Joachim Löw, der Trainer in spe, hatte in Fringer einen Lehrmeister, von dem er in taktischen Dingen viel lernen konnte. Etwa, wie die »Zonenverteidigung« (zu Deutsch: Raumdeckung) funktioniert, was Pressing ist und wie man ein geplantes Offensivspiel aufzieht. Sie hätten damals viel miteinander diskutiert, beim Training und danach, so Fringer. Und dabei habe der Jogi die Fähigkeit an den Tag gelegt, immer das Ganze im Auge zu behalten – so eben, wie das ein guter Trainer können muss. »Seine Art und Weise, das Spiel zu analysieren, die Art, seine Vorstellungen klar und deutlich zu vermitteln, und sein offensiv ausgerichtetes System, das hat mich schon geprägt«, bekennt er heute. Damals schätzte der Spieler Löw den Trainer Fringer aber nicht nur als Taktikexperten, der ein mutiges Offensivspiel propagierte, sondern auch als lebenslustigen und fröhlichen Typen, der sein Team stets bei guter Laune halten konnte.
Die Schweiz entpuppte sich für den Badener Löw als eine ganz neue Fußballwelt. Er erkannte, »dass es nicht genügt, nur auf sich zu schauen, dass man an das Ganze denken muss«. Er erkannte, dass man über den Tellerrand hinausschauen muss. Und er erkannte, dass im Fußball viele Möglichkeiten stecken, die er im Fußball-Entwicklungsland Deutschland noch gar nicht wahrgenommen hatte.
Jogi mit Contini in Winti
Als Fringer 1992 zum FC Aarau wechselte, um dort Meister zu werden, ging sein inzwischen bereits mit ersten Trainerscheinen ausgestatteter deutscher Schüler zum FC Winterthur. Löw hatte sich in Schaffhausen sehr wohlgefühlt, wo er regelmäßig im freundschaftlichen Kreis mit Fringer und einigen Mitspielern zum Mittagessen in der Altstadt-Wirtschaft »Kastanienbaum« eingekehrt war. Dennoch war nicht alles eitel Sonnenschein gewesen: Nach drei Jahren hatten sich Fringer und der Kreis seiner Führungsspieler mit dem Präsidenten Aniello Fontana verkracht, weil der sich in sportliche Angelegenheiten hatte einmischen wollen. »Die Episode, wie Fontana vor der Heimreise von einem Auswärtsspiel der Zutritt zum Mannschaftsbus verweigert wurde, ist in der Stadt legendär«, schrieb die »Aargauer Zeitung«.
Winterthur – oder »Winti«, wie die Einheimischen den Ort im Kanton Zürich nennen – sollte die letzte Station seiner Karriere als Fußballspieler sein; daher war er bestrebt, als Coach der dortigen A-Jugend einen Neuanfang zu proben. Der Trainerjob reizte ihn, und so beschloss er, in der Schweiz alle nötigen Pflichtscheine zu erwerben. Im Ausbildungszentrum des Schweizer Fußballverbandes in Magglingen würde er so gute Lehrmeister finden wie kaum anderswo. Und die höchste Ausbildungsstufe, das Schweizer Nationalliga-Trainerdiplom, war auch in Deutschland anerkannt.
Der FC Winterthur spielte wie der FC Schaffhausen in der Nationalliga B/Ost. Der nebenberufliche A-Junioren-Trainer Löw glänzte dort im Herbst seiner Karriere als Kapitän, Spielmacher und Torjäger. Sein ehemaliger Mitspieler René Weiler erlebte ihn als »absolute Persönlichkeit«, als Musterprofi mit Rückgrat. Der Kapitän hatte klare Ansichten und scheute sich auch nicht, seine Meinung dem damaligen Trainer Wolfgang Frank unmissverständlich vorzutragen. Das bestätigt auch Giorgio Contini, damals ein hoffnungsvolles Stürmertalent. Sein Kapitän Löw, dessen taktisches Verständnis das seiner Mitspieler weit überstiegen habe, habe die Dinge oft selber in die Hand genommen und keine Auseinandersetzung mit dem Trainer gescheut. Manchmal freilich sei er auch etwas zu weit gegangen, weiß Contini zu berichten. Einmal hatte der Kapitän den Trainer in der Kabine verbal angegriffen. Jogi habe dann aber schnell eingesehen, dass sowas unmöglich war: »Tags darauf ist er vor der Mannschaft gestanden und hat sich entschuldigt. Ich denke, dies war für seine spätere Trainerkarriere eine wichtige Erfahrung.« Löws große Karriere, meint sein ehemaliger Mitspieler, habe ihn von daher eigentlich gar nicht erstaunt. Schon damals sei klar gewesen, »dass er es einmal weit bringen würde«. Dem Stürmer-Kollegen Patrik Ramsauer ist vor allem der coole Vollstrecker in Erinnerung geblieben: »Ich wurde häufig im Strafraum gelegt, und Jogi Löw erzielte per Elfmeter das Tor.« Beeindruckt hat Ramsauer aber auch der schier unstillbare Wissensdurst seines Kapitäns: »Er hat die Fußballzeitschriften wie den ›Kicker‹ richtiggehend auswendig gelernt, er wusste einfach alles.«
1994 wäre der »Kicker«-Fachmann beinahe von der Winterthurer »Schützenwiese« zum nahegelegenen »Reitplatz« des kleinen FC Töss gewechselt. Dort hatte man mitbekommen, dass der Winterthurer Kapitän ins Trainergeschäft einsteigen wollte. »Obwohl ich das Mittagessen im Restaurant Wiesental in Ohringen berappte und ihm ein Klubheft mitgab, erhielt ich zwei Tage später eine Absage«, erinnert sich der Tössener Präsident Müller. Joachim Löw übernahm stattdessen als Spielertrainer den drittklassigen FC Frauenfeld (er spielte in der den Nationalligen A und B nachgeordneten 1. Liga).
Spielertrainer beim FC Frauenfeld
Der neue Spielertrainer aus Deutschland hatte in der Saison 1994/95 maßgeblichen Anteil daran, dass die im Vorjahr beinahe abgestiegenen Thurgauer hinter dem SC Brühl und dem FC Altstetten in ihrer Liga einen respektablen dritten Rang belegten und damit die Teilnahme an der Aufstiegsrunde in die Nationalliga B nur knapp verpassten. Mit dabei in Frauenfeld waren auch zwei Weggefährten aus der Winterthurer Zeit. Urs Egli assistierte im Training, Stürmer Contini sorgte für die Tore. Nach einer schwierigen Saison mit dem FC Winterthur, wo man ihn aussortiert hatte, stand Continis Karriere damals auf der Kippe. Der erst 20-jährige Stürmer war bereits dabei, seinen Traum von der großen Karriere zu beerdigen. Aber dann wurde er in Frauenfeld unter der Anleitung Löws Torschützenkönig der 1. Liga. Contini schaffte den Sprung in die Nationalliga A zum FC St. Gallen. Dort wurde er im Jahr 2000 Schweizer Meister und kurz darauf auch Nationalspieler. »Eigentlich habe ich es nur dank Löw so weit geschafft«, ist sich Contini sicher. Löw habe die besondere Qualität, einen Spieler starkzureden und ihm Selbstvertrauen einzuimpfen. Besonders beeindruckt habe ihn die Sozialkompetenz des späteren Bundestrainers. »Als Trainer des FC Frauenfeld verstand er es, den Spielern die Freude am Fußball zu vermitteln – egal welche Probleme diese von der Arbeit oder von zu Hause ins Training mitgenommen haben.« Diese Fähigkeit war bemerkenswert für einen derart jungen Trainer, der mit seinem Job gerade erst begonnen hatte. »Er hat eine große Ausstrahlung, ohne überheblich zu wirken«, urteilt Contini über den Bundestrainer bei der WM 2010. Sicherlich werde Löw von den deutschen Nationalspielern genauso geschätzt und respektiert wie damals von seinen ersten »Schülern« in Frauenfeld. Er persönlich jedenfalls, so Contini, habe während der WM in Südafrika oft an den Jogi von damals denken müssen. »Wenn ich sehe, wie bei dieser WM Miroslav Klose aufblüht, kommt mir meine eigene Geschichte in den Sinn.«
Parallel zu seinem Job in Frauenfeld hatte Löw in Magglingen seine Ausbildung als Fußballtrainer vorangetrieben. Er war gerade dabei, den letzten und entscheidenden Schein in Angriff zu nehmen, der ihm die Profilizenz verschaffen würde, da wurde dieser Plan durch ein Angebot seines Ex-Lehrers Fringer durchkreuzt. Fringer hatte in diesem Sommer 1995 soeben ein Angebot des VfB Stuttgart angenommen und benötigte noch einen Co-Trainer. Ob er, Löw, nicht Lust habe dazu? Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen, meinte der 35-Jährige. In Frauenfeld würde er selbstständig arbeiten können, außerdem hatte er sich bereits ein Konzept für die nächsten Jahre ausgedacht. Hier würde er in aller Ruhe seine Idee vom Fußball entwickeln können, zudem stand er beim Verein im Wort. Aber die Chance, nun in der Bundesliga Fuß zu fassen, wollte er sich dann doch nicht entgehen lassen. Klar war ja, dass er keinesfalls auf der »Kleinen Allmend«, wie das Mini-Stadion in Frauenfeld heißt, versauern wollte. Klar war andererseits auch, dass er seine künftige Rolle nicht in der Position des Assistenten sah. Aber das musste er als Übergangsphase wohl hinnehmen, um sein Ziel zu erreichen: Cheftrainer zu werden bei einem großen Bundesligaverein.