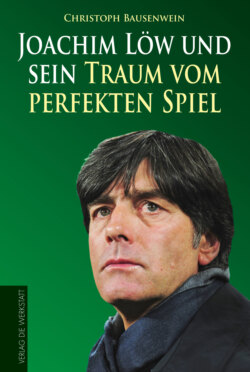Читать книгу Joachim Löw und sein Traum vom perfekten Spiel - Christoph Bausenwein - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKAPITEL 3
Der (zu) nette Herr Löw
oder: Aufstieg und Demontage eines Trainer-Neulings
1995/96 war die erste Bundesliga-Spielzeit, in der es drei Punkte pro Spiel gab. Es waren drei statt zwei Auswechslungen erlaubt. Die Spieler trugen erstmals feste Rückennummern. Und es war die Saison, in der Joachim Löw als Co-Trainer des VfB Stuttgart sein Debüt gab. Auf diesem Posten war er die Wunschbesetzung des neuen VfB-Coaches Rolf Fringer. »Ich kannte seine Einstellung, seine Seriosität und seinen Willen, sich zu verbessern«, begründete Löws Schaffhausener Ex-Trainer seine Wahl. Außerdem sei er »ein ganz vernünftiger Kerl und kein Blender«. Der Kontakt war nach seinem Weggang in Schaffhausen nie abgerissen. »Als dann das Angebot von Stuttgart kam«, schildert Fringer die damalige Situation, »habe ich mich dafür eingesetzt, dass er bei seinem damaligen Verein FC Frauenfeld aus dem laufenden Vertrag kommt.« Also zog Löw von Frauenfeld in das 2.500-Seelen-Örtchen Strümpfelbach im Remstal, von wo aus er das Trainingsgelände des VfB mit dem Auto in einer halben Stunde erreichen konnte. Nächsten Sommer, erklärte er im August bei seinem Amtsantritt als Co-Trainer, wolle er in der Schweiz noch seinen letzten Trainerschein machen. Dann sei er auf dem Stand des Fußball-Lehrers des DFB. Denn: »Klar ist mein Ziel, Cheftrainer zu werden.«
Die VfB-Führung um den mächtigen Präsidenten Gerhard »MV« Mayer-Vorfelder versprach sich viel vom Schweiz-Import Fringer. Denn mit Trainern aus dem südlichen Nachbarland – Helmut Benthaus (Meister 1984) und Jürgen Sundermann (Aufstieg 1977, Vizemeister 1979) – hatte man schon durchaus gute Erfahrungen gemacht. Fringer hatte mit dem FC Aarau 1993 einen Meistertitel geholt; warum sollte ihm das, so wurde spekuliert, nicht auch in Stuttgart gelingen. Schließlich galt der Mann, der am Spieltag stets mit Anzug und Krawatte erschien, als ein Meister der Taktik. In der Führungsetage war man überzeugt davon, dass er der unter anderem mit Spielmacher Krassimir Balakov und Abwehrchef Frank Verlaat wesentlich verstärkten Mannschaft einen modernen und erfolgreichen Fußball beibringen würde.
Fringer führte die Viererkette und die Raumdeckung ein und forderte von seinen Spielern die bedingungslose Unterordnung unter das System. In der Umsetzung seiner Neuerungen wurde er von seinem Assistenten tatkräftig unterstützt. Joachim Löw, so zeigte sich rasch, war kein Hütchenaufsteller, sondern ein selbstbewusster Teamarbeiter. Er war stets loyal, hatte aber auch eine eigene Meinung und trug mit seiner akribischen Arbeitsweise viel zur Trainings- und Spielvorbereitung bei.
Die Ergebnisse freilich, die das innovationsfreudige Trainerteam aus der Schweiz generierte, waren zunächst irritierend. Geschwächt nicht zuletzt durch das Fehlen eines erfahrenen Torwarts – Eike Immel war zu Beginn der Saison verkauft und durch den jungen Marc Ziegler ersetzt worden –, flog der VfB im Pokal gegen den SV Sandhausen raus (13:14 im Elfmeterschießen) und musste in der Bundesliga deprimierende Niederlagen hinnehmen: am 5. Spieltag ein 1:4 im Heimspiel gegen Leverkusen, am 6. Spieltag ein 3:6 in Dortmund, das der »Kicker« als »taktische Trauervorstellung« beschrieb. Doch die Rehabilitation folgte nur eine Woche später, als der VfB die Borussia aus Mönchengladbach mit 5:0 überrannte. In diesem Spiel zeigte die Fringer-Mannschaft ihr großes Potenzial, vor allem in der Offensive, wo das »magische Dreieck« mit Balakov, Bobic und Elber erstmals seine Zauberkünste aufblitzen ließ. Das Team mit dem roten Ring auf der Brust spielte nun konstanter und überzeugte mit erfrischender Spielweise, selbst wenn die Ergebnisse nicht immer stimmten. Eine 3:5-Niederlage in München Ende Oktober kommentierte der Fringer-Assistent Joachim Löw mit den selbstbewusst-süffisanten Worten: »Jetzt haben wir wenigstens dafür gesorgt, dass auch die Münchner mal ein attraktives Spiel gesehen haben.« Zur Winterpause lagen die Stuttgarter hinter den Bayern auf Rang drei.
Doch dann folgte in der Rückrunde der Einbruch, unter anderem bedingt durch den mehrwöchigen Ausfall von Abwehrchef Verlaat. Der VfB rutschte in der Tabelle immer weiter nach unten, am 22. Spieltag musste er mit dem 0:5 gegen Borussia Dortmund die höchste Heimniederlage der Vereinsgeschichte hinnehmen. Das Trainerteam stand machtlos am Spielfeldrand. Während der Co-Trainer mit der Prinz-Eisenherz-Frisur sich hinter seinem dichten schwarzen Haar, das ihm wie ein Visier vor der Stirn stand, zu verstecken schien, bildete sich im Gesicht des rotblonden Chefs, der vorne gezwungenermaßen offen trug, das schiere Entsetzen ab. Am Ende reichte es immerhin noch für den zehnten Platz.
Als Ursache für den Absturz diagnostizierte der »Kicker« die instabile Defensive – 62 Gegentreffer waren die zweitmeisten der Liga, zurückzuführen waren sie unter anderem auf den zu Beginn der Saison vollzogenen Torwartwechsel – sowie die nie gelösten Konflikte des Trainers mit wichtigen Führungs- und Stammspielern. Fringers Rauswurf schien schon vor dem Saisonende nur noch eine Frage der Zeit. Einer Kündigung stand jedoch die schwierige finanzielle Situation des Vereins entgegen, und so herrschte eine gewisse Ratlosigkeit. Als der angeschlagene Fringer schließlich vier Tage vor Saisonbeginn, am 13. August 1996, verkündete, dass er Nationaltrainer in der Schweiz zu werden gedenke, atmete der VfB-Präsident auf. Man werde ihm, ließ er verlauten, keine Steine in den Weg legen. Zum vorläufigen Nachfolger wurde der bisherige Assistent Joachim Löw bestimmt. Der stets loyale Co kommentierte den Journalisten in die Notizblöcke, er sei »sehr traurig« gewesen, als sein Chef in die Schusslinie geraten war. Aber da er nun seinen Dienst vorzeitig quittiert hatte, wolle er sich diese Chance natürlich auch nicht entgehen lassen. Wobei er sich allerdings keine allzu großen Hoffnungen machen durfte: Mayer-Vorfelders Wunschtrainer hieß Nevio Scala. Man hatte den beim AC Parma unter Vertrag stehenden Italiener bereits kontaktiert und wartete nur noch auf das Okay von seinem bisherigen Arbeitgeber.
Der Interimstrainer
Der 36-jährige Cheftrainer-Neuling Joachim Löw hatte zur Vorbereitung des ersten Saisonspiels gegen Schalke 04 ganze drei Tage Zeit. In dem zum Spieltag erschienenen Stadionheft versuchte Löw den Schulterschluss mit den Fans. Seit seiner Zeit als Spieler sei er immer eng mit dem VfB verbunden geblieben, er sei »gerne beim Verein« und wolle »auch gerne hierbleiben«. Wer wollte, konnte hier durchaus eine Bewerbung für den Posten des Cheftrainers herauslesen. Um eine Chance zu haben, musste er aber erstmal Erfolge vorweisen.
Vor dem Anpfiff des Schalke-Spiels machte Löw seine Spieler heiß. »Ganz Deutschland schaut auf euch. Jeder erwartet, dass ihr verliert. Geht raus und beweist, dass ihr als Mannschaft noch lebt!« Und wie die Mannschaft lebte! Am Ende hieß es 4:0, und das ganze Stadion tobte. Was für ein Einstand! Der potenzielle VfB-Trainer Nevio Scala sah es auf der Tribüne und rieb sich verwundert die Augen: »Wieso braucht diese Mannschaft eigentlich einen neuen Trainer? Die spielt doch einen wunderbaren Fußball.« Auch im Umfeld des Vereins kamen Gedanken auf, dass man den sympathischen und im Team respektierten Neuling durchaus behalten könnte, wenn es ihm gelänge, auch die nächsten Spiele ähnlich erfolgreich zu gestalten. Tatsächlich folgten zwei weitere überzeugende Siege – 2:1 gegen Bremen und 4:0 in Hamburg –, die bei Fans und Kommenatoren für Euphorie sorgten. Die »Bild«-Zeitung stellte die rhetorische Frage: »Der nette Herr Löw: Ist er besser als alle Star-Trainer?« Der »Kicker« kürte den Stuttgarter Interimstrainer gar zum Mann des Monats August. »Der 36-Jährige hat die Chance, die er ursprünglich gar nicht hatte, beim Schopf gepackt.« 9:0 Punkte und 10:1 Tore – das konnte selbst der Löw-kritische »MV« nicht ignorieren. »Möglich, dass die Variante Löw eintreten kann«, begann er zu überlegen. Verlockend war die Variante in jedem Fall aus finanziellen Gründen, denn mit seinem Monatsgehalt von 15.000 DM lag der Ex-Assistent nur bei einem Zehntel dessen, was Branchengrößen wie Hitzfeld und Daum verdienten.
Mayer-Vorfelder stand nun unter Druck, selbst ohne konkrete Forderungen des Cheftrainer-Kandidaten. Die Erfolge, die Begeisterung der Fans, die nun sogar zum Training in Massen kamen, und nicht zuletzt die positive Stimmung der Spieler sprachen für sich. Während Fringer den psychologischen Fehler begangen hatte, die Cliquenwirtschaft in der Mannschaft nicht zu unterbinden und sich damit einige Spieler zum Feind gemacht hatte, schien Löw einen neuen Teamgeist entfacht zu haben. Der frustrierte Bulgare Krassimir Balakov, der den Verein bereits hatte verlassen wollen, lebte wieder auf. Den von Fringer als Störenfried aussortierten Thomas Berthold gliederte er ohne Vorbehalte wieder ein. »Wir können nur gemeinsam Erfolg haben«, lautete die Losung des Trainers. Und die Spieler verstanden sie. »Alle haben begriffen, dass sie ihr Ego zurückstecken müssen«, ließ sich Fredi Bobic vernehmen, außerdem mache das Training endlich wieder Spaß, »weil der Jogi die Mannschaft viel mit einbindet«. Löw legte Wert darauf, die Spieler in langen Gesprächen von seinen Ideen und Maßnahmen zu überzeugen. »Ich glaube, dass es das Wichtigste ist, dass die Mannschaft die fachliche Seite anerkennt«, begründete er sein Vertrauen auf die Kraft der Überzeugung. Eine weitere Erklärung für seinen Erfolg sah er darin, dass er die nach dem Weggang von Fringer unter Zugzwang geratene Mannschaft in die Verantwortung genommen und sie bei ihrer Ehre gepackt hatte. »Das hat eine Eigendynamik entwickelt.«
Vor dem Auftritt des VfB am 4. Spieltag in Köln fragte die »Stuttgarter Zeitung«: »Schafft es der freundliche Herr Löw mit dem vierten Sieg auf den Chefsessel?« In der Frage schwang ein leichter Zweifel mit. Diesem so jugendlich wirkenden Jogi, diesem Kumpeltyp, der seine Spieler duzte und locker mit ihnen plauderte, diesem sperrigen Moralisten, der sich gegen die Gepflogenheiten der Branche sperrte, der auf das übliche Ballyhoo verzichtete und sich weigerte, bei Interviews das Südmilch-Label an den Hemdkragen zu pappen, weil er keine »Litfaßsäule« sein wollte, der nicht wie ein Zampano, sondern zuweilen eher wie ein Sozialarbeiter wirkte – diesem so gar nicht in das übliche Trainerklischee passenden Mann traute man irgendwie nicht so recht die nötige Autorität zu, um ausgebuffte Profis dauerhaft zu zähmen. Zwar versuchte sich Löw in martialisch klingenden Sprüchen – »Ich verlange von allen Spielern Disziplin, da kenne ich keinen Spaß«, »Wer sich nicht in den Dienst der Mannschaft stellt, fliegt sofort raus« –, doch wirkten solche Worte im badischen Idiom eher niedlich-bemüht als wirklich überzeugend.
Der nette Herr Löw schaffte seinen vierten Sieg. 4:0 gegen Köln! Nun konnte er locker über sein Image und das Duzen reden. »Die Frage der Autorität und des Durchsetzungsvermögens hängt nach meiner Ansicht nicht von Etiketten und Formalien ab. Wenn der Chef durch Leistung, durch Ideen und durch ein erfolgreiches Konzept überzeugt, dann ist es völlig egal, ob er von seinem Team geduzt oder gesiezt wird. Entscheidend ist allein das Ergebnis.« Und nach weiteren Erfolgen – 1:1 in Dortmund und 2:0 in Karlsruhe – konnte er mit dem Etikett des etwas langweiligen Brävlings ziemlich relaxt umgehen. »Am Anfang hat mich das schon gestört, dass ich da gleich in eine solche Schublade hineingeschoben worden bin, eben nach dem Motto, der ist lieb und nett und auch ein bisschen naiv. Mittlerweile stört es mich aber auch nicht mehr, und es ist ja auch gar nicht so. Ich weiß für mich persönlich, dass ich ganz anders bin und auch einmal kompromisslos durchgreifen kann.« Schließlich sei festzuhalten: »Wenn man es schafft, die Mannschaft mit fachlich guter Arbeit und klaren Vorstellungen zu überzeugen, folgt die Autorität zwangsläufig.«
Löws Bilanz nach sechs Spieltagen war phänomenal: 16 Punkte, 17:3 Tore – Tabellenspitze! Er hatte den launischen Stuttgartern die Flausen ausgetrieben und sie nicht nur siegen, sondern auch noch schönen Fußball zaubern lassen. Worauf war der Erfolg zurückzuführen? Der Schweizer Nationaltrainer Fringer, der soeben das WM-Qualifikationsspiel in Aserbaidschan mit 0:1 verloren hatte, ärgerte sich: »Ich kann nicht mehr ernten, was ich gesät habe«. Aber wie viel Fringer steckte in Löws VfB? »Fringer hatte hervorragende Ideen vom Fußball«, konstatierte Löw. »Nach seinem Abschied war es aber nötig, das vorhandene große Potenzial zu wecken.« Er hatte Poschner und Berthold in die erste Elf zurückgeholt, dem gesamten Team eine gehörige Portion Aggressivität eingeimpft, und schließlich hatte er auch taktisch einige Umstellungen vorgenommen. Statt 4-4-2 ließ er ein 3-5-2 spielen. In der Standard-Dreierkette verteidigte Berthold links, Schneider auf rechts und in der Mitte agierte Verlaat im Stile eines Liberos. Davor sicherten mit Poschner und Soldo zwei defensive Mittelfeldspieler den Spielmacher Balakov ab. Legat und Hagner besetzten die Außenbahnen, ganz vorne sorgten Elber und Bobic für die Tore. Prunkstück des Teams war natürlich das »magische Dreieck« in der Offensive. »Perfekter als zwischen uns drei kann ich mir ein Offensivspiel nicht vorstellen«, meinte Fredi Bobic über sein oftmals brillantes Zusammenspiel mit Balakov und Elber. Wichtig war sicherlich auch, dass Löw zwar ein System vorgab, zugleich aber die Kreativität der Spieler nicht durch sture taktische Vorgaben einengen wollte. Ohne Grundordnung geht nichts, aber ohne die Fähigkeit der Spieler, sie auszugestalten, taugt sie nichts, lautete sein Motto. »Bei uns darf jeder alles machen – wenn die Ordnung stimmt.« Die bündigste Formel für das »Prinzip Löw« fand später Fredi Bobic: »Der Trainer hat sich unsere Stärken angeschaut, sie miteinander verzahnt und uns dann unsere Freiheiten gelassen.«
Neuer Chef in Stuttgart
Präsident Mayer-Vorfelders lang anhaltende Skepsis gegenüber einem Cheftrainer Löw hatte ihre Ursache nicht zuletzt in der Furcht, selbst in die Kritik zu geraten, falls das Experiment mit dem Nobody auf der Trainerbank im Laufe der Saison doch noch fehlschlüge. Aber nun war die Erfolgsbilanz derart angewachsen, dass selbst »MV« eine offizielle Beförderung des ehemaligen Assistenten nicht mehr zu verhindern vermochte. Umfragen hatten ergeben, dass sich über 90 Prozent aller VfB-Fans einen Cheftrainer Löw wünschten. Am Samstag, den 21. September 1996, war es dann endlich so weit. Mannschaftsrat, Verwaltungsrat und Vorstand gaben einträchtig ihre Zustimmung ab. Mayer-Vorfelder, der zu dem Neuen immer noch kein Vertrauen hatte fassen können und weiterhin insgeheim von einem (laut)starken Macho-Trainer à la Christoph Daum träumte, hatte für den Fall eines künftigen Absturzes vorsorglich sämtliche Vereinsgremien in die Verantwortung für den Trainerneuling mit eingebunden. »Der spektakuläre Aufstieg eines Unauffälligen«, wie die »Badische Zeitung« titelte, hatte damit einen vorläufigen Abschluss und Höhepunkt gefunden.
Natürlich kam es dann, wie es kommen musste. Der von seinen Ergebnissen her aktuell beste Trainer der Liga verlor noch am selben Tag sein erstes Spiel als Cheftrainer. Im heimischen Neckarstadion unterlag der VfB der Fortuna aus Düsseldorf durch zwei Gegentreffer in der Schlussphase des Spiels mit 0:2. Prompt unkte der Journalist Martin Hägele, dass es für den Neu-Cheftrainer sehr schnell gefährlich werden könnte, wenn die Kugel öfters so dumm laufen sollte wie gegen Fortuna Düsseldorf. »Irgendwann muss sich ein Cheftrainer durchsetzen. Und das wird für Joachim Löw von nun an schwieriger. Wer auf dem Chefstuhl sitzt, verschafft sich automatisch Gegner.« Formal, so muss an dieser Stelle ergänzt werden, war Joachim Löw allerdings gar nicht der Chef. Denn er war ja nach wie vor nicht im Besitz einer für den Profibereich gültigen Fußball-Lehrer-Lizenz. Die brachte sein Assistent Rainer Adrion mit, den er noch aus seiner Zeit als Spieler beim VfB kannte. In dem sieben Jahre älteren Fußball-Lehrer, der zuvor bei Vereinen wie Ludwigsburg (Aufstieg in die Oberliga) und Unterhaching (Aufstieg in die 2. Liga) erfolgreich gearbeitet hatte, stand Löw ein zuverlässiger und – wie sich bald erweisen sollte – auch in Krisenzeiten loyaler Mitarbeiter zur Seite.
Ein Pokalsieger mit Glatze
Joachim Löw dachte nicht daran, als Cheftrainer seinem bis dahin bewährten Führungsstil untreu zu werden. Er ließ die Peitsche weiterhin im Schrank, setzte auf sanfte Kooperation und bemühte sich wie zuvor, seine Spieler mit guten Argumenten zu überzeugen. »Sie müssen sehen, dass alles, was der Trainer ihnen vermitteln will, logisch und nachvollziehbar ist«, argumentierte er und betonte, dass eine erfolgreiche Zusammenarbeit ohne gegenseitigen Respekt und Vertrauen nicht möglich ist. Erste Ansprechpartner in der Mannschaft waren für den neuen Chef die Führungsspieler Verlaat, Balakov und Bobic. Sie waren nicht nur als Autoritäten anerkannt, sondern darüber hinaus auch in der Lage, die anderen Spieler mit ihrer Erfolgsbesessenheit anzustecken.
Die Mannschaft bot meist ansehnlichen Fußball, leistete sich jedoch zwischendurch immer wieder mal einen Ausrutscher. Nach einer 1:3-Niederlage in Duisburg wetterte der Cheftrainer: »Uns fehlt Cleverness, Abgeklärtheit. Wir spielen zu emotional. Eiskalt zuschlagen, so wie die Bayern, das geht uns ab.« Nach einer weiteren Niederlage am 17. Spieltag (0:2 in Bielefeld), die den VfB seiner guten Ausgangsposition als Verfolger von Leverkusen und Bayern beraubte, kritisierte er das »lethargische und pomadige« Spiel seiner Mannen. Es war klar, dass er keinen »Kühlschrankfußball« à la FC Bayern wollte, dass er weiterhin einstand für eine kombinationsfreudige Spielkultur, attraktiv und mit Risiko. Allerdings sei er auch »nicht der Feingeist, der nur ein schönes Spiel sehen will«. Das hieß ganz banal: Das Ziel ist der Sieg – und der kann nicht immer mit künstlerischen Mitteln erreicht werden.
Es kam die Winterpause, in der Löw den Konflikt zwischen den Leitwölfen Verlaat und Balakov zu beschwichtigen versuchte, den zum Bankdrücker gewordenen ehemaligen Stammspieler Franco Foda endgültig aussortierte und zugleich anderen Spielern, die bislang in der zweiten Reihe gestanden hatten, Mut zusprach. Harmonie herstellen, lautete das zentrale Stichwort, Unstimmigkeiten bereinigen und auch dem letzten Ersatzmann noch zeigen, dass er wichtig und Teil des Teams ist. Und indem Löw in dieser Weise über den Jahreswechsel entschlossen die Zügel anzog, begann sich sein Image zu wandeln. »Ein Mann gewinnt Format«, titelte das »Fußballmagazin« im Januar 1997. Und Mayer-Vorfelder wurde mit dem Satz zitiert: »Der Jogi ist unheimlich cool. Er lässt sich nicht von einer Euphorie anstecken und wird auch nicht in die Tiefe gerissen, wenn etwas schiefläuft.« Begann der Präsident seinem Trainer nun endlich zu vertrauen? Löw blieb vorsichtig. »Tatsache ist, dass man mir im Verein, im Umfeld und auch durch die Medien mit Skepsis begegnet ist. Das ist auch heute noch so. Ich bin nun mal auf dem Prüfstand.« Beinahe drohend fügte er hinzu: »Wenn ich etwas wirklich will, dann versuche ich, es mit jeder Faser meines Körpers, meines Geistes auch durchzusetzen.«
Joachim Löw spürte, dass ihm vom Vorstand nach wie vor nicht das Vertrauen entgegengebracht wurde, das er eigentlich verdient hatte. Als nach einem 2:2 in Bremen zum Rückrundenauftakt schon wieder Kritik aufkam, meinte Torwart Wohlfahrt: »Mit guten Ergebnissen wollen wir darauf pochen, dass der Trainer bleibt.« Tatsächlich waren die Ergebnisse unter dem Strich auch gar nicht so schlecht. Der VfB stand in der Bundesliga auf Platz vier. Außerdem hatte er das Halbfinale im DFB-Pokal erreicht. Gut, man hatte sich da eher hingeschlichen, die Siege gegen Fortuna Köln und Hertha BSC (jeweils im Elfmeterschießen) sowie gegen den FSV Zwickau (2:0) und den SC Freiburg (erneut im Elfmeterschießen) waren so wenig berauschend gewesen, dass kaum jemand darüber sprach. Die Fakten einmal genannt haben wollte der Cheftrainer aber dennoch: »Der VfB stand seit Jahren nicht mehr so gut da wie jetzt.«
Und es sollte noch besser werden. Denn es begann der »goldene März«. 4:1 gegen den HSV, 5:1 beim 1. FC Köln. Mit Traumfußball. Und mit einem noch selbstbewusster gewordenen Löw. »Fußball ist ein Schaugeschäft, und die Darsteller spielen ihre lauten, schrägen, schillernden Rollen darin«, konstatierte er. »Und zu mir sagt man fast vorwurfsvoll: Sie sind ja so normal.« Aber die aktuellen Siege würden ja nun wohl zeigen, dass er bei seinen Erfolgen zu Saisonbeginn nicht nur das Glück des Debütanten auf seiner Seite gehabt hatte, sondern dass auch normale Menschen gute Trainer sein können. So gut, dass deren Ergebnisse sogar beinah unnormal werden konnten. Der VfB fegte den amtierenden Meister Borussia Dortmund mit 4:1 vom Platz. »Ich bin überwältigt und sprachlos«, sagte der »normale Trainer« nun. »Die Mannschaft ist in einer überragenden Spiellaune und unberechenbar geworden.« Aber was heißt unberechenbar? Sie gewann erwartungsgemäß weiter, nun mit 4:0 in Düsseldorf. Die Mannschaft zeigte alles, was den Fußball-Feinschmecker erfreut: Spielfreude, balltechnische Brillanz, Herz und Emotionen, aber auch Disziplin und taktische Raffinesse, und natürlich tolle Tore. Die Euphorie der VfB-Fans war riesig und die Kritik sich einig: Keiner spielt in Deutschland schöner Fußball als der VfB.
Selbst der unermüdliche Löw-Skeptiker Mayer-Vorfel der schien endlich überzeugt. »Joachim Löw ist nah an der Mannschaft, spricht die Sprache der Spieler, hat aber eine natürliche Autorität«, lautete jetzt die präsidiale Einschätzung. »Er verfügt über eine sehr gute analytische Gabe. Alles, was er sagt, trifft später im Spiel ein. Er weiß, dass Fußball Freude machen muss – auch wenn die Spieler nur ihrem Beruf nachgehen. Er hat zwar noch nicht viel Erfahrung, aber er hatte ein Jahr Zeit, um zu beobachten, wie man’s nicht macht. Er ist ein gescheiter Kerl und hat daraus gelernt.« Die These vom zu jungen und zu braven Trainer, vom höflichen, netten und stets unterschätzten Herrn Löw, schien nun endlich zu den Akten gelegt.
Zur Meisterschaft reichte es trotzdem nicht mehr. In den letzten Spielen ließ die Kraft nach, es gab unglückliche Punktverluste und jede Menge Verletzungspech. Vor dem 28. Spieltag lag der VfB auf Platz drei, mit einem Punkt Rückstand auf Leverkusen und sechs auf Bayern. Weil gleich vier Leistungsträger ausgefallen waren (Verlaat, Schneider, Soldo, Legat), verlor der VfB das entscheidende Spiel in Leverkusen mit 1:2. Am Ende landeten die Stuttgarter »nur« auf dem vierten Platz. Aber in ganz Deutschland war man sich einig: Die Stuttgarter mit ihrem »magischen Dreieck« hatten den attraktivsten Fußball der Liga gespielt. »VfB« müsse jetzt neu definiert werden, schrieb der »Kicker«: »Verein für Ballzauber«.
Und es gab ja noch den Pokal. Mitte April hatte man im Halbfinale den HSV mit 2:1 besiegt. Gegner am 14. Juni 1997 im Finale von Berlin war der Zweitligaufsteiger aus Cottbus. Das sollte eigentlich kein Problem sein, zumal man für den Fall der Fälle in dem österreichischen Nationaltowart Franz Wohlfahrt einen in den Pokalspielen gegen Hertha BSC und Freiburg bestens bewährten Elfmetertöter in seinen Reihen wusste. Wohlfahrts Qualitäten waren dann gar nicht gefordert. Der VfB gewann durch zwei jeweils von Balakov aufgelegte Elber-Tore locker mit 2:0. Bei der Pokal-Siegesfeier im Hotel Esplanade mischten sich unter die Freude freilich auch ein paar Tränen der Trauer, da der Wechsel des famosen Giovane Elber zum FC Bayern bereits beschlossene Sache war. Für Löw stand trotzdem fest, dass diese Saison für ihn nicht nur Genugtuung, sondern Ansporn zugleich bedeutete. Als die Pokalsieger auf dem Marktplatz in Stuttgart von 20.000 jubelnden VfB-Fans begrüßt wurden, erschien der Erfolgstrainer mit einer Glatze, die ihm Gerhard Poschner verpasst hatte. Für Thomas Berthold, der in dieser Saison noch einmal aufgeblüht war, stand fest, wen man zum Trainer des Jahres küren musste: Joachim Löw. Seine Begründung: »Wir sind Pokalsieger, haben lange um den Titel mitgespielt und schließlich nur wegen Verletzungen und Sperren den Anschluss verpasst. Er hat alle eines Besseren belehrt und bewiesen, dass er besonders im psychologischen Bereich allen was vormachen kann.«
Führungsmangel und Winterkrise
Voller Zuversicht ging der junge Stuttgarter Coach in seine zweite Saison als Verantwortlicher an der Seitenlinie. »Ich bin heute der Ansicht, dass es viel schöner ist, Trainer zu sein statt Spieler«, ließ er sich in der Sommerpause vernehmen. »Der Trainer hat eine komplexere und vielseitigere Aufgabe. Als Trainer gibt es keinen Stillstand, man ist stets gefordert.« Einige Monate später hätte er sich sicherlich gewünscht, etwas weniger gefordert worden zu sein als in dieser prekären Saison. Aber erst einmal sah ja alles noch gut aus. Er hatte einen Titel geholt und sich bewährt. Er hatte schwierige Profis ins Team eingebunden und schwächelnden Spielern neues Selbstbewusstsein verpasst. Und am Ende, so schien es, hatte er sogar den hyperkritischen Präsidenten von sich überzeugt.
Es gab also durchaus Anzeichen, dass die Saison 1997/98 ähnlich erfolgreich verlaufen könnte wie die vorherige. Zwar war das »magische Dreieck« durch den Abgang von Elber gesprengt, aber Löw hatte vielversprechende Neuzugänge klargemacht. Elbers Rolle sollte Jonathan Akpoborie übernehmen, der in Rostock eine starke Saison gespielt hatte. Und als Verstärkung für das Mittelfeld kam von den Grasshoppers Zürich der als hochtalentiert geltende »türkische Schweizer« Murat Yakin. Ihm eilte zwar der Ruf eines lauffaulen Exzentrikers voraus, aber er sei, so Löw, ein fast perfekter Spieler. Dass er mit dieser Verpflichtung eine Lawine ins Rollen bringen würde, konnte er freilich zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen.
Der VfB startete mit wechselhaften Leistungen in die Saison. Es gab einige klare Siege, aber ebenso leb- und erfolglose Auftritte. Wie in der zurückliegenden Spielzeit wurde von etlichen Beobachtern moniert, dass sich der Trainer von den erfahrenen Spielern wie Balakov und Verlaat zu sehr in seinen Job hineinreden lasse. »Ich bin kein Diktator«, wehrte sich Löw. »Ich lasse andere Meinungen zu, schließlich habe ich es mit mündigen Bürgern zu tun. Dass ich den Rat von erfahrenen Profis einhole, heißt aber nicht, dass ich den auch befolge. Die Aufstellung, die Taktik, das System bestimmt letztlich ausschließlich der Trainer.« Als die Stuttgarter am 15. Oktober beim 3:3 in München gegen den FC Bayern ihr spielerisches Vermögen teilweise aufblitzen ließen, wurden die Töne wieder versöhnlicher. Die »Stuttgarter Zeitung« schwärmte von einem neuen magischen Dreieck »mit Yakin als Eckpunkt«. In der 15. Minute hatte er einen doppelten Doppelpass mit Balakov gespielt und per Kopf das 1:1 erzielt. Yakin hatte also durchaus was drauf. Unter dem Strich jedoch sollten seine Leistungen ziemlich durchwachsen bleiben.
Im Europapokal überstand der VfB die ersten Runden gegen IB Vestmannaeyjar und Germinal Ekeren mühelos, aber dennoch nicht souverän. Vor allem gegen die Belgier, die sie im Hinspiel mit 4:0 abgefertigt hatten, lieferten die Stuttgarter dann im Rückspiel, als sie nach einer 2:0-Führung noch vier Gegentore kassierten, eine grauenvolle Vorstellung ab. Löw kehrte vor dem nächsten Bundesligaspiel beim VfL Bochum aus. Hagner blieb zuhause, Haber und Akpoborie mussten auf die Bank.
»Einige brauchen offenbar die harte Hand«, begründete er seine Maßnahmen. Und sie wirkten offensichtlich. Ein forsch agierender VfB gewann mit 2:0. Es folgten Siege gegen Rostock und Karlsruhe sowie ein Auswärtspunkt in Bremen. Die Halbzeitbilanz: zwar ein deutlicher Abstand zu Kaiserslautern und Bremen (zehn bzw. sechs Punkte), aber immerhin ein dritter Platz. Man hätte also durchaus einigermaßen zufrieden sein können. Doch nachdem es am 20. Dezember ein deprimierendes 1:6 in Leverkusen gesetzt hatte, deutete sich eine unruhige Winterpause an.
Wie sehr es beim VfB gärte, zeigte sich bereits im Januar 1998 während des Trainingslagers in Dubai. Im Fünf-Sterne-Hotel Chicago Beach Resort beschloss der Mannschaftsrat mit Verlaat, Balakov, Bobic und Wohlfahrt, vom Vorstand die Einstellung eines Teammanagers zu fordern, der sich intensiv um die Belange der Spieler kümmern solle. Balakov hätte gern seinen Berater Bukovac auf diesem Posten gesehen, die anderen jedoch votierten für Hansi Müller. Weil der aber als Berater zu eng mit den Spielern verbandelt war, sperrte sich jetzt der Präsident und setzte mit Karlheinz Förster einen Kompromisskandidaten durch.
Die Forderung nach einem Teammanager hätte man schon für sich allein als Misstrauensvotum gegen den Trainer auslegen können. Ins Zentrum der Krise rückte schließlich der Konflikt zwischen der »Diva« Balakov und dem vom Rest der Mannschaft isolierten Yakin. Balakov trat zunächst aus Protest gegen die Ablehnung seines Beraters Bukovac aus dem Mannschaftsrat zurück. Nur wenig später drohte er dann in der »Bild« seinen Wechsel an, falls es beim VfB keine grundlegenden Veränderungen gebe. »Entweder Poschner spielt hinter mir, oder ich spiele nicht mehr für den VfB«, forderte er. Der Bulgare wusste, dass auch andere Spieler, vor allem Verlaat und Berthold, seine Forderung unterstützten. Zielscheibe der Kritik war der ungeliebte Neuzugang Yakin. Löw hatte an seinem Wunschspieler bislang stets festgehalten, obwohl seine Leistungen nicht wirklich hatten überzeugen können. Balakov monierte vor allem, dass er von Yakin geschnitten werde und nicht genügend Unterstützung in der Offensive erhalte. Es wäre nun an Löw gewesen, in der Sache ein Machtwort zu sprechen. Stattdessen versuchte er, auf die Forderungen der Spieler einzugehen.
Der geniale Balakov war noch nie pflegeleicht gewesen. Nun aber, nachdem er im Sommer einen Vertrag mit 6 Mio. DM Jahresgehalt ausgehandelt hatte und damit zum bestbezahlten Profi der Bundesliga aufgestiegen war, hatte der Bulgare noch mehr Sonderrechte für sich beansprucht. Der Großverdiener war noch überheblicher geworden, und natürlich war auch der Neid der Mitspieler gewachsen.
Die »Diva« Balakov wollte keinen anderen neben sich glänzen lassen, so dass der zum Schönspielen neigende Außenseiter Yakin schon aus diesem Grund als sein natürlicher Feind prädestiniert war. Der technisch exzellente, aber nicht besonders laufstarke Defensivmann war ein Spieler, der auch selbst mal mit einer Einzelaktion brillieren wollte, und sah seine Rolle keineswegs als bloßer Erfüllungsgehilfe des Bulgaren. Das war der zentrale Konflikt im Team. Und er würde weitere generieren, wenn er den mauligen Poschner wieder auf seiner angestammten Position einsetzen würde. Denn wohin dann mit Yakin? Der Libero-Posten wäre für ihn in Frage gekommen, aber den besetzte ein anderer Platzhirsch: Frank Verlaat.
So mühte sich Löw nach dem Start der Rückrunde, die divergierenden Interessen unter einen Hut zu bringen. Im Konflitkfeld Balakov-Yakin ergab sich dabei ein uneinheitliches Bild. Yakin kam in der Rückrunde zehnmal zum Einsatz, davon aber nur dreimal auf der Poschner-Position. Es zeigte sich: Das Problem bestand weniger darin, dass Yakin auf der Position von Poschner nicht stark genug gewesen wäre; sondern der VfB fand, bedingt durch permanente personelle und taktische Umstellungen, nie zu einer Konsolidierung des Spiels, die ihn im Vorjahr ausgezeichnet hatte. Dem Trainer gelang es nicht, seiner Elf eine funktionierende Mischung aus Sicherheit und Kreativität beizubringen. Auch die Stimmungsprobleme bekam er nicht in den Griff, ständig war er damit beschäftigt, die aus mangelndem Teamgeist entstanden Risse im Mannschaftsgefüge zu kitten. So war es denn kein Wunder, dass ansprechende Leistungen weitgehend ausblieben und darob die Autorität des Trainers immer weiter zerbröselte. Nach zwei Niederlagen in der Bundesliga (in Dortmund und gegen Kaiserslautern) verloren die Stuttgarter am 17. Februar das Pokal-Halbfinale in München. Bei diesem 0:3 waren sie von den Bayern regelrecht vorgeführt worden, und hernach brüllten sich die Spieler beim Gang in die Kabine gegenseitig an. Löw schaute ratlos zu.
Demontage eines Trainers
Beim Präsidenten schrillten nun die Alarmglocken: bereits fünf Spiele in Folge ohne Sieg, Champions-League-Teilnahme nicht mehr möglich und ein Trainer, der die Truppe ganz offensichtlich nicht mehr unter Kontrolle hatte. Nach der Rückkehr von einer Reise mit der Nationalmannschaft deutete Mayer-Vorfelder an, dass es eine grundlegende Änderung geben könnte: einen neuen Trainer. »Löw auf der Kippe«, schlagzeilte die »Sport-Bild« umgehend, und die anderen Printmedien sammelten Argumente für die Entlassung des in die Schusslinie geratenen Coaches: Löw habe keine Rückendeckung mehr bei den Spielern, die nur noch stänkern und ihm auf der Nase herumtanzen würden; das Gekicke der Mannschaft sei nur noch unattraktiv, ein klares Konzept sei nicht erkennbar; die von ihm geholten Neuen seien entweder nicht integriert (Akpoborie, Yakin) oder schlicht untauglich (Becker, Spanring, Stojkovski). Selbst das Erscheinungsbild des schmächtigen Trainers wurde nun ein Gegenstand von gehässigen Kommentaren. Bei Löw hänge das Schlüsselbein, konnte man in der »Stuttgarter Zeitung« lesen, er sei halt »nun mal kein Löwe«.
Dann kam der März 1998, der zunächst mit einem 2:1 gegen Wolfsburg erfolgreich begann. Mayer-Vorfelder versicherte gegenüber den Vertretern der Presse, dass man noch mit keinem anderen Trainer verhandelt habe. Es folgte ein 0:0 beim HSV und schließlich ein erneutes 0:3 im Heimspiel gegen den FC Bayern. Nichts habe gestimmt, weder die Einstellung noch die Taktik des Teams, moserte »MV« nun: »Jetzt ist der Trainer gefordert.« Natürlich sei er maßlos enttäuscht gewesen nach dem Spiel, kommentierte Löw. Aber: »Noch können wir aus eigener Kraft einen UEFA-Cup-Platz schaffen.« Außerdem hatte man im Europapokal der Pokalsieger soeben gegen Slavia Prag den Einzug ins Halbfinale geschafft, und dort wartete mit Lokomotive Moskau ein durchaus schlagbarer Gegner. Wenn man beides schaffe, Platz fünf in der Bundesliga und die Teilnahme am Europacup-Endspiel, dann sei »die ganze Saison doch zufriedenstellend« verlaufen, lautete Löws Beschwichtigungsformel. Vorsichtshalber sagte er jedoch erstmal einen lange geplanten Trainerlehrgang in der Schweiz ab. Es war ihm in dieser Situation zu gefährlich, Stuttgart zu verlassen.
Der größte Teil der Traineraufgabe, sagte er in diesen Tagen in einem Interview mit der »FAZ«, sei die psychologische Komponente. Aber was folgte aus dieser Erkenntnis in der Praxis? Wie sollte er die Mannschaft in den Griff bekommen? Verteidiger Thomas Schneider sollte Jahre später in einem Interview von »ein paar Idioten« berichten, die sich damals beim Präsidenten Gerhard Mayer-Vorfelder »ausgeweint« hätten. Das konnte für die Autorität des Trainers nicht förderlich sein. Wenig dienlich war auch, dass er in den Zeitungen permanent wegen seines angeblich zu weichen und zu inkonsequenten Führungsstils angeprangert wurde.
Warum etwa hatte er Murat Yakin nicht bestraft, der vor dem Spiel gegen die Bayern noch um Mitternacht in einem Lokal gesehen worden war? Yakin habe nur Nudeln gegessen und Mineralwasser getrunken, hatte Löw hernach die Aufstellung des türkischstämmigen Schweizers gerechtfertigt. Warum suspendierte er nun andererseits die Spieler Haber und Poschner, die unter der Woche bis halb drei morgens in Stuttgarter Bars gesehen wurden, für das nächste Spiel? Warum ließ er zu, dass die Spieler Bobic und Verlaat mit öffentlichen Äußerungen an seiner Autorität kratzten? Bobic hatte kritisiert, dass die Mannschaft »viel zu einfach auszurechnen« sei, und Verlaat wurde mit der Aussage zitiert, dass die Probleme beim VfB ausschließlich »sportlicher Natur« und damit also »Sache des Trainers« seien.
Als das nächste Spiel in Berlin trotz neuformierter Mannschaft mit 0:3 kläglich in die Hose gegangen war, würdigte »MV« seinen Trainer nach dem Abpfiff keines Blickes und meckerte vor den Mikrofonen: »Wir sind gegen eine durchschnittliche Mannschaft total eingebrochen.« Am Tag darauf fiel die Presse über den glücklosen Trainer her, diesen Sonderling, der in Interviews von so seltsamen Dingen wie Respekt, Anstand und Moral redete oder von »ehrlicher Arbeit«, die seine Profis in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit abzuliefern hätten. Der Trainer, so hieß es nun wenig überraschend, habe in seiner Gutmütigkeit viel zu lange viel zu viel toleriert. Zwar sei er ein anständiger Kerl, richtig lieb sogar, aber eben wahrscheinlich nicht hart genug für das Geschäft, sondern zu grün, zu weich, kurz: zu nett. Die »Stuttgarter Zeitung« druckte das gnadenlose Urteil: »Der Trainer ist gescheitert. An sich und seinem Charakter. An den maßlosen Stars. Und an den absolutistischen Machtstrukturen im Verein. Übrig bleibt: ein trauriger Held mit liebenswerten Schwächen, der sich im Sommer wohl einen neuen Arbeitsplatz suchen muss.«
Während die Vorwürfe auf Joachim Löw herabprasselten, brodelte zugleich die Gerüchteküche. Kaum ein bekannter Name fehlte auf der Liste der in den folgenden Tagen und Wochen gehandelten Nachfolgekandidaten: Arie Haan, Klaus Toppmöller, Jupp Heynckes, Felix Magath, Ottmar Hitzfeld und als Wunschkandidat Mayer-Vorfelders vor allem Winfried Schäfer, der kürzlich beim KSC entlassen worden war. Als durchsickerte, dass sich Mayer-Vorfelder mit Hitzfeld und Schäfer getroffen hatte, um die Möglichkeit einer zukünftigen Zusammenarbeit abzuchecken, schienen die Würfel gefallen. Den öffentlichen Beteuerungen »MVs« – »Wir ziehen die Saison mit Löw durch« – schenkte kaum ein Beobachter mehr Glauben. Auch der Noch-VfB-Trainer ahnte natürlich, was hinter den Kulissen lief. »Ich habe keine Angst vor der Zukunft«, bemerkte er. »Ich bin seit 17 Jahren im Geschäft. Ich weiß, dass es immer irgendwie weitergeht.« Noch ging es beim VfB unter seiner Regie weiter. Am 11. April gewann ein selbstbewusst auftretendes Team aus Stuttgart in Gelsenkirchen mit 4:3. Fünf Tage später folgte ein 1:0 in Moskau, das den Einzug ins Europacup-Finale perfekt machte. Den 2:1-Heimsieg im Hinspiel zwei Wochen zuvor hatten allerdings nur 15.000 Zuschauer sehen wollen.
Ende mit Finale
Trotz aller Querelen war im Saisonendspurt Fakt: Man hatte in der Bundesliga wieder Erfolg und man stand im Finale eines Europacups! Löw hatte den kompletten Kader nach Moskau mitgenommen, um die Gelegenheit des langen Trips nach Russland für die Stärkung des Zusammenhörigkeitsgefühl zu nutzen. Er vertraute nach wie vor auf die Wirksamkeit seines kooperativen Führungsstils, er wollte auch in der Krise seine Überzeugungen nicht verraten. Mayer-Vorfelder freilich verfolgte parallel ebenso konsequent sein Vorhaben, den jungen Trainer von seiner Verantwortung zu entbinden. »Ich mag den Jogi, seine Ehrlichkeit und Offenheit«, behauptete der Präsident und fügte zweideutig hinzu: »Er ist halt noch sehr jung. Aber er hat bei uns so viele Erfahrungen gesammelt, dass er bestimmt ein ausgezeichneter Trainer wird.« Jetzt, so sollte das wohl heißen, war er es noch nicht.
Dummerweise gewann der angeblich noch nicht ausgezeichnete Trainer dann auch noch das nächste Match (2:0 gegen den VfL Bochum am 19. April). Innerhalb von einer Woche hatte er damit drei wichtige Spiele gewonnen. Entertainer Harald Schmidt witztelte, dass der Jogi jetzt vielleicht als Europacupsieger entlassen werde. »MV« hatte ein stetig anwachsendes Problem: Wie sollte er die geplante Entlassung Löws begründen, wenn die Mannschaft weiterhin siegen sollte?
Der Wind drehte sich immer mehr gegen Mayer-Vorfelder. In seiner Ausgabe vom 4. Mai kürte der »Kicker« den Stuttgarter Trainer zum Mann des Monats April. Die Begründung: Er habe den VfB in der Bundesliga im Rennen um den UEFA-Cup-Platz gehalten, zudem habe er sich für das Finale im Europapokal der Pokalsieger qualifiziert. Wie zur Bestätigung gewann der VfB dann sein letztes Saisonspiel gegen Werder Bremen mit 1:0 und sicherte sich damit die Teilnahme am UEFA-Cup. Am Rande des Spiels gab es jede Menge Protestplakate von VfB-Fans, die für ein Bleiben von Löw plädierten (»Alle gegen Schäfer«. »Löw ist o. k., MV zum KSC«). Verantwortung zu tragen sei schwerer, als Plakate zu schreiben, kommentierte ein sichtlich genervter »MV«.
Löw, dessen 1997 geschlossener Zwei-Jahres-Vertrag ja immer noch für ein Jahr gültig war und der nach wir vor keine offizielle Mitteilung des Vereins erhalten hatte, dass man nicht mehr mit ihm plant, machte gute Miene zum bösen Spiel. Tag für Tag hatte der Trainer in den Zeitungen lesen müssen, dass er nur noch befristet geduldet war. Und er blieb immer noch freundlich und nett. Kein böses Wort über seinen Präsidenten kam ihm über die Lippen. »Ich gehe davon aus, dass ich meinen Vertrag bis 1999 erfülle«, erklärte Löw im »Kicker«. Er wollte Haltung zeigen. Und wenn er dennoch gehen musste, dann wollte er vorher auf jeden Fall den größten Erfolg der Vereinsgeschichte unter Dach und Fach bringen. Ein Abschied im Triumph, als moralischer Sieger von der VfB-Bühne abtreten – das wenigstens sollte es sein.
Vor der Finalnacht am 13. Mai in Stockholm gegen den FC Chelsea machte das Team des VfB einen konzentrierten Eindruck. Die Spieler waren guter Stimmung und zuversichtlich. Der Trainer habe »es super verstanden, störende Einflüsse von der Mannschaft fernzuhalten«, meinte Fredi Bobic. Der VfB erwischte keinen glanzvollen Abend, hielt aber gegen die Stars aus London gut mit. Er begann mutig und hatte einige Torchancen, erst allmählich gewann dann Chelsea die Oberhand. Die Entscheidung fiel in der 71. Minute. Nur 17 Sekunden nach seiner Einwechslung markierte Gianfranco Zola das 1:0. Dabei blieb es. Löws Resümee fiel zwiespältig aus: »Eine Siegchance gab es, wenn wir vor der Pause eine der gut herausgespielten Chancen genutzt hätten. Mit hohen Bällen, wie später, hatten wir gegen diese Chelsea-Deckung keine Chance.«
Nach dem Spiel erschien »MV« nicht einmal mehr in der Kabine. Es war der letzte Auftritt von Joachim Löw als Trainer des VfB. Mitgeteilt hatte ihm die vorzeitige Vertragsauflösung freilich noch immer keiner.
Nachrufe und Lehren
Das Ende des VfB-Trainers Löw wurde in der Presse mit durchaus unterschiedlichen Betonungen kommentiert. Die »Sport-Bild« resümierte, dass selten zuvor ein Trainer derart böse über Monate hinweg auf Raten demontiert worden sei. »Löws ›Todesurteil‹ war, dass er immer an das Gute im Menschen glaubte«, schrieb die »Bild« über den Trainer, der zeitweise den »schönsten und attraktivsten Fußball in Deutschland« habe spielen lassen und sicherlich als einer der besten Trainer der Vereinsgeschichte bezeichnet werden müsse. »Es ist die alte Geschichte vom Lehrling, der zum Meister wurde«, hieß es in der »Stuttgarter Zeitung« deutlich unfreundlicher. »Die Mannschaft hat den ehemaligen Co-Trainer in ihrer Euphorie mit hochgespült. Und Spielern weh zu tun, denen er seinen Karrieresprung zu verdanken hat, entspricht nicht Löws Naturell.«
Joachim Löw selbst haderte hernach vor allem mit dem ihm chronisch schlecht gesonnenen Präsidenten. »Es ist für jeden Trainer unheimlich wichtig, dass er von den Chefs absolute Rückendeckung bekommt«, meinte er. »Jeder macht mal Fehler, muss in Kauf nehmen, dass er Schrammen davonträgt. Doch man kann Autoritätsverluste zurückholen, wenn man von oberster Stelle unterstützt wird.« Große Wunden aber seien dennoch nicht zurückgeblieben. Trotz aller Irritationen sei es eine schöne Zeit gewesen, in der er viel gelernt habe. Vor allem, dass ein Trainer »eine Machtposition ausfüllen muss«. Nachhaltig verstimmt blieb er über die gegen ihn betriebene Kampagne »netter Herr Löw«. Das sei »von gewissen Teilen der Presse und einigen Leuten im Verein« gezielt gesteuert worden, war er überzeugt, um seine Entlassung beim VfB zu provozieren. »Ich weiß genau, dass ich nicht zu nett war«, stellte er schon beinahe trotzig fest. Eventuell, gab er zu, habe er manche Entwicklung zu spät erkannt. »Da habe ich vielleicht den Fehler gemacht, dass ich mich zu lange schützend vor manchen Spieler gestellt habe, gerade in der Öffentlichkeit.« Er habe die Konflikte innerhalb der Mannschaft als Kinderkram eingestuft, deswegen nicht wirklich ernst genommen und laufen lassen; sicher hätte er da früher eingreifen müssen. Vielleicht, sollte er Jahre später selbstkritisch sinnieren, war der Schritt zum Cheftrainer für ihn ein paar Jahre zu früh gekommen.
Stolz konnte er jedenfalls auf seine Bilanz sein: Innerhalb von zwei Spielzeiten hatte er mit dem VfB den DFB-Pokal gewonnen, war ins europäische Pokalsieger-Endspiel gelangt, und zudem hatte er zweimal die Qualifikation für den UEFA-Pokal erreicht. Sowas sollte ihm erstmal einer nachmachen. Winfried Schäfer, der seinen Job zum 1. Juli 1998 offiziell angetreten hatte, schaffte es nicht. Der als »harter Hund« angekündigte Löw-Nachfolger wurde bereits im Winter wegen Erfolglosigkeit entlassen. Vom »Wir-Gefühl« hatte er gesprochen, das er wiederherstellen wolle; gezeigt hatte er dann aber lediglich Egozentrik, Führungsschwäche und schlechte Ergebnisse. Bereits nach fünf Monaten hatte der Patriarch Mayer-Vorfelder genug und riss das Ruder heftig herum. Mit dem jungen Konzepttrainer Ralf Rangnick verpflichtete er einen Bundesliga-Neuling für die nächste Saison; bis dahin sollte Rainer Adrion als Interimstrainer die vom Abstieg bedrohte Mannschaft aufrichten und zugleich auf das Spielsystem seines designierten Nachfolgers vorbereiten.
»Eine größere Kehrtwende kann man wohl nicht machen«, kommentierte Joachim Löw schmunzelnd. Das ebenso turbulente wie erfolglose Intermezzo mit dem »Traditionalisten« Schäfer hätte man sich sparen können, sollte das heißen, denn wenn jetzt mit Rangnick wieder ein innovativer Ansatz gefragt war, dann hätte man auch gleich den Trainer Löw behalten können. Er selbst jedenfalls hatte durch das unrühmliche Ende beim VfB den Glauben an seine Fähigkeiten nicht verloren. Und es gab auch noch einige andere, die ihm für die Zukunft durchaus einiges zutrauten. Etwa den VfB-Verteidiger Thomas Schneider. »Ich bin mit Jogi gut ausgekommen, er war menschlich einer der besten Trainer, die ich je hatte«, meinte der; sicherlich werde er »noch von sich reden machen«.