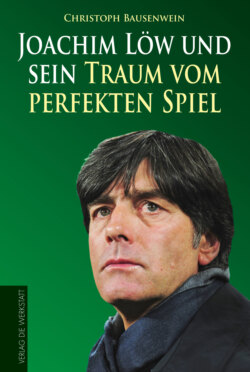Читать книгу Joachim Löw und sein Traum vom perfekten Spiel - Christoph Bausenwein - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEINWURF
Die Fußballprofessoren aus Baden-Württemberg
Mir Ralf Rangnick hatte Gerhard Mayer-Vorfelder einen Trainer verpflichtet, der mit neuen Ideen und Methoden in die Schlagzeilen geraten war. Der im schwäbischen Backnang geborene Fußball-Lehrer hatte dem Nobody SSV 1846 aus Ulm eine frische und moderne Spielweise verpasst und zum Durchmarsch von der Regionalliga in die 1. Liga angesetzt. Rangnicks überraschender Erfolg wurde viel bestaunt, manche Trainer-Kollegen waren jedoch nicht besonders erfreut, als er den Fernsehzuschauern im »Aktuellen Sportstudio« oberlehrerhaft die Vorteile der Viererkette erklärt hatte. Nun, als Chef beim großen VfB, sah sich der nassforsche Fußballintellektuelle am Ziel. Er träumte von einem Fußballunternehmen nach dem Vorbild Ajax Amsterdam, von einem Profiteam, das die Gegner mit Viererkette, ballorientierter Raumdeckung und einstudiertem Tempo-Offensivspiel das Fürchten lehren und alljährlich von nach Plan aufgezüchteten Jungprofis ergänzt werden würde. Rangnick rettete die Stuttgarter vor dem Abstieg und erreichte in der darauffolgenden Saison den UEFA-Pokal. In der folgenden Spielzeit aber kam der Verein sportlich und auch wirtschaftlich ins Schlingern. Der immer wieder wegen seines überbordenden Reformeifers kritisierte Rangnick überlebte zwar den autokratischen Präsidenten Mayer-Vorfelder, der am 30. Oktober 2000 zurücktrat und einen hochverschuldeten Verein hinterließ. Durchsetzen aber konnte er sich letztendlich nicht. Im Februar 2001 musste er Felix Magath Platz machen.
So weit zur Entwicklung beim VfB nach der Ära Löw. Interessanter ist die Vorgeschichte. Denn Ralf Rangnick war in Stuttgart kein Unbekannter. Ab 1990 war er vier Jahre lang A-Jugendtrainer und hatte zusammen mit dem Jugendleiter Helmut Groß den Unterbau des Vereins nach modernsten Kriterien umgekrempelt. Die beiden Trainer sind die Aushängeschilder einer südwestdeutschen Trainer-Connection, die damals ausgezogen war, das Spiel zu revolutionieren. Es war von daher wohl auch kein Zufall, dass die Stuttgarter 1995 mit Rolf Fringer einen in der Schweiz ausgebildeten Trainer verpflichtet hatten, der in Methodik und Ansatz mit diesen jungen deutschen Fußballintellektuellen manche Gemeinsamkeit aufwies. Darüber hinaus kann man den Eindruck gewinnen, dass der vom heutigen Bundestrainer Joachim Löw vertretene Fußballstil dem dieser baden-württembergischen »Fußballprofessoren« in der einen oder anderen Hinsicht ähnelt.
Zentrale Figur und »Mastermind« dieser zunächst auf einige kleine württembergische Vereine beschränkten Fußballrevolution ist der einem größeren Kreis von Fußballinteressierten allenfalls als Rangnicks Scout und Taktikflüsterer in Hoffenheim bekannt gewordene Helmut Groß. Doch Rangnick und junge Trainer wie der Mainzer Jürgen Tuchel halten den passionierten Taktiktüftler für einen der hellsten Köpfe im deutschen Fußball überhaupt. 1981 übernahm Groß im Alter von 34 Jahren das Training der ersten Mannschaft des baden-württembergischen Verbandsligisten SC Geislingen und stieß dort umwälzende Neuerungen an. Der junge Trainer war frustriert vom altväterlichen deutschen Fußballspiel mit seiner tumben Stopper-Philosophie. Ihm war klar geworden: Manndeckung, Libero und deutsche Tugenden wie Kampf- und Willenskraft – das allein konnte die Fußballwahrheit nicht sein. Viererkette, Raumdeckung, Pressing – das waren die Ideen, aus denen Groß etwas Neues entwickeln wollte. Trainer wie Gyula Lorant, Pal Csernai und Ernst Happel waren damals die ersten in der Bundesliga, die sich von der alles dominierenden Manndeckung distanzierten und eine Raumdeckung spielen ließen. »Durch Raumdeckung«, erklärt Groß, »kann man ökonomischer agieren, weil die Spieler Kraft sparen, indem sie nicht unsinnig dem Gegner hinterherlaufen müssen.« Dieser Ansatz war richtig, doch Groß wollte noch weitergehen. Man müsste, so seine Überlegung, die gesparte Kraft sofort ummünzen in ein aggressives Pressing. Agiert man dabei mit kluger Raumaufteilung, so kann man den Gegner schließlich dazu zwingen, Fehlpässe zu produzieren. Ansätze zu dieser Spielweise zeigte damals Ernst Happel mit der niederländischen Nationalmannschaft. Aber auch das ging Groß noch nicht weit genug. Seine Vorstellung war, »dass man den Ball so schnell es geht erobern sollte«. Das war die Grundidee der ballorientierten Raumdeckung. In den Worten von Groß: »Bei gegnerischem Angriff müssen sich die Spieler so verschieben, dass sie – so weit entfernt vom eigenen Tor wie möglich – in Überzahl den ballführenden Gegenspieler angreifen und ihm so den Raum und die Zeit nehmen für eine vernünftige Aktion, um selbst Konter einzuleiten.« Es ging jetzt also nicht mehr nur darum, den Gegner durch Raumverengung zu Fehlern zu zwingen, sondern das Ziel war die möglichst schnelle Rückeroberung des Balles, um mit schnellen Pässen in die geöffneten Räume hinein einen Tempo-Gegenstoß zu starten. Das gut organisierte aggressive Pressing wurde damit konstruktiv als eine Art Vorspiel für die eigene Offensive.
Nach seinen ersten Versuchen mit dem SC Geislingen wechselte Groß zum gleichklassigen VfL Kirchheim/Teck, wo er in der Region mit erstaunlichen Erfolgen für Furore sorgte. Kirchheim stieg mit seinem revolutionären Spielsystem 1986 in die Oberliga auf und wurde zweimal württembergischer Meister. Ihre denkwürdigsten Spiele lieferten die Teckstädter Ende der 1980er Jahre in zwei Testspielen gegen das mit internationalen Stars wie Oleg Blochin und Oleg Protassow gespickte Team des Europapokalsiegers Dynamo Kiew. Die von dem berühmten russischen Nationaltrainer Valerij Lobanowski mit wissenschaftlicher Akribie getrimmten Ukrainer, die ein ballorientiertes Spiel auf allerhöchstem taktischen Niveau pflegten, hatten damals ihr Wintertrainingslager in der Sportschule Ruit aufgeschlagen, um so den allzu frostigen Temperaturen in der Heimat zu entgehen. Das erste Kräftemessen im Februar 1987 verloren die Oberliga-Spieler nur knapp mit 2:4. Das zweite Spiel im Januar 1988 – ausgetragen übrigens, wie ein Chronist überliefert, ausgerechnet bei »sibirischer Kälte« – endete sensationell mit 1:1.
Die Deutschen staunten über die Disziplin der Staatsamateure von Dynamo. Wenn Trainer Lobanowski nach dem Essen seinen Wodka getrunken hatte und sich erhob, standen auch die Spieler stracks auf und folgten ihm – gleich, ob da noch was auf ihrem Teller lag. Umgekehrt waren die Spitzenspieler aus der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik erstaunt, dass eine unterklassige Mannschaft aus Deutschland einen taktisch derart fortgeschrittenen Fußball beherrschte, dass sie sogar die mit individuellen Könnern gespickte Passmaschine des Fußballingenieurs Lobanowski ins Stottern hatten bringen können.
Neben Groß war damals auch Ralf Rangnick, der junge Spielertrainer des Verbandsligisten Viktoria Backnang, von dem ballsicher und oft nahezu perfekt zelebrierten Rasenschach der Ukrainer fasziniert. Sein erstes Aha-Erlebnis hatte er im Winter 1984/85, als die Dynamo-Stars, die als Gastgeschenk ganz standesgemäß Kaviar im Gepäck hatten, auf verschneitem Kunstrasen brillierten und sein Team mit 7:2 besiegten. Intensiv studierte Rangnick, wie die Lobanowski-Truppe mit kollektiven Verschiebeaktionen den Ballführenden des Gegners ständig unter Zeitdruck setzte und in der Vorwärtsbewegung mit einstudierter Überzahlbildung sowie nahezu reibungslos funktionierenden Passstafetten den Gegner scheinbar mühelos ausspielte.
Als Rangnick, der bereits als 28-Jähriger kurzzeitig das Training der Stuttgarter Amateure übernommen hatte, später in den Trainerlehrstab des württembergischen Fußballverbands eintrat und dort auf Groß traf, war ein schlagkräftiges Duett der Modernisierer perfekt. In nächtelangen Videositzungen und Taktikdiskussionen perfektionierten die beiden ihr Wissen. Neben den Niederländern und den Lobanowski-Teams studierte man vor allem die Spiele des AC Milan, als dieser mit einer von Arrigo Sacchi ausgetüftelten Raumdeckungsvariante den europäischen Fußball dominierte. »Ich habe damals ein sündhaft teures Videogerät gekauft«, so Groß. »Das modernste auf dem Markt, für 3.000 Mark. Aber das ging schnell kaputt, weil wir die Bänder so oft vor- und zurückgespult haben, um alle Details in der Taktik von Sacchi und anderen Toptrainern zu erkennen.« Aus ihren Erkenntnissen entwickelten sie ein Lehrsystem, um die ballorientierte Raumdeckung den Jugend- und Amateurtrainern des Verbands näher zu bringen. So höhlte sich langsam der Stein, auch wenn in Rest-Fußballdeutschland zunächst kaum jemand etwas von diesen Vorgängen mitbekam.
Im Jahr 1989 wurde Helmut Groß Jugendkoordinator des VfB Stuttgart und erarbeitete eine einheitliche Spielphilosophie mit Grundlagen wie Viererkette und, natürlich, ballorientierter Raumdeckung. Das alles erinnert sehr stark an die von Urs Siegenthaler in der Schweiz vorangetriebenen Reformen in der Trainerausbildung. Und vielleicht ist es kein Zufall, dass man von beiden Fußballintellektuellen kaum etwas weiß. Wie Siegenthaler blieb auch dessen schwäbisches Pendant Groß ein stiller Brüter, den es nie vor die Kameras drängte. Und wie der Schweizer betonte auch der Schwabe, sehr zufrieden zu sein mit seiner beruflichen Unabhängkeit. Da muss es einen kaum mehr verwundern, dass der schwäbische Taktik-Großmeister in derselben Branche seine Brötchen verdiente wie der Schweizer Mastermind der Spielanalyse. Nämlich als Bauingenieur, Spezialgebiet Brückenbau.
Rangnick war zwischenzeitlich freiwillig zwei Schritte zurückgegangen, um in der Provinz beim SC Korb mit allen Freiheiten seine Ideen weiterzuentwickeln. Schließlich kehrte er nach Stuttgart zurück, um als Trainer der A-Jugend Groß’ Konzept von einer einheitlichen Spielsystematik exemplarisch umzusetzen. Inzwischen waren die neuen Ideen jedoch nicht mehr nur auf den württembergischen Raum beschränkt. 1991 hatte der Norddeutsche Volker Finke seine 16 Jahre währende Tätigkeit beim SC Freiburg begonnen, während der er seine eher autodidaktisch entwickelten Vorstellungen vom ball- und raumorientierten Spiel immer klarer umsetzen sollte. Mit Viererkette, ballorientierter Raumdeckung und aggressivem Pressing wurde ab 1995 auch in der Hauptstadt von Rheinland-Pfalz gespielt, in Mainz. Der FSV 05 war der erste deutsche Zweitligist überhaupt, der so spielen ließ. Trainer Wolfgang Frank, natürlich ein Schwabe, hatte diesen Ansatz aus der Schweiz importiert, war aber auch von der baden-württembergischen Schule inspiriert. 1992/93 hatte er als Trainer des FC Winterthur auch den Badener Joachim Löw als Spieler unter seinen Fittichen. Und einer seiner Spieler in Mainz, der gebürtige Stuttgarter Jürgen Klopp, sollte später als Trainer die grundlegenden Konzepte aufnehmen und weiterentwickeln. Als Klopp 2001 Trainer in Mainz wurde, tauschte er sich in seiner ersten Zeit als Coach auch häufig mit Ralf Rangnick aus. Während Frank sein Team nach dem Vorbild Sacchi noch recht statisch hatte agieren lassen, wurden Klopps Mainzer immer dynamischer: mit aggressivem Pressing durch weit vorn attackierende Außenverteidiger und Mittelfeldspieler sowie mit extrem schnellem Umschalten nach der Balleroberung. In feinster Präzision und teilweise nahezu perfekter Weise sollte dann diesen Ansatz das Meisterteam von Borussia Dortmund in der Saison 2010/11 demonstrieren.
Jürgen Klopps Nachfolger in Mainz, der vormalige FSV-05-Jugendtrainer Thomas Tuchel, ist der vorerst Letzte in der Reihe der schwäbischen Fußballintellektuellen. Tuchel war beim SSV Ulm unter Rangnick Spieler und erlernte danach das Trainerhandwerk in der Nachwuchsabteilung des VfB Stuttgart, wo er unter anderen dem späteren Topspieler Sami Khedira die Grundlagen des Spiels vermittelte. Er coachte zunächst die U14/U15 und war dann Co-Trainer bei den A-Junioren unter Hansi Kleitsch, der wiederum einst Co-Trainer von Helmut Groß in Kirchheim war. »Als Ralf Rangnick und Helmut Groß in Stuttgart Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre ein neues VfB-Spielsystem installiert haben, hatte es Vorbildcharakter für die ganze Region«, sagt Tuchel. »So entstand in Baden-Württemberg eine Keimzelle, aus der sich vieles entwickelt hat und von der ich in meiner Zeit als VfB-Juniorentrainer inspiriert und geprägt wurde.« Allerdings darf man in der Entwicklung nicht stehen bleiben. Zu Rangnicks Zeiten in Ulm war die Raumdeckung in Deutschland Neuland. »Mittlerweile«, so Tuchel, »hat man durch sie keinen Wettbewerbsvorteil mehr.«
Keinen Vorteil aus den Anregungen, die er in und um Stuttgart herum hätte haben können, zog Joachim Löw. Denn entgegen dem Eindruck, der sich einem Außenstehenden aufdrängt, bestreitet er auf Nachfrage heftig, mit der beschriebenen Fußballschule, in deren Dunstkreis er sich jahrelang bewegt hat, irgendetwas zu tun zu haben. Er habe sich von Groß & Co. allein schon deswegen nicht inspirieren lassen können, weil er einen grundsätzlich anderen Stil vermittele: Er setze seinen Schwerpunkt nicht im Spiel gegen den Ball, sondern eben im Spiel mit dem Ball. Das muss man dann so stehen lassen. Dessen ungeachtet bleiben diese überregional nur wenig bekannten Vorgänge in der schwäbischen Provinz aber natürlich interessant und bemerkenswert. Denn sie zeigen, dass nicht nur in der Schweiz, sondern auch im Südwesten Deutschlands in Sachen »Modernisierung des Fußballs« seinerzeit ein außerordentliches Klima der Innovationsfreudigkeit herrschte. Und zumindest davon hat sich wohl auch der Trainer-Novize Löw anstecken lassen.