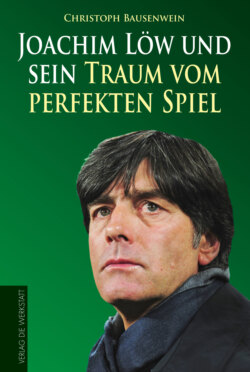Читать книгу Joachim Löw und sein Traum vom perfekten Spiel - Christoph Bausenwein - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеAUFTAKT
Hennef oder die Frage
»Wie wird man Bundestrainer?«
Nach dem Gewinn des Europameistertitels 1996, der im Finale von London durch ein »Golden Goal« von Oliver Bierhoff gegen Tschechien gelang, ging es mit dem deutschen Fußball rapide bergab. Bei der WM 1998 gab es im Viertelfinale gegen Kroatien ein beschämendes 0:3, Berti Vogts quittierte daraufhin seinen Job als Bundestrainer. Sein Nachfolger Erich Ribbeck, dessen Trainer-Knowhow sich durch nicht viel mehr als die Reaktivierung des bereits aussortierten Alt-Liberos Lothar Matthäus und den Leitspruch »Konzepte sind Kokolores« auszudrücken schien, führte die DFB-Elf auf einen noch nie dagewesenen Tiefpunkt. Bei der EM in den Niederlanden und Belgien schied Deutschland erstmals in seiner Fußballgeschichte bereits in der Vorrunde eines großen Turniers aus. Nach einem 1:1 gegen Rumänien und einem 0:1 gegen England ging die deutsche Elf am 20. Juni 2000 in Rotterdam gegen Portugal sang- und klanglos mit 0:3 unter.
Die Erinnerung an dieses deprimierende Debakel kann dem deutschen Fußballfan immer noch einen eiskalten Schauder über den Rücken jagen. Jammern muss er inzwischen freilich nicht mehr, denn es hat sich einiges getan. Zehn Jahre danach ist der deutsche Fußball wieder obenauf und kann, wie vor allem die WM 2010 in Südafrika zeigte, nicht nur die eigenen Fans begeistern. Ursache für den Wandel ins Positive waren zahlreiche Veränderungen, die man unmittelbar nach der EM-Pleite von 2000 eingeleitet hatte. Die Tatsache, dass es in Deutschland heute wieder zahlreiche Talente gibt, ist vor allem der von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) getroffenen Entscheidung zu verdanken, die Vergabe einer Lizenz für die Bundesliga seit der Saison 2001/02 an die Verpflichtung zu binden, ein eigenes Nachwuchsleistungszentrum zu betreiben. Und dann sind natürlich vor allem die Veränderungen an der Spitze der Nationalelf zu nennen, die Revolution in Trainingsmethoden und Spielphilosophie beim Deutschen Fußball-Bund (DFB), die Jürgen Klinsmann im Jahr 2004 einleitete und die Joachim Löw seit 2006 fortführt und verfeinert.
Weniger bekannt ist, dass der Keim der Wiederauferstehung der deutschen Nationalmannschaft fast zeitgleich zum großen Desaster vom Juni 2000 gelegt wurde. Und zwar im südostlich von Köln zwischen Westerwald und Bergischem Land gelegenen Hennef, an der Sportschule des Fußballverbandes Mittelrhein. Dort hatten die Teilnehmer eines Trainer-Sonderlehrgangs für verdiente Nationalspieler des DFB in der Woche vor dem Desaster von Rotterdam ihre Prüfungen abgelegt.
Begonnen hatte der erste Teil des Lehrgangs am 3. Januar. Man habe schon länger überlegt, einen Sonderlehrgang abzuhalten, erläuterte der DFB-Chefausbilder Gero Bisanz zum Auftakt. Initiator war der ehemalige Bundestrainer Berti Vogts, der erst nach lange anhaltendem Widerstand im DFB seine Idee hatte durchsetzen können. Ziel der Sache war, ehemalige Nationalspieler dem Fußball als Trainer zu erhalten. Weil man ihnen das Angebot machen wollte, die Trainerlizenz auf verkürztem Weg zu erhalten – mit 240 statt den sonst üblichen 560 Unterrichtsstunden –, hatte es vor allem von den »normal« ausgebildeten Bundesligatrainern heftige Kritik wegen dieser »Sonderbehandlung« gegeben. Es seien die gleichen Inhalte und die gleichen Dozenten wie bei dem sechsmonatigen Lehrgang, wehrte Ausbildungsleiter Bisanz jedoch alle Einwände ab. Alles sei nur dichter gepackt, geschenkt werde keinem etwas.
Nachdem die Sache dann endlich abgesegnet war, hatte der DFB den auf Anhieb von der Idee begeisterten Jürgen Klinsmann als Akquisiteur angeheuert. Der ehemalige Torjäger, der seine Nationalmannschaftskarriere zwei Jahre zuvor bei der WM in Frankreich beendet hatte, startete einen Rundruf bei ehemaligen Kameraden, die als Teilnahmebedingung mindestens 40 Länderspiele bestritten und einen Welt-oder Europameistertitel errungen haben sollten. Es kam die Creme de la Creme deutscher Ex-Internationaler, allein acht Weltmeister von 1990 und zahlreiche Spieler aus dem Kader des Europameisters von 1996.
Neben ehemaligen Stars wie Jürgen Kohler, Matthias Sammer, Andreas Köpke, Dieter Eilts, Guido Buchwald, Pierre Littbarski oder Stefan Reuter durften mit den Ex-Nationalspielerinnen Doris Fitschen und Bettina Wiegmann auch zwei Frauen per Schnellkurs ihr Fußball-Lehrer(in-nen)-Diplom erwerben. Dazu konnten einige der insgesamt 19 Teilnehmer mit einer »Sondergenehmigung« antreten. Unter ihnen waren der bulgarische Nationalspieler Krassimir Balakov, der aufgrund eines Kooperationsvertrages mit dem bulgarischen Fußballverband zugelassen wurde, und sein ehemaliger Trainer beim VfB Stuttgart, Joachim Löw. Der heutige Bundestrainer, der 1997 mit dem VfB Pokalsieger geworden war und sich nach seiner Entlassung bei Fenerbahce Istanbul als Trainer versucht hatte, war inzwischen beim Zweitliga-Absteiger Karlsruher SC gelandet und trotz seiner nun schon mehrjährigen Trainertätigkeit noch immer nicht im Besitz einer vom DFB anerkannten Lizenz. Die sollte er also jetzt endlich nachholen.
Es waren arbeitsreiche Tage. In dichter Abfolge standen Taktik und Trainingsführung, Psychologie und Rhetorik sowie Sportmedizin auf dem Programm, die Diskussionen in den Arbeitsgruppen dauerten teilweise bis in den späten Abend an. »Weil das Programm so komprimiert war, entstand bald eine sehr intensive Arbeitsatmosphäre«, erinnert sich Bisanz. Und er war begeistert von den Qualitäten seiner Teilnehmer. Fast alle hatten das Spiel selbst auf höchstem Niveau betrieben und ihre Erfahrungen ausgiebig reflektiert. Weil sich die meisten der Teilnehmer bereits sehr gut kannten und die Außenseiter inklusive der beiden Frauen hervorragend integriert wurden, habe sich ein besonderes Gruppengefühl eingestellt. Bisanz sprach von einer »verschworenen Gemeinschaft«. Als Sprecher der Gruppe hatte sich schon bald der mit einer natürlichen Autorität ausgestattete Klinsmann herauskristallisiert. Was er einmal mit seinem Trainerschein beginnen wollte, hatte der Schwabe, der sich auch in seiner Wahlheimat Kalifornien gezielt in Sachen Fußball weitergebildet hatte, freilich noch nicht entschieden. Er sah darin erstmal »eine weitere Option für die Zukunft«.
Klinsmann fand in Hennef Gefallen am Trainerjob, an der Aufgabe zumal, die Komplexität des Spiels zu durchdringen und anderen zu vermitteln. Laut Bisanz hatte er auch Talent bewiesen. Er habe während der Übungen mit einem ausgeprägten Sinn für »die Fußballstruktur« die Fehler gesehen und auf den Punkt gebracht. Andere scheinen aber noch besser gewesen zu sein. Insbesondere sein Lehrgangskamerad Joachim Löw, ein Mann mit bemerkenswert »geradliniger Denkweise«. Der habe ihm in nur zwei Minuten die Vorteile einer Viererkette erklären können. »Ich war 18 Jahre Profi«, soll der schwer beeindruckte Klinsmann zu seinem Banknachbarn Guido Buchwald gesagt haben, »aber kein einziger meiner Trainer konnte mir das so vermitteln.«
Diese nette Geschichte, die gleichsam die Qualität eines Ritterschlags haben sollte, wird Klinsmann nach der vier Jahre später erfolgten Ernennung Löws zu seinem Assistenten immer wieder mal erzählen. Vorerst freilich hatte die Tatsache, dass Klinsmann von Joachim Löws theoretischem Wissen und didaktischem Können beeindruckt war, noch keine Konsequenzen. Der Bundestrainer in spe ging wieder nach Kalifornien zurück, und der in Karlsruhe erfolglose Zweitligatrainer sollte nach einer Kurzzeit-Pleite im türkischen Adana versuchen, in Österreich beim FC Tirol sowie bei Austria Wien wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden.
Bei der deutschen Nationalmannschaft trat indessen Besserung ein. Der allseits beliebte Ex-Stürmerstar Rudi Völler übernahm zunächst interimsweise das Amt des Bundestrainers für den ab 2001 vorgesehenen Leverkusener Trainer Christoph Daum, der dann schlagenzeilenträchtig gescheitert war, weil ihm Kokainkonsum nachgewiesen wurde. Unter »Ruuudi« ging es von den Ergebnissen her wieder aufwärts, auch wenn die Ästhetik des deutschen Spiels oft recht zu wünschen übrig ließ. Das glückliche Erreichen des mit 0:2 gegen Brasilien verloren gegangenen WM-Finales von 2002 musste geradezu als sensationell eingestuft werden. Doch mit der vorübergehenden Euphorie war es bald wieder zu Ende. Auf heftige Kritik nach mauen Spielen gegen Gegner wie Island und die Färöer platzte Völler mehrfach der Kragen. Mehr gebe das Potenzial des deutschen Fußballs eben nicht her, meinte er. Schließlich wurden die realen Möglichkeiten der deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2004 in Portugal auf drastische Weise bloßgelegt. Die Bilanz von »Rudis Rumpelfüßlern«: eine gute Halbzeit beim 1:1 gegen die Niederlande, ein torloses Unentschieden gegen Lettland und schließlich eine demütigende 1:2-Niederlage gegen Tschechiens B-Elf – und damit ein erneutes Aus in der Vorrunde. Wer’s gesehen hat, der wird nie vergessen, wie der ratlos-deprimierte Rudi Völler nach dem letzten Spiel zu den deutschen Fans ging und achselzuckend anzeigte: »Mehr war nicht drin. Wir haben alles versucht.« Einen Tag später trat er zurück. Völler hatte eingesehen, dass nach dieser Mega-Pleite sein Kredit aufgebraucht war und er damit einem unübersehbar notwendig gewordenen fundamentalen Neuanfang nur im Wege stehen würde.
Die DFB-Führung verfiel in eine geradezu bestürzende Ratlosigkeit. Niemand hatte eine Ahnung, wer den Job nun übernehmen könnte. Denn im Grunde war der von den Fans selbst in der Pleite immer noch gefeierte Rudi Völler (»Es gibt nur ein’ Rudi Völler«) die einzig übriggebliebene Lichtgestalt am sich bedrohlich verdunkelnden Fußballhimmel Deutschlands. Viele gute Möglichkeiten blieben da nicht. DFB-Präsident Gerhard Mayer-Vorfelder präsentierte zunächst seinen Wunschkandidaten Ottmar Hitzfeld als sicheren neuen Bundestrainer. Dieser sagte aber wieder ab. Nun gründete sich eine seltsame »Trainerfindungskommission«, bestehend aus Franz Beckenbauer, Werner Hackmann, Horst Schmidt und eben Mayer-Vorfelder. Allerlei Namen wurden gehandelt, unter anderem Otto Rehhagel, doch auch nach vier Wochen dilettantischen Werkelns war der DFB noch immer nicht in der Lage, einen Trainer zu präsentieren. Und dann tauchte plötzlich, ins Spiel gebracht vom Ex-Bundestrainer Berti Vogts, ein ganz neuer Name auf: Jürgen Klinsmann.
Es war die Riesenüberraschung des Fußballjahres 2004. Tatsächlich durfte der inzwischen in Kalifornien ansässige ehemalige Stuttgarter Stürmerstar, Weltenbummler (AS Monaco, Inter Mailand, Tottenham Hotspurs), Welt- und Europameister das höchste Amt in Fußball-Deutschland übernehmen. Kurz nach seiner Inthronisierung erinnerte er sich an den Viererketten-Versteher von Hennef und kürte ihn zu seinem Assistenten. Alle wunderten sich: Was wollte Klinsmann denn mit diesem Löw, den man als Spieler kaum wahrgenommen hatte, der als Trainer des VfB Stuttgart nur kurzzeitig erfolgreich gewesen und dann in der Türkei und Österreich jenseits des großen Fußballs untergetaucht und inzwischen beinahe schon vergessen war?
Der Amstantritt des Trainerteams Klinsmann/Löw war der Beginn einer radikalen Umwälzung im DFB, die bis heute anhält und zu einer begeisternden Attraktivität des deutschen Spiels geführt hat, die sich damals, im grauenvollen Sommer des Jahres 2000, wirklich niemand ernsthaft hatte vorstellen können. Damals war Joachim Löw ein Nobody, heute ist der Mann, der 2006 das Klinsmann-Erbe als Chef übernommen hat, der Liebling der Nation. So erstaunlich diese Entwicklung von außen betrachtet aussehen mag, so nachvollziehbar wird sie für den, der die innere Konsequenz des Hauptakteurs in den Fokus stellt. Den Traum vom perfekten Spiel hegte Joachim Löw schon zu einer Zeit, als er von der großen Öffentlichkeit noch gar nicht wahrgenommen wurde. Heute entfaltet er ihn in gereifter Form an höchster Stelle mit einer frappierenden Selbstverständlichkeit. Er interpretiert den Job des Bundestrainers inzwischen in einer Art und Weise, dass Amt und Person beinahe zu verschmelzen scheinen. Man kann sich kaum vorstellen, von wem er jemals ersetzt werden könnte. Und dabei weiß man nach wie vor nur sehr wenig über diesen Mann, der spätestens seit der WM 2010 beinahe wie ein natürlicher Herrscher über dem deutschen Fußball zu thronen scheint. So wird es Zeit, den Weg Joachim Löws ein wenig zu erhellen und aufzuzeigen, wie sein Traum vom perfekten Spiel sich entwickelt hat.