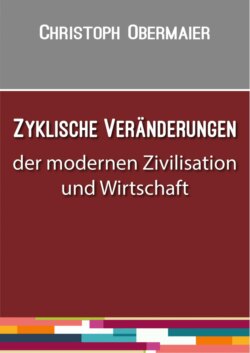Читать книгу Zyklische Veränderungen der modernen Zivilisation und Wirtschaft - Christoph Obermaier - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1.2. Probate und problematische Elemente
Die bisherige Theorie als Zeugnis eines fachlichen Ringens um Erklärung
Beide Theorie-Elemente erfuhren schon frühzeitig Kritik: Man bemängelte zeitnah die von Kondratieff angewendeten zu einfachen stochastischen Methoden [19]. – Und man monierte Defizite von Schumpeters Erklärungen. [20] Gleichwohl enthalten diese aber auch stringente, sinnvolle Elemente.
1. Faktische Basis
Trotz aller Einwände gibt es gewisse faktische Anhaltspunkte, die eine weitere Beschäftigung mit den Zyklen motivieren können:
Unbestreitbar erlebte man ab der Mitte des 19. Jahrhunderts wie ab der Mitte des 20. Jahrhunderts ausgeprägte, langanhaltende Zeiten der Prosperität.
Ebenso können uns die bekannten Krisenzeiten (1873ff, 1929ff, 1973ff) als Eckpunkte dienen, nach denen die sonst übliche rasche Erholung ausblieb. [21]
Dies sind starke Indizien dafür, dass an den Zyklen „etwas dran“ sein muss – auch wenn Kondratieff und Schumpeter selbst den Erklärungsbedarf nicht befriedigen können.
2. Mächtige Ursachen der Entwicklung
Nächstes Theorieelement: Schumpeter bringt diese Zyklen nun mit dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt in Verbindung: Grundlegenden, revolutionären Innovationen wird eine Schlüsselrolle zuerkannt. – Und in der Tat: Wer könnte daran zweifeln, wie bedeutsam die Dampfkraft, der Eisenbahnbau usw. waren? Es handelt sich um die großen Triebkräfte, ja überhaupt die Voraussetzungen für die Industriegesellschaft. –
3. Beobachtete Schlüsselrolle in den Aufschwung- und Boomzeiten
So lässt sich sicherlich sagen: In den jeweiligen Zeiten der Prosperität und Beflügelung spielte die Diffusion bestimmter Technologien und ihrer Produkte eine Schlüsselrolle – man denke eben an den Eisenbahnbau in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Dies deckt sich mit neuesten Forschungen dazu. [22] Man denke später an die Elektrizität, an den Siegeszug der modernen Chemie.
4. Erklärungslücke: Warum Zyklen?
Doch über die zweifellos probaten (jedenfalls dem Autor probat erscheinenden) Elemente der Theorie hinaus gibt es auch klärungsbedürftige Aspekte: Warum sollten technisch-wissenschaftliche Innovationen ein zyklisches Wirtschaftsgeschehen auslösen? Nochmals:
Man stellt – mit Recht – fest, dass es Zyklen gibt.
Man betont – wieder mit Recht – die Schlüsselrolle der Innovationen für die allgemeine Entwicklung.
Und man beobachtet – wieder mit guter Evidenz –, dass diese Innovationen (bzw. deren Diffusion) innerhalb der Zyklen eine wichtige Rolle spielen: Die Zeiten des Aufschwungs und des Booms sind ganz wesentlich auf sie bezogen.
Aber dann ist, nicht minder nüchtern, festzuhalten: Es gibt keinen intrinsischen – also in diesen Innovationen selbst angelegten – Grund dafür, warum ein zyklisches Geschehen daraus hervorgehen sollte. Dieser Kritikpunkt wurde schon sehr früh – bereits im Folgejahr von Schumpeters Veröffentlichung (von 1939) von Kuznets vorgebracht. [23] Und man könnte hinzusetzen: Selbst wenn dabei zyklische Momente im Spiel wären – dann fehlen gleichwohl die Gründe, warum es zu Zyklen von dieser temporalen Struktur kommen sollte.
Zu bedenken wäre sogar, ob sich das Argument nicht sogar ins Gegenteil wenden ließe: Hatte der technologische Fortschritt nicht womöglich eine verstetigende Wirkung, über alle Zyklen hinweg? [24]
5. Fortsetzung: Investition als Investitionszyklen?
Die „klassische“ (Schumpetersche) Theorie der Zyklen bringt einen weiteren Faktor ins Spiel, nämlich die Notwendigkeit zu investieren, damit diese Innovationen industriell realisiert werden können; damit sie also von rein wissenschaftlichen Innovationen zu wirtschaftlich verwirklichten Innovationen werden. (Der moderne Innovationsbegriff hat ja immer diese Doppeldeutigkeit bzw. doppelte Bedeutung.) Und nun ist wiederum klar:
Innovationen lösen Investitionen aus.
Investitionen können bekanntlich zur optimalen Zeit getätigt werden und höchste Gewinne lukrieren („Pioniergewinne“); können aber auch zu spät kommen; und sie können womöglich zu Blasen führen – wenn weiterhin Gelder in bereits übersättigte Märkte gepumpt werden. So gehören Fehlinvestitionen zur wirtschaftlichen Realität. Kredite können ausfallen.
Indes erneut: Warum ein derart zyklisches Geschehen? Warum in so großen Zeiträumen? Und warum nicht Zyklen von sehr unterschiedlicher Dauer, einmal kürzer, dann länger? Warum sollte, wie man gesagt hat, auf jede Kontraktion wieder notwendig eine Expansion folgen – und umgekehrt? [25]
6. Fortsetzung: Viel umfassenderes Geschehen
Und es besteht, wenn wir uns das Gesamtphänomen betrachten, weiterer Klärungsbedarf:
Warum entstehen Innovationen oft im Abschwung eines Zyklus – wie Kondratieff bereits bemerkt hatte [26]? (Man diskutierte u.a. eine stärkere Risikobereitschaft in dieser Situation; `Not macht erfinderisch`, könnte man hinzusetzen. Doch reicht diese Erklärung aus?)
Warum gehen oft politische und militärische Ereignisse mit den Zyklen einher, wie ebenfalls immer wieder – und von Anfang an – bemerkt wurde? Man hat an die Napoleonischen Kriege (bis 1815) und den Spanischen Erbfolgekrieg (bis 1714) erinnert, die jeweils in der analogen Situation stattfanden. [27] In jüngerer Zeit wurde auf diesen Aspekt intensiv durch Joshua Goldstein eingegangen. [28]
Und eine weitere Frage muss beantwortet werden: Warum sind diese Zyklen auch mit gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklungen verknüpft? Können technologische Innovationen wirklich etwas so Spezifisches wie einen Stilwandel in der Kultur einer Zeit auslösen? [29] (Aus kulturanalytischer Sicht ist dies gleich zu beantworten: natürlich nicht.)
D.h., es besteht eine Asymmetrie zwischen den gebotenen Erklärungen – und den weitaus reichhaltigeren, erklärungsbedürftigen Befunden. So wurde von Manfred Neumann vorgeschlagen, viel genauer auf die Bedeutung der je vorherrschenden (gesellschaftlichen) Einstellungen zu achten, die die Wirtschaft prägen: Zu manchen Zeiten stehe die Akkumulation von Kapital im Vordergrund, zu anderen dessen Verteilung. [30]
7. Zu geringe Erklärungsleistung – zu umfassende Phänomene
Und d.h., man beobachtete ja längst (und von Anfang an), dass es sich um ein umfassenderes Geschehen handelt, einen „gesamtgesellschaftlichen Struktur- und Wertewandel“ [31], der viele Zivilisationsbereiche und selbst menschliche Einstellungen mit einbegreift. Unschwer sieht man, dass technische Innovationen und Investitionsfragen keine Erklärungskraft für etwas so Großes besitzen wie solche interdisziplinären Zyklen:
Sie erklären weder das Wirtschaftsgeschehen
noch, erst recht, die damit zusammentreffenden Vorgänge in anderen Bereichen der Zivilisation.
Kurz: Warum koordinierte (multidisziplinäre) Vorgänge? Warum Zyklizität?
Fazit: Asymmetrie zwischen Fragen (Befunden) und Antworten (Erklärungen)
Aus systematischer Sicht ist die kritische Analyse damit abgeschlossen: Offenkundig besitzen wir mit dieser klassischen Theorie der großen Zyklen kein zufriedenstellendes Instrument, um die beobachtete Realität zu erklären. Es gibt bestenfalls partielle Erklärungen. Man kann von einer Asymmetrie zwischen den Befunden und den dafür aufgebotenen Erklärungen sprechen.