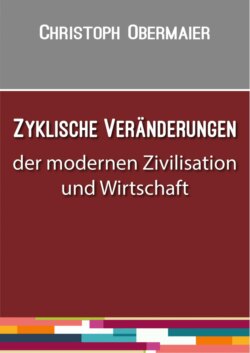Читать книгу Zyklische Veränderungen der modernen Zivilisation und Wirtschaft - Christoph Obermaier - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1.3. Ergänzung: Eine Theoriebildung „faute de mieux“
Exkurs: Der Schwächen bewusst – eine scheiternde Theorie
Ergänzt seien einige Anmerkungen zum Charakter dieser Theorie – nicht einfach aus ideengeschichtlichem Interesse, sondern weil es uns auf der Suche nach besseren, richtigeren Theorien bestärkt:
Als Schumpeter sein Buch herausbrachte, stand die ganze Wirtschaftsforschung unter dem Eindruck von Keynes’ kurz zuvor erschienener „General Theory“. Schumpeters „Business Cycles“ wurden gar nicht richtig wahrgenommen, selbst nicht von den Studenten seines eigenen Seminars, was ihn sehr traf. [32] – An sich erscheint das Letztere verwunderlich, denn Schumpeter war nicht blind für die Schwächen seines Ansatzes und war auf Kritik gefasst. [33] Immerhin vertrat er ein hochszientistisches Ideal der ökonomischen Theoriebildung. (Bereits als junger Forscher formulierte er seine Ansprüche.) Gemessen daran war das Gebotene – auch in seinen Augen, wie man bemerkt hat [34] – viel zu schwach.
Ergänzung: Ein Erklärungsversuch mit den zu Verfügung stehenden Mitteln
Es spricht für Kondratieff wie Schumpeter, dass sie den Ausgangsbefunden – die auf zyklische Vorgänge hinwiesen – so intensiv wissenschaftlich nachgingen.
Kondratieff hatte vor allem einmal die Zyklen als solche „festmachen“ wollen – auch mit ihrem offenbar die Gesamtzivilisation betreffenden Charakter. Sein Beitrag zu deren Erklärung bestand zunächst darin, Arten von Ursachen (mit Recht) auszuschließen – was schon auf die schwierige Erklärungsfrage hindeutet. Und seine eigenen Deutungen (als Investitionszyklen) müssen ja vor dem Hintergrund dieser Grundschwierigkeit gewertet werden.
Schumpeter zog als Theoretiker der industriellen Entwicklung (als „schöpferische Zerstörung“) die Schlüsselrolle der Innovationen in Betracht – womöglich sogar in Abkehr von Kondratieffs Vorgaben für eine gültige Erklärung.
Und wenn sich Märkte für Schlüsseltechnologien sättigen – das ist sicherlich eine wichtige Facette des Gesamtbildes; [35] und das mag den Aufschwung abschwächen und im Abschwung als ein Krisenverschärfer wirken. – Aber große Fragen bleiben offen, wie die Diskussion seither gezeigt hat. Der Konnex zwischen Innovationen und Zyklizität wird auch in der modernen Forschung problematisiert. [36]
Fortsetzung: Ökonomisch gesteuertes Geschehen – aber mit Erklärungsproblemen
Doch zugleich gingen Kondratieff wie Schumpeter davon aus, dass es ein
zwar bei weitem nicht nur ökonomisches
und auch „wirtschaftsseitig“ rätselhaftes Geschehen zu erklären galt –
das man als
durch ökonomische Vorgänge gesteuert (Kondratieff)
oder als durch wirtschaftsbezogene Vorgänge gesteuert (durch Schumpeters Basisinnovationen) auffasste.
Dabei war beiden – wie es scheint – bewusst, dass die Erklärung mit den ihnen zur Verfügung stehenden wirtschafts-analytischen Mitteln äußerst schwierig ist.
Kurz: Die bisherige Lehre von den großen Zyklen ist gewissermaßen eine Theorie „faute de mieux“: in Ermangelung besserer Erklärungen. Was man im wissenschaftlichen Werkzeugkasten vorfand, reichte nicht annähernd aus, um ein so gewaltiges Gewicht auch nur einen Millimeter vom Boden zu heben.
Vertiefung: Anwälte der Befunde – Suche nach der Erklärung
Schumpeter hätte wegen dieser Erklärungsprobleme auf jede Theoriebildung, ja überhaupt auf das Thema verzichten können. Doch er hält an den Befunden fest; er will darauf hinweisen, dass da etwas ist (was zu erforschen lohnt und was es zu erklären gilt) – auch wenn die Erklärungen nicht ausreichen.
Schon der brüske Beginn von Schumpeters „Business Cycles“, der sofortige Clinch mit den Details deutet darauf hin, dass da ein Analytiker mit seinem Gegenstand nicht wirklich fertig wird. Und ebendies will Schumpeter uns mitteilen; explizit versteht er sein Buch als Aufforderung, mitzudenken.
Keynes hat gespottet, Schumpeter besäße eine große Liebe zur Mathematik – aber eine unglückliche Liebe. Tatsächlich entscheidet dieser sich – im Widerstreit zwischen hohen Theorieansprüchen und konkreten Befunden – für die letzteren. Und man könnte sagen, die unglückliche Liebe zur Mathematik ehrt ihn hier. Die Mathematik bleibt die erwünschten (einfachen) Erklärungen schuldig; man gerät in etwas viel Lebensvolleres – aber auch Überforderndes.