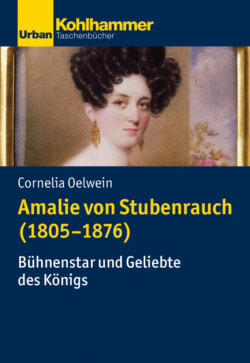Читать книгу Amalie von Stubenrauch (1805-1876) - Cornelia Oelwein - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Endlich am königlichen Hoftheater zu München
ОглавлениеNachdem Bayern 1806 zum Königtum aufgestiegen war, bedurfte es eines adäquaten Theaters. Zwar waren bereits vor der Jahrhundertwende Pläne für eine Neugestaltung der Münchner Theaterlandschaft gemacht, das alte baufällige Opernhaus am Salvatorplatz 1799 geschlossen und 1802 abgebrochen worden, doch erst in königlichen Tagen wurden diese konkreter. Als Standort für ein neues, großes Hoftheater empfahl sich der Platz des damals säkularisierten Franziskanerklosters unmittelbar neben dem Cuvilliés-Theater und der Residenz. Diverse Entwürfe wurden eingereicht, wobei die Entscheidung auf das Konzept Carl von Fischers fiel. Grundsteinlegung war am 12. Oktober 1811 – dem Namenstag König Maximilians I; die Eröffnung fand exakt sieben Jahre später statt. Die Freude war von kurzer Dauer, denn bereits zu Beginn des Jahres 1823 brannte das Gebäude aus.
Sofort wurde mit dem Wiederaufbau begonnen. Der beauftragte Architekt hieß nun Leo von Klenze. Er sollte sich strikt an die Pläne des inzwischen verstorbenen Carl von Fischer halten. Knapp zwei Jahre dauerten die Arbeiten. Am 2. Januar 1825 war es erneut soweit: Das neue Hoftheater konnte mit einem ganzen Eröffnungs-Zyklus feierlich dem Publikum übergeben werden – schöner und prächtiger als je zuvor. Dicht gedrängt waren Parkett, Galerie und Ränge bei der ersten Vorstellung. In der Mittelloge nahm der königliche Hof Platz, angeführt von König Maximilian und seiner Frau Karoline sowie den Prinzessinnen. Ferdinand Eßlair, ein Star am Münchner Bühnenhimmel, sprach den Prolog, Musik ertönte nach einer Komposition des Intendanten Freiherrn von Poißl. Es folgte das Ballett »Aschenbrödel« von Friedrich Horschelt. Der Andrang des Publikums war so überwältigend groß, dass diese Eröffnungsveranstaltung am Abend darauf wiederholt wurde.
Am 6. Januar kam es zur ersten richtigen Theateraufführung: Man hatte Schillers personenintensiven »Wilhelm Tell« gewählt, womit sich die Münchner Bühne durchaus als modern erwies.43 Alle Schauspieler mit Rang und Namen, etwa Ludwig Hölken, Heinrich Moritz, Wilhelm Urban und natürlich die absoluten Stars Wilhelm Vespermann als Reichsvogt Hermann von Geßler und Ferdinand Eßlair in einer seiner Glanzrollen, dem Wilhelm Tell, waren dabei. Die Riege der wenigen weiblichen Rollen führte Adelheid Fries an. Ganz besonderes Lampenfieber aber werden die beiden Elevinnen gehabt haben: Elise Seebach und Amalie Stubenrauch. Die beiden spielten Bäuerinnen: Fräulein Seebach die Mechthild und Fräulein Stubenrauch die Elsbeth. Bei diesem einmaligen Ereignis als Teil der herausragenden Besetzung der Münchner Bühne dabeizusein – das muss für die beiden von überwältigender Bedeutung gewesen sein. Wegen des großen Erfolges wurde auch diese Aufführung vier Tage später noch einmal wiederholt und erneut nach Abschluss des Eröffnungs-Zyklus am 8. Februar, jeweils wiederum mit den beiden jungen »Bäuerinnen«.44
Von nun an agierte Amalie nicht mehr auf der Bühne des kleineren Cuvilliés-Theaters, sondern auf der großen des königlichen Hoftheaters. Immerhin fasst das Haus weit über 2 000 Zuschauer. Seiner Zeit galt es als eines der größten Theater Europas. Man spielte mindestens vier Mal in der Woche, jeweils am Sonntag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, manchmal auch am Montag. Beginn der Vorstellung war in der Regel um 18 Uhr.
Für Amalie ging es von nun an stetig ›bergauf‹. Es folgten weitere Nebenrollen wie die Sophie im »Schiffbruch«; sie trat auf als Madame Friedberg in »Die beiden Klingsberge«, als Elise in der »Urika«, als Josephine in der Posse »Der Lügner und sein Sohn«, als Julie in den »Drillingen«, als Elise im »Geizigen« von Heinrich Zschokke nach Moliere, als Lyra in den »Steckenpferden« von Pius Alexander Wolff, als Pauline von Fransdorf in »Flattersinn und Liebe«, als Jesika im »Kaufmann von Venedig«, als Oskar im Trauerspiel »König Yngurd« und in einigen anderen Stücken. Die Theaterkritiker wurden zunehmend auf sie aufmerksam.
»Nicht ohne bedenkliche Miene lasen wir, daß die schwierige Rolle des Oskar in König Yngurd diesmal von einem Frauenzimmer, und zwar von einer erst kurze Zeit in Thaliens Tempel wandelnden Priesterin, Dlle Stubenrauch, dargestellt werde. Allein der Erfolg rechtfertigte das Unternehmen und übertraf jede billige Erwartung.«45
Doch – wie der Rezensent in den »Grazien« bemerkte – »keine vollendete Meisterin fällt vom Himmel, und jene beginnende, selbst die talentvollste junge Künstlerin, welche nicht ein oder andere Blößen offenbarte, soll noch geboren werden!« Wobei er zwischen alter und neuer Auffassung theatralischen Auftretens differenzierte: »Es gehört unter die großen Unarten einer älteren Schule, daß Schauspieler und Schauspielerinnen, vorzüglich bey affektvollen Stellen, nach jedem, selbst den kleinsten Satze seufzend und stöhnend gleichsam nach Luft schnappten.« Er hoffte, dass die vielversprechende junge Künstlerin diese Unart nicht übernehme. Noch hatte sie einiges zu lernen, doch der Theaterkritiker war der festen Überzeugung: »Häufige Übung und Beschäftigung würden diese fleißige Jüngerin Thalien’s auf der Kunstbahn bedeutsame und rasche Fortschritte machen lassen.«46