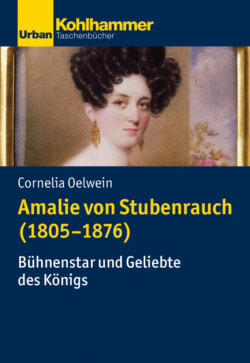Читать книгу Amalie von Stubenrauch (1805-1876) - Cornelia Oelwein - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
König Ludwig I. von Bayern und das Porträt Stielers
ОглавлениеAuch wenn einige von Amalies Widersachern spekulierten, sie hätte in München ein Verhältnis mit König Ludwig I. angefangen, gar ihn für ihren Karriereeinstieg benutzt – diese Jahre später in die Welt gesetzten Gerüchte erweisen sich bei genauer Betrachtung als haltlos. Es findet sich kein stichhaltiger Beleg, dass Ludwig mehr als ein applaudierender Zuschauer war, wenngleich er sich dem weiblichen Geschlecht gegenüber stets aufgeschlossen zeigte. »Lieben muß ich, immer lieben«, hat er einst gedichtet und »unverliebt kann ich nicht sein«.133 Zusammen mit den zahlreichen Anekdoten, der berühmten Schönheitsgalerie, die noch heute in Schloss Nymphenburg alljährlich Tausende von Besucher anlockt, und der immer wieder gerne kolportierten, schicksalhaften Affäre mit Lola Montez verfestigte sich das Bild eines Lüstlings auf dem Königsthron – zu Unrecht. Gerade das kunstgeschichtlich einmalige Phänomen der Schönheitsgalerie lässt Ludwigs Verständnis von Frauenschönheit begreiflich werden, das weniger auf Beziehungen zur Damenwelt zurückging, als vielmehr mit seiner Verehrung für das ›Schöne‹ an sich zu tun hatte.
Die Idee zu dieser Galerie war bereits in seiner Kronprinzenzeit gereift. Kaum auf dem Thron begann er die Idee durch den Maler Joseph Stieler in die Tat umzusetzen. 1829 konnten die ersten zehn Bildnisse der Allgemeinheit in einer Kunstausstellung vorgestellt werden. Im Laufe von gut 20 Jahren kamen insgesamt 38 Porträts zusammen.134 Von Anfang an war die Galerie für die Öffentlichkeit gedacht, nicht zum königlichen Privatgenuss – anders als etwa die Galerie des württembergischen Königs Wilhelm I. Unter den ersten zehn Bildnissen, die 1829 in München ausgestellt wurden, befand sich auch das Porträt der Amalie von Stubenrauch. Während im »Kunstblatt« nur allgemein über die Porträts, die »in hohem Maße die Schaulust der Neugierigen« reizte, berichtet wurde, führt der Bericht im »Münchner Conversations-Blatt« die einzelnen Dargestellten namentlich auf.
Unter der Überschrift »Die abentheuerliche Nacht« beschrieb der äußerst beliebte Schriftsteller Friedrich Wilhelm Bruckbräu die Bilder, die er um eine fiktive Tafel vereint zu Leben erweckte. Goethe auf dem berühmten und nachweislich ausgestellten Porträt hatte den Vorsitz. »Zu beiden Seiten von ihm saßen Demoiselle Stubenrauch, k. würtembergische Hofschauspielerin, auf einem eleganten Teller vor ihr lag eine Rose, ein Vergißmeinnicht, und ein Je länger je lieber, für eine Dame drei sinnvolle Blumen; dann Demoiselle Hagn als Thekla, in einem mit Pelz verbrämten Kleide von weißem Atlas, mit Perlen geschmückt, behaglich in einem Armstuhl ruhend«, dazu acht weitere Schönheiten.
»Was halten Sie von meinem Portraite?« fragte Amalie von Stubenrauch demnach den Schriftsteller. Man kannte sich: Bruckbräu arbeitete auch als Theaterautor; Amalie war etwa im Fasching 1827 als Amalie Gräfin von Rosenberg in einem Lustspiel von Bruckbräu aufgetreten. Doch das Stielersche Porträt gefiel ihm nur bedingt: »Es fehlt ihm alle Wahrheit, aller Charakter«, erwiderte Bruckbräu, »so ähnlich es auch ist. Aus dem Gesichte leuchtet die Champagnerglut einer Lady Milford, aber nicht jenes schelmische Verhehlen der innern Gesinnung, was Sie im wirklichen Leben so interessant macht.« Und ergänzte:
»Ich spreche übrigens dieses Urteil nicht aus einem vielleicht gerechten Grolle aus, weil Sie durch Ihren Abgang unsere Bühne einer theuren Zierde beraubt haben, indem ich wohl weiß, daß nur eine h ö h e r e Liebe Sie an Stuttgart fesseln kann, nämlich die Liebe zur Kunst, welcher Sie sich dort als tragische Prima-Donna ungetheilt weihen können.«135
Die Richtigkeit des Zeitungsberichts ist nicht anzuzweifeln. Zudem sind alle anderen Bilder richtig beschrieben. Gerade Amalie von Stubenrauch widmete der Autor besondere Aufmerksamkeit, nannte sie an erster Stelle nach Goethe. Und nicht zuletzt bestätigte ihre Konkurrentin Charlotte von Hagn die einstige Existenz des Porträts. Am 6. Dezember 1827 vertraute sie ihrem Tagebuch nach einer Sitzung für ihr eigenes Porträt bei Stieler an, dass dessen Bediensteter ihr »das weiße Kleid der Stubenrauch, das der Schneider zum Ansehen gebracht« zeigte und musste sogar zähneknirschend festhalten, dass ihr das Kleid »sehr gefiel«, woraus zu schließen ist, dass auch Amalie dem Künstler ab Dezember 1827, vermutlich jedoch erst im Januar nach ihrer Rückkehr aus Frankfurt, Modell gesessen hat.136
Acht der 1829 ausgestellten »schönen Köpfe« sind noch heute in Schloss Nymphenburg zu sehen. Die Frage, warum Amalies Porträt schließlich in der Schönheitsgalerie nicht aufgestellt wurde, lässt sich nicht mit letzter Gewissheit beantworten. Möglicherweise teilte König Ludwig Bruckbräus Meinung oder vielleicht hat ihr Fortgang aus München dazu geführt. Eine unerfüllte Leidenschaft des Königs als möglicher Grund dafür, das Bildnis nicht anzukaufen,137 kann immerhin ausgeschlossen werden.138 Und wenn der König sie tatsächlich in München hätte halten wollen: Er hätte mit Sicherheit Möglichkeiten dazu gehabt, hätte ihr zumindest Steine in den Weg gelegt oder ein Verbot ausgesprochen, jemals wieder in München aufzutreten, wie er dies später bei Charlotte von Hagn tat.139 Doch nichts dergleichen ist geschehen. Und nicht zuletzt: Königin Therese, die Ehefrau Ludwigs I., hätte Amalie später sicher nicht reich mit Geschmeiden beschenkt, als sie dereinst zu einem allseits bejubelten Gastauftritt erneut nach München kam. Das Bildnis Amalie von Stubenrauchs allerdings ist heute verschollen.140
1 Augsburger Abendzeitung 20.04.1876.
2 Z. B. Eisenberg 1903, 1016; Ulrich 1997, 1844; Palm 1881, 42. Auch auf einer älteren Karteikarte der Bibliothek des Dt. Theatermuseums ist als Geburtsjahr 1800 vermerkt. Oppermann/Gettke 1889, 779, nennt 1801 als Geburtsjahr.
3 Palm 1881, 42.
4 StA Lu E 18 II Bü 901.
5 SAS Autograph 11022 (Brief an unbekannten Empfänger, 15.11.1859).
6 Blum u. a. 1842, 45. Dieses Datum nennen auch Gettke 1889, 70; Flüggen 1892, 302; Kosch 1998, 2457 sowie Ulrich 1997, 1844, wobei die jüngeren Lexika meist auch andere Geburtsjahre alternativ angeben. Ulrich 1997 z. B. 1800, 1804, 1805 und 1808.
7 E. H. 1930; Sauer 1997, 208. Übernommen bspw. von Oßwald-Bargede 2005, 32.
8 Wiener Zeitung 20.4.1876; Augsburger Abendzeitung 20.04.1876.
9 E. H. 1930.
10 Zu Johann Nepomuk von Stubenrauchs Werdegang siehe, wenn nicht anders angegeben BayHStA MF55085 und BayHStA KrA OP 82977.
11 Auch München wurde verschiedentlich als Geburtsort genannt, was aufgrund der Aktenlage unwahrscheinlich ist. ÖStA KrA 6943. In den Matrikeln der Münchner Pfarreien erscheint er weder 1871 noch 1873.
12 Genealogisches Handbuch 1964, Bd. 8, 433. Auch spätere Eintragungen zur Familie von Stubenrauch (1982, Bd. 14, 806; 1990, Bd. 18, 811; 1998, Bd 22, 780) bringen keine weiteren Erkenntnisse.
13 Damals wurde stets der Ehemann der Mutter offiziell als Vater eingetragen, auch wenn das Kind nachweislich von einem anderen Erzeuger stammte.
14 Churfürstlich pfalzbaierischer Hof- und Staats-Kalender 1800 bzw. 1802; BayHStA KrA OP 80297.
15 Verleihung des Erblichen Reichsadels am 03.09.1841 in Wien. BayHStA Adelsmatrikel S, 158.
16 Damals wurde »Baiern« noch mit ›i‹ geschrieben; das ›y‹ wurde erst 1825 von König Ludwig I. verbindlich festgelegt.
17 BayHStA MF 55085.
18 AEM München St. Peter, Taufmatrikel. Die Mutter war Anna Maria bzw. Marianne Raumayrin (nicht Rauchmayrin, wie im Genealogischen Handbuch 1964, 433, zu lesen ist). Zu Johann Baptist Moosmaier: Münchener Tagblatt, 02.04.1802 (»Joh. Bap. Mosmayr, churfürstlicher Hoforganist giebt Unterricht in Klavier«). Die Allg. Musikalische Zeitung, 12.02.1806 nennt ihn im Verzeichnis des Personals der Kgl. B. Hofkapelle unter den Organisten an erster Stelle. Unter der »Musikalienanzeige« eines Musikverlegers findet sich: »Mosmaier, k. b. Hoforganist, 3 leichte Sonaten für das P. F. [Pianoforte] mit willkührlicher Begleitung einer Violine, 1 fl. 12 kr.« (Augsburger Ordinari Postzeitung = Augsburger Postzeitung 23.10.1818). Am 04.04.1833 verzeichnet der Bayer. Beobachter ihn unter den in München verstorbenen Personen als pensionierten Hoforganisten, 80 Jahre alt. Seine Frau war ein knappes Jahr zuvor verstorben: »Marianne Moosmaier, pens. k. Hoforganisten-Frau, 75 J. a.«, Münchner Conversations-Blatt, 20.06.1832.
19 Promenadeplatz Nr. 9 lag auf der Südseite des Platzes, gegenüber dem heutigen »Hotel Bayerischer Hof«. Schneider 1960, Bd. 2, 226. 1909/10 wurde das Gebäude zusammen mit dem Nebengebäude durch das ehemalige Ballin-Haus ersetzt, heute Bank.
20 Der Feldarzt bestätigte seine Tauglichkeit auf der »Assent-Liste« und vermerkte als Größe 5 Schuh, 6 Zoll und 2 Strich« (ca. 170 cm). ÖStA KrA 6943.
21 Ebenda, Nr. 6923.
22 ÖStA KrA 03989. Ein weiteres Kind, vermutlich 1809 geboren, ist nicht vermerkt, wird aber später erwähnt. 1809 war das Regiment im Kriegseinsatz (keine Musterungslisten erhalten). Die Schwestern Josephine und Constanze wurden erst am 19.12.1815 bzw. 21.12.1820 in München geboren (AEM München St. Peter, Taufmatrikel).
23 ÖStA KrA 6924.
24 Vgl. ebenda (Musterungsliste vom 11.09.1811).
25 Zu diesem Preisanstieg trug v. a. bei, dass 1804 Kurfürst Max IV. Joseph, nachmaliger König Maximilian I., den Paradeplatz allein dem Vergnügen des Publikums widmete und ihn zu diesem Zweck durch Grünanlagen verschönern ließ. Gleichzeitig wurde der Name von Paradeplatz in Promenadeplatz geändert. Schneider 1960, Bd. 2, 226.
26 BayHStA OP 80297. Die historische Begräbnisstätte ist nicht erhalten. Die Kirche wurde im späten 19. Jahrhundert neugotisch umgestaltet. Doch noch immer sind die Grafen von Törring etwa in den Glasfenstern präsent. Die Grafen von Törring-Jettenbach haben über die weibliche Linie Teile der Familie Minucci beerbt.
27 BayHStA MF 55085.
28 BayHStA OP 80297.
29 AEM München St. Peter Taufmatrikel 19.12.1815 (Geburt Josefine).
30 Leitschuh, Schuljahr 1830/31.
31 Verzeichnis Ludwig-Maximilians-Universität in München 1832/33, 24: Stubenrauch von, Joh. Nep., München, Müllerstr. 484/I; ebenda 1834, 21: Rumfordstraße 32/I.
32 Herlesssohn 1837, 459.
33 So jedenfalls berichten es Zeitgenossen: Korsinsky 1843, 110; Herleßsohn 1846, 45.
34 Zu den Auftritten in München siehe die vollständig erhaltenen Theaterzettel der Münchner Hofbühne (Filme BSB Musiklesesaal Md 44 c = 2° Bavar. 827). Oelwein 2020.
35 Flora 16.12.1823.
36 Ebenda.
37 Ebenda.
38 Abend-Zeitung 21.06.1824.
39 Lewald 1844, Bd. 5, 101.
40 Grazien 16.09.1824.
41 Grazien 14.11.1824.
42 Ebenda.
43 In Berlin durfte Schillers »Tell« zu dieser Zeit noch nicht gegeben werden, da in dem Stück die Volksfreiheit verherrlicht wird. Erst nach dem Tod König Friedrich Wilhelms IV. von Preußen durfte das Stück, wie aus ähnlichen Gründen auch Goethes »Egmont« oder Schillers »Räuber« aufgeführt werden. Dazu Stemplinger 1939, 186.
44 Theaterzettel; Leythäuser 1916, 127–129.
45 Flora 29.07.1825; siehe auch Abend-Zeitung 31.08.1825.
46 Grazien 14.11.1824; siehe auch Abend-Zeitung 14.01.1825.
47 Grandauer 1878, 91.
48 Grandauer 1878, 91; Leythäuser 1916, 112; Aurora 1. und 10.07.1829. Anna Altmuttter starb am 19.10.1826.
49 Am 10.04.1825 als Gast in München.
50 Eos 30.09.1825; Flora 30.09.1825.
51 BayHStA Intendanz Hoftheater 902 (02.10.1825).
52 Wolf 1922, 79. Gewöhnlich stand der König um fünf Uhr früh auf.
53 Eos 12.11.1825.
54 BayHStA Intendanz Hoftheater 902.
55 Siehe z. B. Poißl 2006, 137 und 182.
56 Abend-Zeitung 02.05.1826.
57 BayHStA Intendanz Hoftheater 902.
58 Grandauer 1878, 103.
59 Eos 06.12.1826.
60 Wiener Zeitschrift 18.03.1826 (Aufführung 15.01.1826).
61 Flora 22.01.1826; Abend-Zeitung 21.03.1826.
62 Z. B. Eos 15.09.1826; Flora 14. und 15.09.1826.
63 Stemplinger 1939, 46.
64 Krauß 1908, 177.
65 Krauß 1908,150. Hier auch das Folgende zur allgemeinen Theatergeschichte in Stuttgart.
66 Krauß 1908, 167.
67 Flora 18.08.1826.
68 Didaskalia 11.08.1826.
69 BayHStA Intendanz Hoftheater 902; StA Lu E 18 II Bü 901.
70 StA Lu E 18 IIBü 901.
71 Das Königstor besteht nicht mehr. Es stand gegenüber dem heutigen Hauptbahnhof. Es war seinerzeit die Hauptzufahrt von Osten her, die Neckarstraße bestand damals in ihrer späteren Form noch nicht.
72 Palm 1881, 35.
73 Bayer. Landbote 03.03.1827.
74 Bayer. Volksfreund 17. und 27.03.1827.
75 BaHStA Intendanz Hoftheater 902.
76 Flora 23.04.1827.
77 Vgl. BSB-HSS Schenkiana II,12. Brief 08.01.1828.
78 Eos 25.04.1827.
79 Bayer. Volksfreund 23.06.1827.
80 Eos 08.08.1827.
81 Museum für Kunst 29.11.1838.
82 Tags-Blatt 15.07.1827. Vgl. auch die überaus langen Besprechungen in Eos 10. bis 16.03.1826.
83 Abend-Zeitung 28.03.1828.
84 Ebenda.
85 Wiener Zeitschrift 06.04.1839; Münchner Tagpost 02.12.1838.
86 Flora 26.02.1826.
87 Tags-Blatt 15.07.1827.
88 Flora 25.02.1830; Zeitung elegante Welt 05.06.1830.
89 Eos 26.09.1827.
90 Vgl. z. B. Meyerbeer 2002, 392.
91 SAS Autograph 6152 (St. an Hackländer, Tegernsee, 22.09.1864).
92 BayHStA Intendanz Hoftheater 902.
93 Ebenso Bayer. Volksfreund 20.12.1827.
94 Tags-Blatt 30.12.1827.
95 Flora 04.01.1828; vgl. auch Bayer. Volksfreund 05.01.1828.
96 Eos 19.01.1828.
97 Ebenda.
98 Ebenda.
99 Bayer. Volksfreund 25.01.1828.
100 Eos 02.05.1828; Flora 04. und 11.01.1828. Zu Caroline Lindner allgemein z. B. Lewald 1836, 268–270.
101 BSB-HSS Hagn 30.12.1827.
102 Tags-Blatt für München 06.01.1828; Bayer. Volksfreund 05.01.1828.
103 Flora 10.01.1828.
104 Flora 17.01.1828.
105 Eos 19.01.1828.
106 Abend-Zeitung 28.06.1828.
107 Eos 11.08.1827. Fanny Fleckenstein war früher schon im Isartortheater in München aufgetreten, erhielt 1827 eine feste Anstellung am Hoftheater, um wenige Jahre später nach Nürnberg und Mainz zu wechseln.
108 Bobbert 1936, 16.
109 Grandauer 1878, 103.
110 Tags-Blatt 23.02.1828; Eos 07.02. und 19.03.1828.
111 Tags-Blatt 10.01.1828.
112 BSB-HSS Hagn 08.01.1828.
113 Hesperus 27.01.1827.
114 Tags-Blatt 05.10.1827.
115 BSB-HSS Schenkiana II, 2 (Beer an Schenk, Frankfurt 08.01.1828).
116 Ebenda.
117 Ebenda.
118 Ebenda.
119 BSB-HSS Hagn 02., 24., 26., 27.02.1828, 09.04.1828.
120 BSB-HSS Hagn, an verschiedenen Stellen.
121 Bobbert 1936, 18 f.
122 Eos 10.03.1828.
123 Flora 27.03.1828.
124 Sonntags-Blatt 30.03.1828.
125 BSB-HSS Hagn.
126 Lewald 1836, 270–274; Bobbert 1936; Oelwein 1997.
127 BayHStA Intendanz Hoftheater 902; StA Lu E 18 II Bü 901.
128 StA Lu E 18 II Bü 901.
129 BayHStA Intendanz Hoftheater 902. Vgl. auch Signat 1828/211.
130 Tags-Blatt 27.07.1828.
131 StA Lu E 18 II Bü 901.
132 Vgl. auch Grandauer 1878, 106.
133 Dazu allgemein Oelwein 2003, 159–172.
134 Zu den einzelnen Schönheiten vgl. vor allem von Oertzen 1927 und Hojer 2011. Vgl. auch von Hase 1971, vor allem 91–107. An dieser Stelle möchte ich auch Frau Dr. Ulrike von Hase-Schmundt für Informationen danken. Ihr war das Stubenrauch-Porträt unbekannt.
135 Bruckbräu 1829, ähnlich auch Bruckbräu 1835. Vgl. auch Kunstblatt 26.11.1829.
136 BSB-HSS Hagn 16.12.1827.
137 In den Journalen der Kabinettskassenverwaltung der entsprechenden Jahre erscheint es nicht (GHA Nachlass Ludwig I., 18, 19, 20 und 111, 112, 113).
138 Auch dieTagebücher König Ludwigs I. (BSB-HSS) geben dazu keine Anhaltspunkte. Ich danke Frau Dr. Ingrid Rückert für die Überprüfung. Vgl. dagegen das Verhalten des Königs bei Charlotte von Hagn, der nach ihrem Weggang aus München ein Berufsverbot ausgesprochen wurde. Bobbert 1936, 25 f.; 28 f.
139 Bobbert 1936, 25 f.; 28 f.
140 Nicht auszuschließen ist, dass König Wilhelm I. von Württemberg das Bild erworben hat. Jedenfalls scheint er die dritte Fassung von Stielers Auguste Strobl von 1828 besessen zu haben. Dazu Lempertz 2019, Lot 1507.