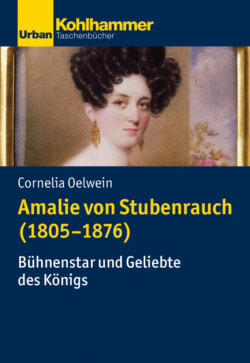Читать книгу Amalie von Stubenrauch (1805-1876) - Cornelia Oelwein - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Konkurrenz im eigenen Haus: Charlotte von Hagn
ОглавлениеWährend Amalie von Stubenrauch ihr Glück bei Gastspielen außerhalb Münchens suchte, drängte die Konkurrenz in München in ihre Rollen nach – allen voran Charlotte von Hagn. Daneben war Amalies Mentorin Adelheid Fries noch immer in vielen Hauptrollen zu sehen. Und schließlich übernahm auch Fräulein Fleckenstein zunehmend Amalies Rollen, jedoch mehr die Nebenrollen und dürfte insofern keine größere Rivalin gewesen sein.107
Anders sah dies bei Charlotte von Hagn aus. Die nur wenige Jahre jüngere Schauspielerin, die wie Amalie aus armen, niederen Adel stammte (die beiden Familien sollen sich gekannt haben)108 und die zu Beginn ihrer Karriere gleichfalls meist auf den Namenszusatz »von« verzichtete, war am 1. November 1826 fest am Hoftheater in München engagiert worden.109 Das »schöne Kind, mit allen Reizen einer Grazie ausgestattet« erregte mit ihrem Talent fürs Theaterspielen allgemeine Aufmerksamkeit. Die berühmte Schauspielerin Marianne Lang, über Jahrzehnte ein Stern am Münchner Theaterhimmel, hatte sich des jungen Mädchens angenommen. Mit 17 Jahren gab Charlotte ihr Debüt – ebenfalls in einem Schauspiel Kotzebues. Es folgten Nebenrollen in wenig bekannten Stücken. Ihr Spiel und ihre jugendliche Schönheit machten sie bald zu einem Liebling des Münchner Publikums.
So gefeiert sie als Schauspielerin war, ihre familiäre Situation sah äußerst düster aus. Auch hierin lassen sich Parallelen zum Werdegang Amalies feststellten. Charlottes Vater, der die kinderreiche Familie mehr schlecht als recht über Wasser hielt, wird als jähzornig und grob geschildert. Als er starb, musste Charlotte ihre Mutter und Geschwister alleine ernähren. Sie wandte sich an König Ludwig I., der nicht nur an ihrem Spiel, sondern auch an ihrem Äußeren Gefallen gefunden hatte, weswegen er sie auch von Joseph Stieler für die Schönheitsgalerie malen ließ. Im Winter 1827/28 besuchte er sie nahezu täglich, wohnte den Sitzungen beim Maler bei und schrieb dazwischen Billette. So konnte es nicht ausbleiben, dass eine Affäre mit dem König kolportiert wurde. Schmähschriften begannen zu kursieren, denen wiederum wohlwollende Gedichte folgten. Charlottes Popularität wurde dadurch weiter gesteigert. Zunehmend lief sie ihren Kolleginnen, die in denselben Rollen auftraten – allen voran Amalie von Stubenrauch –, den Rang ab. Trotzdem räumte sie neidvoll ein: »Die Stubenrauch darf machen, was sie will, sie gefällt.« Dies war der Rahmen, in dem Intrigen gedeihen konnten. So vertraute Charlotte ihrem Tagebuch am 8. März 1828 an: »Der König kam. Ich sprach von der Stubenrauch ihrer Unbelesenheit von Schiller etc.« Auch Amalies Freundinnen, allen voran Elise Seebach, wurden von ihr diffamiert.
Die Konkurrenz war nicht mehr zu übersehen. Kritische Stimmen mehrten sich, wohingegen Amalies Leistungen als »vorzüglich« beschrieben wurden.110 Gleichzeitig wurde Charlotte von Hagn ›aufgebaut‹: »Unsere neueste Preciosa, Dem. Hagn, schien sich eine neue Bahn brechen und die Preciosa als munteres, witzvolles, liebendes und gutmüthiges Zigeunermädchen, als eine Tochter der Natur auffassen zu wollen.«111 Die Situation spitzte sich weiter zu. Charlotte nutzte ihre Verbindung zum König und schrieb ihm am 3. Januar einen Brief, in dem sie um Hilfe in Sachen einer Aufführung der »Preciosa« bat. Sie wollte die Hauptrolle spielen. Amalie war zu dieser Zeit vermutlich noch nicht von ihrem Gastaufenthalt in Frankfurt zurückgekehrt. Am 8. Januar fand die Aufführung statt. Und Charlotte konnte mit Genugtuung in ihr Tagebuch notieren:
»ich gefiel mehr als die Stubenrauch, was zwar nicht viel sagen will, denn eine Schauspielerin, deren ganze Kunst sich auf Manier und Affection gründet, ist leicht zu erreichen. Ich wurde 2 mahl applaudirt«, musste aber zähneknirschend anfügen: »dafür aber diese [Stubenrauch] mehr gelobt.«112
In München bildeten sich zwei Lager: Das eine scharte sich hinter von Charlotte von Hagn, das andere hinter Amalie von Stubenrauch. Die beiden Schauspielerinnen wurden gegeneinander ausgespielt, Intrigen gesponnen und Zeitungsberichte pro und contra veröffentlicht. In eben diese Zeit fällt ein Bericht in der in Stuttgart bzw. Tübingen bei Cotta erscheinenden Zeitschrift »Hesperus«, in der es aus München heißt:
»Dlle Hagen [!], die talentvollste unserer jungen Anfängerinnen löste die Aufgabe der Thekla über alle Erwartungen glücklich und erfreute sich der lebhaftesten Anerkennung. […] Nicht so verhält es sich mit einer anderen Anfängerin, Dlle Stubenrauch, welche als Gräfin Terzky den Abgang der Mad. [Madame] Birch, und den nothwendigen Ersatz dieser Heroin nur zu fühlbar machte.«113
Auf der anderen Seite wurde die Aufführung von »Romeo und Julia« am 2. Oktober 1827 im »Tags-Blatt für München« totel verrissen, speziell die Schauspielleistung der Hagn. Der Kritiker spöttelte:
»Dlle Hagn, Julie, gestand, daß die Aufgabe zu groß und zu schwer war; in dieser Hinsicht war in ihrem Spiele Wahrheit, ächte, schöne Wahrheit; und sie verdient deswegen alles Lob.«114
Und dann war da noch die etwas unglückliche Begebenheit mit Michael Beer. Die deutsche Theaterwelt des 19. Jahrhunderts war relativ klein und der Kontakt unter den Künstlern sehr eng. So traf sich der Berliner Theaterschriftsteller Michael Beer um die Jahreswende 1827/28 mit Amalie in Frankfurt, um sich bei ihr über die Verhältnisse am Münchner Theater zu informieren. Besonders interessiert war Beer an der bevorstehenden Uraufführung seines Trauerspiels »Struensee«, wozu sein älterer Bruder Giacomo Meyerbeer die Bühnenmusik geschrieben hatte. Nachdem es in Berlin nicht zur Aufführung gekommen war, hatte sich Beer an seinen Freund Eduard Schenk, den gefeierten Dichter des »Belisar« und einflussreichen bayerischen Politiker, gewandt, der eine Aufführung in München befördern sollte.
Amalie hatte freilich mit Beer noch eine offene Rechnung zu begleichen. Der Schriftsteller hatte in einem (nicht mehr erhaltenen) Brief aus Stuttgart nach München (fälschlicherweise) verlauten lassen, dass die Stuttgarter Intendanz Stubenrauch nicht engagieren wolle. Beer versuchte sich zu rechtfertigen:
»Was ich darüber geschrieben, ist nichts anderes, als was ich in Stuttgart vernommen, und ich dachte, eine solche Äußerung an meinen Freund Schenk wohl ungestraft richten zu dürfen. Wer konnte denken, daß eine solche Äußerung, die in der That für das junge Mädchen ungemein kränkend seyn mußte, so verbreitet würde, daß sie ihr zu Ohren kommen mußte.«115
Und so verwundert es nicht, dass ihn Amalie offensichtlich äußerst ungnädig empfing, wie er Eduard Schenk ebenfalls klagte: »Denken Sie sich meine Situation, als mir das mit einer Natürlichkeit, die der jungen Schauspielerin auf der Bühne nicht übel stehen würde, ins Gesicht gesagt wurde. Ich hatte die Wahl, vor einer Dame als Verläumder oder als Grobian zu stehen.«116 Beers Sorge galt dabei den Auswirkungen auf die Münchner Theaterintendanz, da er »das Vorgefühl hatte, als habe es im allgemeinen ein Mißwollen gegen mich bey der Intendanz erzeugt.«117 Seinen Brief beednete er forsch mit ein paar Forderungen: »Das Stück enthält 36 Personen und ich setzte voraus, daß die Damen Fries, Stubenrauch, Hagn, die Herren Eßlair, Urban, Vespermann, Hölken, Racke als die mir wichtigsten des Stückes in der bestimmten Zeit in München gegenwärtig sind. Ende Januar kann das Stück beginnen, ausgetheilt zu werden.«118
Am 27. März 1828 kam es tatsächlich zur Uraufführung von »Struensee« in München, allerdings ohne die Mitwirkung von Amalie von Stubenrauch, obwohl sie in jenen Tagen im Lande war (sogar bereits am 21. Februar erstmals wieder auf der Münchner Bühne zu sehen war). Die Hauptrollen in »Struensee« spielten Charlotte von Hagn und Amalie Fries. Offensichtlich hatten sich die Differenzen nicht ausräumen lassen. Charlotte von Hagn scheint die Situation für sich genutzt zu haben. Auf einem Münchner Maskenball am 9. Februar hatte sie nämlich Beer beim Tanz kennengelernt. In den Tagen danach besuchte er sie, um ihre Rolle einzustudieren. Sie gab sich begeistert über das Stück – »Struensee, dieses Stück nehme ich unter eines der besten Trauerspiele unserer Zeit!« – und nutzte die Gelegenheit, um gegen ihre Konkurrentin zu intrigieren.119 Dem Stück selbst war allerdings kein größerer Erfolg vergönnt. Es kam zu einer zweiten Aufführung am 8. April, bei der jedoch nicht mehr applaudiert wurde. Das Manuskript zum Stück verschwand danach erst einmal in die Schublade.
Amalie, die ab dem 21. Februar 1828 wieder auf der Münchner Bühne stand, war weiterhin die beliebteste Schauspielerin, was sich auch in barer Münze niederschlug. So verdiente beispielsweise Charlotte entschieden weniger als Amalie. Der Unmut Charlottes wurde zusätzlich gesteigert, als ihre Anfrage für ein Gastspiel in Stuttgart, wo Amalie ein so glänzendes Angebot erhalten hatte, abgelehnt wurde. Am 17. April 1828 erhielt sie einen Brief aus Stuttgart, in dem man bedauerte, sie nicht spielen lassen zu können, »weil viele andere Gastspielerinnen kämen.« Zwar stellen die meisten Biographien Charlotte von Hagn in einem positiven Licht dar, doch ihr eigenes Tagebuch aus der Zeit von 1827/28 weist sie als Intrigantin aus. Es findet sich im Tagebuch kaum ein gutes Wort über ihre Kolleginnen und Kollegen. Gerade von Amalie liest man wiederholt, sie habe schlecht gespielt, während die Zeitungen deren Leistung gleichzeitig in den höchsten Tönen lobten.120
Im November 1827 war Charlottes Gehalt auf 600 Gulden festgelegt worden, während Amalie bereits 1 400 Gulden erhielt. 1829 verlangte sie eine Anpassung ihres Gehaltes an jenes der Stubenrauch, da sie ja auch ihre Rollen spiele. Immerhin wurde ihre Gage schließlich auf 1 000 Gulden angehoben. Ein weiteres Gesuch Charlottes um eine Gehaltserhöhung im Jahr darauf wurde von König Ludwig abgelehnt. Erst nach dem Freitod ihres Vaters am 5. Juli 1830 erhöhte der König in Anbetracht ihrer familiären Notlage auch Charlottes Gehalt auf 1 400 Gulden.121
Trotz Intrigen und Konkurrenz standen die beiden Schauspielerinenn Ende der 1820er Jahre mehrfach gleichzeitig auf der Bühne, etwa in »Essex«, einem Stück, in dem sie beide Hofdamen spielten: die eine Lady Nottingham, die andere Lady Ruthland. Oder in »Piccolomini«, von dem die Kritik zu berichten wusste: »Dlle [Demoiselle] Hagn als Prinzessin von Friedland leistete Erfreuliches in dieser Rolle und erhielt in der Schlußscene des vierten Actes den Beifall des Publikums. Dlle Stubenrauch trug die Rolle der Gräfin Terzky befriedigend vor.«122 Und dann traten sie im direkten Vergleich an verschiedenen Abenden in ein und derselben Rolle auf, etwa der Preciosa, in der beide gleichermaßen brillierten.
Die beiden Parteien standen sich zunehmend unversöhnlich gegenüber und auch die Presse schlug sich meist dem einen oder anderen Lager zu. »Dlle Stubenrauch bleibt mit Recht der Augapfel des Publikums. Selbst die Kritik, die sich ihres Amtes zufolge wenig gefallen läßt, fand heute, daß es Dlle. St. [Demoiselle Stubenrauch] immer mehr darum zu thun ist, alle in dieser Rolle liegenden und früher unaufhörlich herbeigerufenen Mittel, Effekte, Künste und Kunststückchen zu verschmähen. Dlle Stubenrauch wurde gerufen«123, hieß es etwa nach der Aufführung der Preciosa am 19. März 1828. Das sahen aber nicht alle so, und in einem anderen Blatt wurde in Versform von einem weiter nicht bekannten »K.« nach derselben Aufführung Partei für Charlotte Hagn ergriffen.124
Ein »höllisches Gedicht«, das möglicherweise von Theodor Körner stammte, bemühte dagegen in 30 Strophen neben der griechischen Mythologie sogar Goethe, Schiller und Kleist, um das Unvermögen der Hagn anzuprangern. Sogar Carl Maria von Weber, der Komponist zur Preciosa-Musik, äußerte sich laut diesem Gedicht sehr negativ über Charlotte in dieser Rolle.125
Allmählich setzte sich die Erkenntnis durch, dass die Münchner Bühne für diese beiden Schauspielerinnen zu klein sei. Amalie von Stubenrauch nahm schließlich ein verlockendes Angebot aus Stuttgart an, ihre Konkurrentin setzte später in Berlin ihre Karriere fort.126