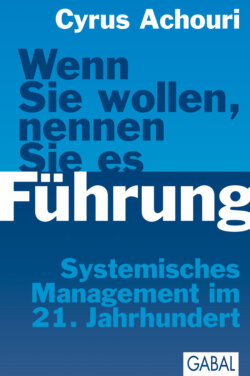Читать книгу Wenn Sie wollen. nennen Sie es Führung - Cyrus Achouri - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Systemische und darwinistische Evolutionsbiologie im Vergleich
ОглавлениеDer Begriff der Ordnung
Mit dem Gedanken der Selbstorganisation erhalten Begriffe wie »Selektion«, »Ordnung« und »Anpassung« im evolutionsbiologischen Kontext eine neue Bedeutung. Während im Darwinismus Ordnung im Wesentlichen durch den Selektionsprozess in die Welt kommt, beschreibt eine systemtheoretische Sicht Ordnung auf zwei andere Weisen: zum einen als Ordnung, die bereits vor jeder Selektion vorhanden ist, und zum anderen als Ordnung, die sich in iterativen Prozessen, bei genügend häufigen Wiederholungen von selbst einstellt.
Hier stellt sich die Frage, ob Selbstorganisation als Kriterium wiederholter Prozesse verstanden werden muss bzw. ob sie sich darin erschließend beschreiben lässt. Auf der anderen Seite lässt sich Selbstorganisation noch vor jeder Selektion (Kauffman 1998; Dawkins 2005a), also schon im Bereich der Mutation und darüber hinaus, als evolutionäre Determinante bestimmen. Schließen sich beide Verständnisweisen aus oder meinen sie das Gleiche? Muss jede Ordnung als Ergebnis eines iterativen Prozesses verstanden werden? Und in welcher Art und Weise wird der Begriff der Selbstorganisation in der Systemtheorie verwendet? Diese Fragen wollen wir im Folgenden versuchen zu klären.
Konkurrenz und Selektion als Ordnungsprinzip?
Relevant sind diese Fragen insbesondere im Rahmen eines Diskurses, der die Übertragbarkeit evolutionsbiologischer Thesen auf wirtschaftliche Fragestellungen prüft. Darwin ging davon aus, dass Ordnung als graduelle Anpassung auf der Ebene der ontogenetischen Selektion entsteht. Damit wäre Konkurrenz, noch als Voraussetzung für Selektion, als evolutionäres Ordnungsprinzip zu verstehen. Wenn wir aber davon ausgehen, dass Ordnung bereits vor jeder Selektion im Rahmen von Selbstorganisation immer schon vorhanden ist, und damit auch Anpassung im Sinne eines Überlebensvorteils hinfällig wird, wie erklärt sich dann die Entstehung von Ordnung? Wenn Selektion nicht als Ordnungsprinzip verstanden wird, kann auch Konkurrenz nicht mehr als notwendige Bedingung für Ordnung verstanden werden. Es macht für Systeme keinen Sinn, in Konkurrenz miteinander zu treten, wenn Selektion und Adaption in gleicher Weise als Bedingung für Überlebensfähigkeit (Viabilität) entfallen.
Endlose Suche nach einem Ordnungsprinzip
Viabilität richtet sich demnach direkt auf selbstorganisatorische Prozesse, und wir können uns wiederum fragen, wie die Ordnung dieser Selbstorganisation in die Welt kommt. Ist Ordnung im Rahmen von Mutationen immer schon vorhanden? Wenn ja, wie entsteht sie im Mutationsprozess? Letztlich verschiebt sich das gesuchte Ordnungsprinzip so in einem infiniten Regress und lässt sich dann ebenso als evolutionäre Weltformel begreifen. Andererseits ist Wiederholung selbst als Ordnungsprozess zu sehen, indem iterative Reaktionsweisen evolutionär stabile Routinen bilden, sofern sie sich als tauglich im Überlebensprozess erweisen.
Evolutionärer Dreischritt – und Erweiterung
Wenn Selbstorganisation schon vor jeder Selektion vorhanden ist, dann müssen wir den evolutionären Dreischritt der Prozesse von Variation, Selektion und Retention, wie ihn Fritz B. Simon (2007) beschrieben hat, erweitern zu: Selbstorganisation, Variation, Iteration und Selektion durch Reproduktion (auch diese ist als eine Form der Iteration zu verstehen). Selbstorganisation ist immer schon im Organismus vorhanden, bereits vor jeder Beeinflussung durch die Umwelt. Die Impulse der Umweltereignisse führen bei autopoietisch verstandenen Systemen zu sogenannten Variationen, also Versuchen des Systems, die durch die Umwelt entstandene Störung von außen (Perturbation bzw. Irritation) mit operationalen Veränderungen auszugleichen.
Iteration
Simon führt nach dieser Prozessphase die Iteration ein, indem »manche der dazu kreativ entwickelten Reaktionsschemata bei erneuter Irritation/Perturbation dieses Typs wiederholt werden und andere nicht wiederholt werden. Diejenigen, die nicht wiederholt werden, werden dann gewissermaßen … im Rahmen eines Lernschemas verworfen … diese Auswahl (Selektion) ist ein selbstorganisierter Prozess, der nicht zielgerichtet stattfindet. Und stabilisiert wird sie erst durch die Wiederholung, d. h. durch die Routinisierung, als Antwort auf einen bestimmten Typus von Umweltereignis. Die so gefundene Lösung für das Problem, das durch die Veränderung in einer relevanten Umwelt des Systems entstanden ist, wird dadurch beibehalten (Retention) und als Verhaltensschema dem jeweiligen System verfügbar.« (Simon 2007, 83f.)
Formel für den evolutionären Prozessablauf
Die Überlebensfähigkeit des Systems ist damit noch unberührt, sodass hier Iteration noch vor der Phase selektiver Reproduktion beschrieben wird. Möglicherweise ließe sich der evolutionäre Prozessablauf in Fritz Simons Konzept formalisiert also folgendermaßen darstellen:
Selbstorganisation (So) > Perturbation (P) > Variation (V) > Perturbation' (P') > Iteration der Variation (I(V)) > Retention (R)
Also:
(So) > (P) > (V) > (P') > (I(V)) > (R)
Die Iteration bzw. Stabilisierung wird dann mit der Selektion gleichgesetzt und damit mit der Viabilität bzw. Reproduktion. Zugleich wird die Iteration der Variation (I(V)) bei Simon als selektiver Prozess bezeichnet, der nicht zielgerichtet stattfindet. Hier stellt sich die Frage, wie dies zu denken ist, denn sind nicht die operationalen Prozesse selbstorganisatorischer Systeme autopoietisch zu verstehen, sodass sie keine Zielgerichtetheit auf die Umwelt, wohl jedoch auf die innere operationale Prozesslogik aufweisen? Dann wären selbstorganisatorische Systeme entelechisch: Sie tragen das Ziel ihrer Entwicklung immer schon in sich.
Wir wollen prüfen, ob die Formel zur Prozessbeschreibung so ausreicht, um systemisch-evolutionäre Prozesse vollständig zu beschreiben. Zur Vereinfachung gehen wir im Folgenden nur von einer erfolgreichen Variation aus, also von dem Fall, in dem die Variation (V) beibehalten und nicht verworfen werden muss. Hier stellen sich einige Fragen:
Wenn wir davon ausgehen, dass die operationale Struktur in Systemen bereits von jedem beliebigen Anfang an wirkt (So) und es das Ziel für die Systeme ist, diese Struktur aufrechtzuerhalten, so wirken Einflüsse als Perturbationen, die diese Aufrechterhaltung stören (P). Im Sinne der strukturellen metabolischen Kopplung von Systemen an die Umwelt ist zwar die Aufrechterhaltung nie homöostatisch und völlig geschlossen zu sehen, dennoch bewirkt der Wechsel der Stoffe nicht den Wechsel der inneren Operationen.
Perturbationen: stoffverändernd, nicht formverändernd
Perturbationen (P) sind nicht als formverändernd, sondern nur als stoffverändernd denkbar, mit anderen Worten, sie wirken strukturell und nicht operational. Reaktionen des Systems auf Perturbationen können deshalb als Variationen (V) bezeichnet werden, weil keine neue Information in das System getragen wird, sondern vielmehr die vorhandene Information variiert wird. Um die Neutralität dieses Vorgangs zu verdeutlichen, könnte man den Begriff der »Störung« deshalb auch durch den des »Impulses« ersetzen.
Wird nun eine Perturbation gleichen Typs wiederholt (P'), so entsteht nach obiger Formel eine stabilisierte Routine als Lösungsantwort des Systems, die Variation wird iteriert (I(V)). Unter evolutionärer Perspektive können wir fragen, ob dies bereits die Grundkonstante selbstorganisatorischer Systeme darstellt, Selbstorganisation also immer schon in der Ordnung ihrer Organisation als iterativer Prozess, der sich evolutionär gebildet hat, verstanden werden muss.
Richard Dawkins spricht dies beispielsweise mit der »Evolution der Evolutionsfähigkeit« an, wonach aufgrund des modularen Aufbaus der Evolution diese immer besser und auch schneller abliefe. Wie sollte aber diese Verbesserung sich anders erklären als durch das Resultat evolutionären Lernens? Zum anderen ließe sich fragen, ob es als evolutionär erfolgreiche Strategie gelten könnte, wenn Selbstorganisation in ihrer Grundinformation schon von Beginn an festgelegt wäre. Plausibler erscheint eine Festlegung auf grundsätzliche Strukturen, die aber gerade flexible Varianten für noch kommende Überlebensherausforderungen offen lassen. (Vester 2002)
Modifizierte selbstorganisatorische Systeme
Betrachtet man sehr große Zeiträume, würden der iterativen Variation somit modifizierte selbstorganisatorische Systeme folgen: (So'), (So''), (So''') …. (So∞). Dann gilt:
(So) > (P) > (V) > (P') > (I(V)) > (So') >
(So') > (P) > (V) > (P') > (I(V)) > (So'') > … usw.
Wir könnten demnach verkürzt schreiben, mit (S) als letztlich stattfindender Selektion:
Um das Konzept der Selbstorganisation besser zu verstehen, wollen wir uns nun mit den Unterschieden zur darwinschen Theorie befassen. Verdeutlicht werden sollen auch die Konsequenzen, die dies für Konkurrenz, Kooperation, Adaption etc. hat. Formal dargestellt lautet Darwins evolutionsbiologische Formel für Mutation (M), Selektion (S) und Replikation (R):
Anpassung an die Umwelt
Dies ist aber für unseren Kontext noch nicht aussagekräftig, weil die Rolle, welche die Interaktion zwischen Organismus und Umwelt spielt, hier nicht deutlich wird. Wir müssen demnach die Anpassung an die Umwelt als Selektionskriterium bei Darwin mit aufnehmen und der Variation selbstorganisatorischer Systeme gegenüberstellen.* Demnach würde nach erfolgter mutationaler Streuung der Umweltdruck (U) zu einer Anpassung (A(U)) des Organismus führen, der primär, wie der Name schon sagt, eine Anpassung an die jeweiligen Umwelteinflüsse darstellt. Ist die Anpassung erfolgreich, so erfolgt eine Selektion und möglicherweise im Weiteren die Replikation. Je höher die Anpassung, desto wahrscheinlicher ist der Selektionsvorteil. Anpassung wird dabei als Anpassung an die Umwelt, also auch an andere Organismen verstanden. Organismen stehen mithin in Konkurrenz um die bessere Anpassung an die Umwelt und die damit verbundene bessere Überlebensfähigkeit. Formal lässt sich dies ausdrücken als:
Ordnung durch Anpassung an die Umwelt
Ordnung kommt nach Darwin also spätestens auf der Ebene der Selektion (S) in die Welt. Bereits auf der Ebene der Anpassung ist jedoch ein Ordnungsprinzip auszumachen, denn der Organismus übernimmt die Struktur oder die Ordnung der Außenwelt, und wenn sich dies als erfolgreich erweist, wird sie beibehalten. Da die darwinistische Theorie davon ausgeht, dass die Außenwelt in ihrer Struktur erkennbar ist, lässt sich der Erfolg vom Organismus selbst erkennen und abschätzen, er wird also nicht lediglich von außen, von der Umwelt, im Sinne einer Überlebensfähigkeit bestimmt. Demnach übernimmt ein Organismus nach erfolgter Anpassungsstrategie (A(U)) diese Reaktion bei Erfolg als stabile Routinereaktion in sein Repertoire auf und iteriert sie im Folgenden.
Autopoiese versus Anpassung
Im Unterschied zur Selbstorganisation, die ein Verhalten im Sinne von Karl Popper so lange iteriert, bis eine Falsifikation eintritt (Popper 1934) und das eigene Muster modifiziert werden muss, ist der Organismus im darwinschen Sinne bereits vorher in der Lage, seine Reaktionsweisen anzupassen, unabhängig von jedem Hindernis. Während der selbstorganisatorische Organismus bestrebt ist, ständig seine Autopoiese zu verwirklichen, ist der Organismus im darwinschen Sinne bestrebt, seine Anpassung zu optimieren. Dies kann theoretisch bereits vor der Selektion erfolgen, wird praktisch aber wohl vor allem durch Umwelt- und Selektionsdruck passieren. Hier noch einmal die beiden Prozesse zur Verdeutlichung formal gegenübergestellt:
Dem Umweltdruck (U) entspricht in systemischer Terminologie die Perturbation (P). Entscheidend für das Moment der Konkurrenz ist nun der Zeitpunkt nach (U) resp. (P). Für Darwin entsteht Ordnung durch Anpassung (A) und Selektion (S). Die Ordnung der Selektion ist dabei anders als im systemtheoretischen Verständnis keine negative, sondern eine affirmative S(a), da diejenigen Organismen überleben, die besser angepasst sind, Selektion beinhaltet also eine Information. Jede neue Mutation startet deshalb auch mit dem Ordnungsgehalt erfolgter Anpassung auf Ebene der Selektion M(A). Demgegenüber beinhaltet die Selektion in systemtheoretischer Hinsicht keine Information, sie wirkt lediglich als Ausschluss, letztlich als Überlebensfrage oder in abgeschwächter Form als graduelle Störung der Autopoiese. Auch dies kann als Ordnungsfunktion verstanden werden, allerdings nur im Sinne einer Negation S(n). Zusätzlich ist Ordnung systemtheoretisch auch immer schon im Sinne der Selbstorganisation (So) sowie der Iteration (I) vorhanden. Die beiden Formeln lauten in ihrer Kurzfassung demnach:
| Systemischer Formalismus | Darwinistischer Formalismus |
Unterscheidungskriterium externer Maßstab
Beim darwinistischen Modell wird die Anpassungsleistung des eigenen Systems und gegebenenfalls fremder Systeme über einen dritten Maßstab gemessen; dabei ist dann Konkurrenz im Spiel. Hingegen variiert das systemische Modell lediglich die eigenen Operationen (V), ohne Referenz auf die Umwelt oder andere Systeme als externem Maßstab.
Vielleicht kann Zenons Paradoxon von Achill und der Schildkröte den Unterschied noch einmal verdeutlichen: Eine Schildkröte wettet mit dem schnellen Achill, dass er sie, mit einem kleinen Vorsprung bedacht, nie einholen könne, und sie behält recht. Achill muss nämlich immer erst zu dem Punkt kommen, an dem sie schon ist. Während Achill die Strecke bewältigt, die die Schildkröte als Vorsprung bekommen hat, verschafft sich die Schildkröte einen neuen – wenn auch kleineren – Vorsprung. Und so geht es weiter. Mithin kann sich Achill asymptotisch annähern und die Entfernung ständig verringern, aber er kann das Tier doch nie einholen. Die Parabel verdeutlicht die Unmöglichkeit systemischen Wettkampfs. Im darwinistischen Verständnis des Wettkampfs würde natürlich Achill siegen, denn Wettkampf würde dann als Vergleich der beiden gegenüber einem dritten Maßstab verstanden werden, in diesem Fall einer gesetzten Ziellinie.
Unterscheidungskriterium Konkurrenz
Unter erkenntnistheoretischen Gesichtspunkten legt das darwinistische Modell in seiner Abbildtheorie einen philosophischen Realismus zugrunde. Daher wird Adaption als Vergleich mit einem externen dritten Maßstab verstanden. Das eigene System vergleicht sich und andere Systeme anhand des durch die Umwelt vorgegebenen Maßstabs, dem Tertium Comparationis. Konkurrenz kann somit definiert werden als der Vergleich aller Organismen am Maßstab ihrer Anpassung an die Umwelt.
In systemtheoretischer Perspektive findet kein Vergleich statt, da erkenntnistheoretisch die Außenwelt weder erkannt noch fokussiert wird. Die Umweltanpassung (A(U)) wird hier lediglich als Variation (V) eigener Systemordnung verstanden. Hat man dies verstanden, wird auch klar, dass im systemtheoretischen Sinne ein Organismus nicht zu anderen in Konkurrenz treten kann. Ein Vergleich mit anderen setzt einen Vergleichsmaßstab als drittes Moment voraus. Wird dieser nicht angelegt, kann man zwei Individuen in ihrer jeweiligen Einzigartigkeit nicht vergleichen. Mit sich selbst in Wettkampf zu treten, ist ebenfalls unsinnig, denn Konkurrent und Maßstab werden dann identisch.
Unterschiedliches Verständnis von »Leistung«
Die Differenz von Umweltanpassung im darwinistischen Sinne (A(U)) und Variation im systemischen Sinne (V) zeigt sich beispielsweise auch darin, wie Motivation und Leistung eines Organismus definiert werden. Im darwinistischen Sinne entspricht Leistung einer Anpassungsleistung, die mithilfe eines externen Maßstabs, der überindividuell gesetzt ist, ermittelt wird. Dieser Maßstab ist für alle Organismen gleich. Im systemischen Sinne entspricht Leistung der Variationsleistung, eine Leistung, die von außen gleichsam erzwungen wird, auf Ebene der Selbstorganisation aber immer schon vorhanden ist. Dagegen scheint der darwinistisch verstandene Organismus aktive Leistung an die Adaption zu binden, die Leistung wird damit durch das Delta von Umwelt- zu Selbststruktur bestimmt. Fehlt dieses Delta, findet sich im Organismus nach dieser Theorie zunächst kein Leistungsinteresse. Aus diesem Paradigma ergibt sich auch die geläufige Folgerung, dass die Natur des Menschen so gestrickt sei, dass er vor allem unter Druck und Anpassungszwang zu Leistung bereit sei.
Unterschiedliches Verständnis von »Motivation«
Auch Motivation wäre demnach im darwinistischen Sinne extrinsisch, durch den Anreiz, das Delta zu vermindern, geprägt. Im systemischen Sinne dagegen ist Motivation immer schon vorhanden, noch vor jeder Perturbation. Dies zugestanden, können wir uns fragen, ob Motivation durch Perturbation nicht reziprok zum darwinistischen Verständnis gesehen werden muss, also als abnehmend bei zunehmender Perturbation. Ein Organismus, der die Selbstorganisation aufrechterhalten will, fühlt sich durch Perturbationen in seiner Organisation gestört und nicht motiviert. Konkurrenz kann somit nach systemischer Theorie kein leistungssteigerndes Mittel sein. Konkurrenz kann in systemischem Verständnis gar nicht als solche wahrgenommen werden, weil der hierfür nötige Vergleichsmaßstab im System fehlt. Zum anderen wird Leistungsdruck in systemischer Weise nicht mit Adaptionsleistung beantwortet, sondern mit Variation, welche mit verminderter Selbstorganisation gleichgesetzt werden kann. Dies wird, aller Wahrscheinlichkeit nach, Motivation aber nicht stärken, sondern schwächen. Das darwinistische Paradigma der Konkurrenz hingegen verspricht eine Leistungssteigerung durch Anpassungsdruck.
In dem Maße, wie die Systemtheorie Anpassung in diesem Sinne nicht kennt, sind auch die Begriffe von Leistung und Motivation neu zu definieren. Leistung findet demnach immer schon statt, unabhängig vom vorhandenen Umweltdruck. Ebenso ist die Motivation, Leistung zu erbringen, im selbstorganisatorischen System bereits ab ovo angelegt. Hindert man Systeme an ihrer Tätigkeit, so werden Motivation und Leistung gemindert, nicht gefördert. Diese Aussagen haben entscheidende Folgerungen für Unternehmen und erfolgreiches Performance-Management, wie wir in Kapitel 11 noch sehen werden.