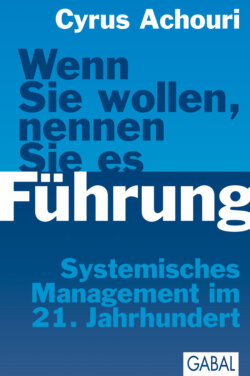Читать книгу Wenn Sie wollen. nennen Sie es Führung - Cyrus Achouri - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Blick auf das Ganze
ОглавлениеSystemisches Denken hat nichts mit der vielstrapazierten Vernetzung, einer Suche nach Weltharmonie, mit Esoterik oder dergleichen zu tun. Trends wie »Kooperatives Führungsverhalten«, »Hedonismusprinzip«, der Ruf nach »Selbstentfaltung« und »Selbstverwirklichung« (Malik 2009, 59) mögen eine gewisse Faszination ausüben, haben aber mit systemwissenschaftlicher Forschung wenig zu tun und bringen die Systemtheorie durch ihre mangelnde Fundierung eher in Misskredit.
Kein einheitliches Verständnis von »systemischer Führung«
Von einem einheitlichen Verständnis systemischer Führung kann kaum gesprochen werden, die verschiedenen Schulen haben bestenfalls das Denken in »vernetzten Systemen« gemeinsam und unterscheiden sich ansonsten doch erheblich in Inhalt, Praxis- oder auch Theorie- und Wissenschaftsbezug. (Steinkellner 2007) So ähneln beispielsweise die Inhalte der »Human-Relations«-Strömung – partizipative Führung, teilautonome Gruppen, Selbstverwirklichung der Arbeitnehmer oder die Schaffung einer Unternehmenskultur des Vertrauens – denen der systemischen Führung, ohne jedoch auf die von der Systemtheorie getroffene Argumentation zurückzugreifen. Ich werde in diesem Buch keine humanistisch orientierte Systemtheorie entwerfen, sondern vielmehr die Erkenntnisse aus der Systemtheorie nutzen, um systemische Führung als effizienten, der Natur lebender Systeme entsprechenden Ansatz zu präsentieren.
Systemtheorie und Betriebswirtschaftslehre
Gerade Ansätze der Selbstorganisation bieten ein Vorbild für die Bewältigung komplexer Managementaufgaben, einer Komplexität, die in dieser Form vor einigen Jahrzehnten noch nicht vorhanden war. Ein interdisziplinärer Ansatz wie die Systemtheorie hat es allerdings schwer, sich in der Betriebswirtschaftslehre durchzusetzen. Dabei ist gerade die Betriebswirtschaftslehre durch ihre generalistische Ausrichtung aufgefordert, aktuelle, einzelwissenschaftliche Ergebnisse aufzunehmen. Der Betriebswirt kann sich nicht auf Bilanzierungsfragen beschränken; sein angewandtes Wissen speist sich heute aus so unterschiedlichen Disziplinen wie Mathematik, Psychologie oder Rechtswissenschaften.
Empirische Daten und Theorie
Oft wird vergessen, was die Ursprünge systemischen Denkens ausgemacht hat, nämlich eine übergreifende interdisziplinäre Suche nach Zusammenhängen. Systemtheorie kann sich demnach nicht in der empirischen Suche nach passenden Daten erschöpfen. Selbst wenn sich heute in vielen Studien und praktischen Beispielen zeigt, dass kollektive Intelligenz, Kooperation und Selbstorganisation für die Team- und Einzelleistung in Unternehmen eine große Rolle spielen, müssen wir doch auch verstehen, wieso das so ist, welche theoretische Annahme hier zugrunde liegt.
Notwendig ist dies, um sich von den vorliegenden empirischen Daten zu »emanzipieren«; vergleichbar mit der Vermeidung des naturalistischen Fehlschlusses in der Ethik – bei dem alles gut wäre, was praktiziert wird. Zum anderen würde eine Begrenzung auf die empirischen Daten unseren Spielraum auf das beschränken, was bereits gemacht wird. Das würde sowohl unser derzeitiges Handeln als auch unsere Kreativität und Überlebensfähigkeit für die Zukunft erheblich begrenzen.
Empirische Forschung ist einerseits unverzichtbar. Andererseits sollten wir nicht vergessen, dass empirischer Erfolg nicht notwendigerweise die zugrunde liegenden Konstruktionen beweist. (Gergen 2002) Die Entwicklung qualitativ hochwertiger theoretischer Ansätze in der Forschung bleibt unabdingbar.
Rückgriff auf einzelwissenschaftliche Ergebnisse
Wir kommen um eine fundierte Rückführung des systemischen Paradigmas auf aktuelle, einzelwissenschaftliche Ergebnisse nicht umhin. Darüber hinaus müssen die Aussagen ihrerseits wiederum empirisch überprüft werden. Für systemische Führung heißt das beispielsweise, Prinzipien für lebende Systeme aus biologischer und kultureller Evolution aufzufinden, um in der Folge konkrete Aussagen daraus ableiten zu können, beispielsweise wie Motivation entsteht und wie mit Mitarbeitern umgegangen werden muss, sodass diese möglichst motiviert und leistungsfähig sind.
Ziele dieses Buches
All dies wollen wir in diesem Buch tun. Diese Arbeit wird notwendigerweise immer bruchstückhaft bleiben. Schon auf dem Gebiet einzelwissenschaftlicher Forschung ist es unmöglich, den aktuellen Stand der Forschung zu spiegeln. Mithin kann dies nicht das Ziel eines Überblicks sein, der den Bogen von einzelwissenschaftlichen Aussagen bis hin zu praktischen Managementempfehlungen spannt. Vielmehr soll dieses Buch Verbindungen schaffen, Ideen geben, einen roten Faden spinnen, der sich über die einzelwissenschaftliche Isolation hinausbegibt und einen Anstoß für systemisches Management in Wissenschaft und Praxis liefert.
Bewusst ausgeklammert habe ich einige Strömungen der Systemtheorie, die den Rahmen sprengen würden. So werden etwa soziologische Systemtheorien (Parsons, Luhmann et al.) zur Aufklärung gesellschaftlicher Verhältnisse nur gestreift, politische (Kaplan, Easton, Deutsch et al.), wie sie insbesondere in den 1950er-Jahren in den USA im Rahmen des Szientismus aufkamen (Albert/Walter 2005), ganz ausgelassen. Insbesondere die soziologische Systemtheorie findet sich in der deutschen Systemlandschaft schon erheblich weiter ausgearbeitet, als dies bei den Wirtschaftswissenschaften der Fall ist. Dieses Buch soll dazu beitragen, den Entwicklungsabstand zu verringern.
Keine Trennung von naturwissenschaftlicher und geisteswissenschaftlicher Systemtheorie
Die Differenzierung in naturwissenschaftliche und geisteswissenschaftliche Systemtheorie erscheint mir wenig sinnvoll. Das Unterscheidungskriterium, dass naturwissenschaftliche Systemtheorie von objektiver Messung ausgehe, während sozialwissenschaftliche den Beobachter mit einschließe (Tschacher 2004), entspricht spätestens seit Aufkommen der Quantenphysik nicht einmal mehr dem naturwissenschaftlichen Weltbild. Zudem ist das systemtheoretische Paradigma gerade angetreten, eine für Natur- und Geisteswissenschaften gemeinsame Beschreibung anzubieten.
Interdisziplinarität
In der Folge werden deshalb Themencluster gebildet: von Evolutionsbiologie, Physik, Chaosforschung, Erkenntnistheorie, Philosophie, Kognitionswissenschaften, Entwicklungspsychologie, Coaching/Therapie und kultureller Evolution bis hin zur aktuellen Führungsstillehre und zu systemischem Management. Systemtheorie bündelt durch die interdisziplinäre Vernetzung viele Beobachtungen, auch wenn es sich dabei nur um relativ wenig Merkmale handelt, wie die Merkmale der Verschränktheit aller Systeme, Selbstorganisation und Autonomie oder auch der Koevolution und Kooperation. (Hawking 2009) Systemtheorie kann als gemeinsame Sprache verstanden werden, die sich aus so unterschiedlichen Bereichen wie Physik, Chemie, Biologie, Biochemie oder auch Physiologie herausgebildet hat. (Kriz 2004) Gerade auch Vertreter der »harten« Naturwissenschaften wie Hermann Haken begrüßen die interdisziplinäre Grenzüberschreitung in Systemtheorie und Synergetik. (Haken 2004) Ebenso haben sich Vertreter der Geisteswissenschaften immer wieder für ein interdisziplinäres Verständnis der Systemtheorie ausgesprochen, das angeborene Strukturen, biochemische und neuronale Prozesse, die Physis, die Familie oder auch die ökonomische Situation miteinbezieht. (Kriz 1989; Schiepek 2004)