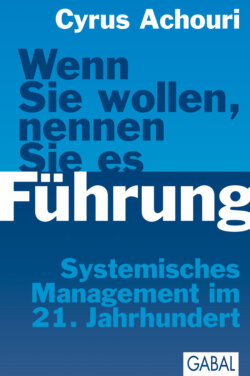Читать книгу Wenn Sie wollen. nennen Sie es Führung - Cyrus Achouri - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Systemtheorie gestern, heute und morgen
Оглавление»Es gibt sie nicht: ›die systemische Wirtschaftstheorie‹. Bestenfalls kann von Ansätzen dazu gesprochen werden. Eine ernst zu nehmende, breite wissenschaftliche Auseinandersetzung über die Anwendung der neueren Systemtheorie auf die Wirtschaftswissenschaften ist nicht zu finden. Und die Fragen, die sich aus einem systemtheoretisch-konstruktivistischen Paradigma in den Wirtschaftswissenschaften ergeben, sind zahlreicher als die Antworten.« (Simon 2009, 11)
Weit verbreitet: systemische Begriffe
Für einen Großteil der »systemischen« Managementliteratur gilt, dass sie zwar systemische Begriffe aufgenommen hat, beispielsweise den der »Vernetzung«. Eine konsistente Ausarbeitung, insbesondere im Bereich Führung, scheint aber bis heute noch nicht erfolgt zu sein.
Betrachtet man den Status quo der Systemtheorie insgesamt, bietet sich ein sehr heterogenes Bild einzelner Ansätze. Während in einzelnen Teilgebieten wie der systemischen Therapie große Fortschritte und Erfolge erzielt wurden, hat die Zahl der in entsprechenden Verbänden organisierten Systemforscher und -praktiker seit den 1970er-Jahren kontinuierlich abgenommen. (de Zeeuw 2005) Charles François (1995) dagegen ist der Überzeugung, dass eine allgemeine Systemtheorie noch gar nicht formuliert wurde. Und für Oswald Neuberger (2002) steht die Umsetzung auf Teilgebiete wie die Wirtschaftswissenschaften noch aus – was ein völliges Umdenken im Rahmen einer systemischen Personalführung erfordere.
In der führenden amerikanischen Managementliteratur zeigt sich systemisches Denken als hochaktuell, wenn auch meist unter anderem Namen. Theoreme wie »Emergenz«, »Singularität« oder »Best Practices zu kollektiver Intelligenz in Hochleistungsteams« führen bekannte, systemische Paradigmen in neuem Gewand weiter.
Anfänge der Systemtheorie
Die Systemtheorie wurde vor allem ab den 1940er-Jahren populär. Hier spielten der Zweite Weltkrieg wie auch das Aufkommen der Neurophysiologie und die Entwicklung des Computers eine wichtige Rolle. Den entscheidenden Durchbruch für eine neue Sicht lebender Systeme im Sinne von Selbstorganisation leiteten der Physikochemiker Ilya Prigogine – mit seiner Arbeit zu dissipativen Strukturen – und Heinz von Foerster – Mitbegründer der kybernetischen Wissenschaft – ein. Die chilenischen Biologen Humberto Maturana und Francisco Varela führten das Paradigma der Selbstorganisation lebender Systeme dann in ihrer Konzeption der »Autopoiese« weiter.
Autopoiese/Selbstorganisation
Die Eigenschaft lebender Systeme, sich unter Beibehaltung ihrer inneren Integrität ständig selbst zu erneuern und Strukturen in Prozesse aufzulösen, führte zu einem völlig neuen Verständnis lebender Systeme. (Jantsch 1992) Die Grundprinzipien der Selbstorganisation wurden auf immer mehr Bereiche ausgeweitet: auf ökologische und soziobiologische Aussagen (Eigen/Winkler 1996) bis hin zu makroskopischen Aussagen über die Biosphäre (Margulis/Lovelock 1974). In diesem Sinne wurden Biosphäre und Atmosphäre als autopoietisches System gesehen, das sich selbst organisiert und regelt. Man spricht hier von der Gaia-Hypothese, die ihren Namen in Anlehnung an die Erdmutter der griechischen Mythologie erhalten hat.
Nach einer außerordentlich fruchtbaren Zeit bescheinigt Dirk Baecker (2005) der Systemtheorie, heute kaum noch eine wissenschaftliche Rolle zu spielen. In Deutschland und Österreich bzw. europaweit scheine noch am ehesten ein Interesse an diesen Fragestellungen vorhanden zu sein. Der Versuch, mit den einzelwissenschaftlichen Erkenntnissen Schritt zu halten und diese immer wieder aufs Neue systemtheoretisch zusammenzuführen, scheint aufgegeben worden zu sein. Gerade die Selbstverständlichkeit des Wechsels zwischen Naturwissenschaft und Sozialwissenschaft habe sich früher als sehr produktiv erwiesen, während heute die intellektuelle Neugier nachgelassen habe. (Stichweh 2005)
In Krisenzeiten populär?
Anders als Dirk Baecker zeichnet Peter Kruse ein durchaus positives Bild der Entwicklung der Systemwissenschaften im letzten Jahrzehnt. Gerade die Chaostheorie, die Theorie der Selbstorganisation sowie die Synergetik hätten sich zu einem intensiv diskutierten, interdisziplinären Forschungsbereich entwickelt. (Kruse 2009) Nehmen wir den Bereich der evolutionären Systemtheorie noch dazu, so könnten wir auch Disziplinen wie die Bionik anführen. Auch scheint die Systemtheorie populärer zu sein, wenn die Bewältigung globaler Krisen ansteht, wie sich anhand der Debatte um die Klimakrise oder die Finanzkrise zeigt.
Vielleicht treffen systemtheoretische Überlegungen auch gerade deshalb den gesellschaftlichen Nerv, weil in einer zunehmend komplexer werdenden Welt Vorhersagen immer schwieriger werden. Notwendig sind dann Konzepte, die dieser Komplexität versuchen gerecht zu werden und Innovationspotenzial besitzen, ohne die Gültigkeit bestehender Erkenntnisse und Forschungsstrategien zu widerlegen. So folgert Kruse: »Die Zeit der Vordenker ist ein für alle Mal vorbei. Ob in Kultur, Wirtschaft oder Politik – angesichts der Komplexität und Dynamik der von uns selbst erzeugten gesellschaftlichen Wirklichkeit gibt es keine Patentrezepte mehr. Wir sind angewiesen auf die Bereitschaft aller, sich bei vollem Bewusstsein der Risiken immer wieder neu auf die Faszination gemeinsamer Lernprozesse einzulassen.« (Kruse 2009, 212)
Der Arbeitnehmer der Zukunft
Wenn man sich mit dem möglichen Stellenwert systemischer (Personal-)Führung in der Zukunft beschäftigt, muss man zunächst verstehen, wie sich die Arbeitnehmerwelt generell entwickelt. Dauerhafte, lebenslange Anstellungsverhältnisse werden immer weniger den Normalfall darstellen, Mitarbeiter müssen ihre Karrierewege selbst in die Hand nehmen. Um mit den schnellen Veränderungen mithalten zu können, müssen sie eine erhebliche permanente Lern- und Veränderungsfähigkeit mitbringen. Lernen endet nicht mit dem Hochschulabschluss oder der Ausbildung, sondern wird ein Leben lang anhalten. Die Verantwortung für die eigene »Employability« wird nicht mehr von den Unternehmen übernommen, jeder Arbeitnehmer hat selbst seine Personalentwicklung und Marktkompatibilität im Auge zu behalten. Globale, hochkomplexe Zusammenhänge können nicht mehr eindimensional, monokausal und lokal verstanden werden. Visionen und unternehmerische Leitbilder werden nicht mehr von nur wenigen Führungspersonen getragen. Systemisches Denken bietet hier einen hochaktuellen theoretischen und praktischen Ansatz, mit dieser Komplexität umzugehen.