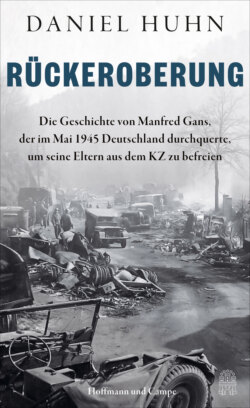Читать книгу Rückeroberung - Daniel Huhn - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Jugend in Borken
ОглавлениеBorken ist eine Kleinstadt im westlichen Münsterland, nahe der niederländischen Grenze. Nicht weit vom Rhein, aber abseits der größeren Städte der Region gelegen. Landwirtschaft und Textilindustrie prägen die Stadt. Knapp 8000 Menschen leben in Borken in den zwanziger Jahren. Die meisten sind streng katholisch. Doch bereits seit über 600 Jahren leben auch Juden in der Stadt. Die Familie Gans gehört zu den bekannten Familien in Borken. Manfreds Großvater Carl Gans wanderte aus den Niederlanden ein. Mit Hilfe eines Heiratsvermittlers lernte er Amalia Windmüller kennen, die aus einer alteingesessenen Borkener Familie stammt. Entgegen dem damaligen Brauch, dass die Braut zur Familie ihres Mannes zieht, folgt Carl seiner Frau nach Borken, wo er einen Textilgroßhandel aufbaut. Das Paar bekommt zehn Kinder: fünf Jungen und fünf Mädchen. Der vierte in der Reihe ist Moritz, Manfreds Vater, ein lebhaftes und strebsames Kind. Im Alter von 16 Jahren, noch bevor er das Gymnasium beendet, geht Moritz für eine kaufmännische Ausbildung nach Frankfurt. Zurück in Borken übernimmt er schließlich zusammen mit seinen vier Brüdern die gut laufenden Geschäfte des Vaters.
Moritz bleibt seiner Heimatstadt eng verbunden, hat in Frankfurt aber auch das Großstadtleben schätzen gelernt. So zieht es ihn von Zeit zu Zeit nach Köln, um in einem der prächtigen Ballhäuser tanzen zu gehen, besonders zum Karneval. Dort lernt er kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs Else Fraenkel kennen, eine attraktive und selbstbewusste junge Frau. Die beiden verloben sich schon bald. Doch der Krieg zerschlägt ihre Heiratspläne. Wie seine vier Brüder kämpft auch Moritz für das deutsche Kaiserreich an der Front. Erst nach Kriegsende, 1918, kehrt er nach Borken zurück – dekoriert mit dem Eisernen Kreuz, aber zugleich schwer gezeichnet. Deutschland hat den Krieg verloren, Moritz ein Bein und einen Lungenflügel. Doch die Verlobung hält. Ein Jahr nach Kriegsende heiraten Moritz und Else und lassen sich in Borken nieder. Moritz ist da bereits 33, Else 27 Jahre alt. Sechs Jahre haben sie aufeinander gewartet. Nun geht alles ganz schnell. Innerhalb kurzer Zeit werden ihre Söhne Karl, Manfred und Theo geboren. Zwischendrin gründen sie gemeinsam die Firma M. & E. Gans – En Gros Export. Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Situation nach dem Ersten Weltkrieg florieren die Geschäfte. Moritz und Else vertreiben Textilien und Schneidereibedarf in ganz Europa.
Nur ein paar 100 Meter vom Stadtzentrum entfernt, an der Bocholter Straße, kaufen Moritz und Else Mitte der zwanziger Jahre eine stattliche Villa. Zwei Säulen rahmen den Eingang, ein großer Balkon thront über einem üppigen Vorgarten. Familie Gans beschäftigt eine Haushaltskraft und einen Gärtner, und da Moritz nur ein Bein hat, stellt er auch einen Chauffeur ein, denn unter der Woche ist er auf Geschäftsreisen im In- und Ausland unterwegs. Zum Schabbat ist er aber stets zurück in Borken. Moritz Gans ist jüdisch-orthodox aufgewachsen. Ihm sind die religiösen Gebote wichtig. Im Hause Gans wird koscher gespeist und am Schabbat geruht. Aus Liebe zu ihrem Mann passt Else sich dem orthodoxen Lebensstil an, obwohl sie eigentlich aus einer jüdisch-säkularen Familie stammt.
© United States Holocaust Memorial Museum, Washington, DC sowie Daniel Gans und Aviva Gans-Rosenberg
Else Gans posiert im Garten, Borken 1931
Else wuchs in Völksen bei Hannover auf. Als junges Mädchen schickten die Eltern sie nach Brüssel auf ein Mädchenpensionat. Sie schwärmt für Musik. In den Briefen an ihre beiden Schwestern schreibt sie seitenweise und begeistert über die Aufführung einer Wagner-Oper oder von neuen Aufnahmen einer Mozart-Sonate. Else tritt weltgewandt, modern und locker auf. Im Sommer läuft sie gerne in Bademode durch den Garten, was nicht nur von den katholischen Nachbarn, sondern auch innerhalb der jüdischen Gemeinde kritisch beäugt wird. Für die Zeit ebenfalls eher ungewöhnlich ist, dass Else nicht bloß auf dem Briefbogen der Firma Gans steht, sondern als vollwertige Partnerin im Unternehmen agiert. Während ihr Mann durchs Land reist, übernimmt sie die Planungen im Büro und zieht nebenbei die Kinder groß, durchaus mit preußischer Strenge, aber auch mit viel Wärme.
Moritz Gans ist nicht nur ein erfolgreicher Geschäftsmann, sondern auch ein engagierter Bürger der Stadt. Er übernimmt den Vorsitz des Verbands der Kriegsopfer im Kreis Borken. Wenn einem Kriegsgeschädigten seine Versehrtenrente gekürzt werden soll, greift er entschieden ein. Er nutzt für diese Anliegen nicht selten auch das Personal seines Firmenbüros und interveniert häufig erfolgreich. Sein Einsatz verschafft ihm Ansehen unter den Mitbürgern, und so wird Moritz 1929 für die SPD in den Rat der Stadt gewählt. Er ist damit der erste jüdische Stadtverordnete in Borken und einer von nur zwei Abgeordneten der SPD überhaupt.
Auch wenn (oder gerade weil) Moritz selbst vier Jahre an der Front gekämpft hat, entwickelt er sich im Laufe der zwanziger Jahre zu einem entschiedenen Kriegsgegner. Politisch hat er mit dem Militarismus und Nationalismus des Kaiserreichs längst gebrochen. Während viele Menschen in Deutschland zu Beginn der zwanziger Jahre noch vom Trauma des Ersten Weltkriegs und den politischen Umwälzungen der jungen Republik verunsichert sind, ist das Ehepaar Gans in Aufbruchstimmung.
Der Terminkalender von Moritz Gans kennt während dieser Zeit kaum noch Lücken. Neben seinem stetig wachsenden Betrieb und seinem politischen Engagement ist er – wie sollte es anders sein – auch in der jüdischen Gemeinde aktiv und wird ihr stellvertretender Vorsitzender. Die Gemeinde zählt gut 100 Mitglieder und verfügt über eine Synagoge und eine kleine jüdische Schule. Manfred und seine Brüder lernen dort rechnen und schreiben, ebenso Hebräisch, jüdische Gesänge und die Schriften der Tora. Nach der vierten Klasse wechseln sie dann auf das katholische Gymnasium. Nachmittags besuchen sie trotzdem weiterhin den Unterricht von Bezabel Jehuda Locker, einem universal gebildeten und zionistisch orientierten Lehrer, den die Gemeinde extra aus Polen nach Borken geholt hat. Wie bei den meisten jüdischen Familien in Borken genießt die Bildung auch im Hause Gans einen besonderen Stellenwert; mindestens ebenso wichtig ist der Familiensinn.
Karl, Manfred und Theo wachsen in einer behüteten Umgebung auf, eingebettet in eine große Familie. Mehr als 20 Familienmitglieder leben in Borken und viele weitere in den nahe gelegenen Niederlanden. Der Zusammenhalt und die Wärme der Großfamilie zeigen sich besonders am Geburtstag von Oma Amalie, der auf den Silvesterabend fällt. Jahr für Jahr nehmen an diesem Tag alle Familienmitglieder Urlaub und kommen in Borken zusammen: Amalies zehn Kinder, zweiundzwanzig Enkelsöhne und zwei Enkeltöchter.
© United States Holocaust Memorial Museum, Washington, DC sowie das Manfred Gans Estate
Moritz und Manfred Gans im Garten, Borken circa 1938
Ein Fotoalbum aus dieser Zeit dokumentiert den Alltag von Manfred und seinen Brüdern und ist gespickt mit kleinen ironischen Kommentaren. »Deutschland erwache« steht unter dem ersten Bild im Album, auf dem man die drei Jungs noch etwas verschlafen, aber bereits mit neugierigen Blicken nach dem Aufstehen sieht. Es ist dieselbe Parole, die zu dieser Zeit auf unzählige Standarten der SA und NSDAP gestickt ist.
Zum Frühstück gibt es eine Schale Haferbrei, dann geht es in die Schule. Karl trägt schon stolz die Schülermütze der höheren Schule, Manfred und Theo ziehen mit einfacher Filzmütze »in den Kampf« – so die Bildunterschrift. Mittags essen sie auf der großzügigen Terrasse, für die Hausaufgaben verteilen sie sich im geräumigen Bücherzimmer. Dann geht es »Auf zum D.J.K.«: Im katholischen Sportverein der Stadt spielen die drei Fußball.
© United States Holocaust Memorial Museum, Washington, DC sowie das Manfred Gans Estate
Theo, Manfred und Karl nach dem Aufstehen, Borken 1931
Noch erleben Manfred und seine Brüder nur vereinzelt Antisemitismus. Zwar besuchen sie nicht-jüdische Freunde selten zu Hause, um nicht versehentlich den Speisegeboten der Tora untreu zu werden, aber das Freizeitleben findet ohnehin eher auf der Straße statt. Den Abend verbringen die Brüder mit Büchern oder, noch lieber, am Radio. Gut geputzt stehen da bereits die Schuhe vor der Tür für den neuen Tag bereit.
Das katholische Borken steht den aufstrebenden Nationalsozialisten Anfang der dreißiger Jahre skeptisch gegenüber. Die Zentrumspartei behauptet in der Stadt während der Weimarer Republik stets die Mehrheit und behält diese auch noch, als die NSDAP in anderen Regionen schon die Oberhand gewinnt. Von außen betrachtet ist die jüdische Gemeinde Borkens mit ihrer Synagoge im Ortskern voll integriert. Jedenfalls lassen die Vertreter der Stadt und der Kirche kaum eine Gelegenheit aus, die gute Gemeinschaft mit den jüdischen Bürgern zu betonen. Mit der Machtübernahme Hitlers im Januar 1933 ändert sich die Situation allerdings schlagartig – auch in Borken.