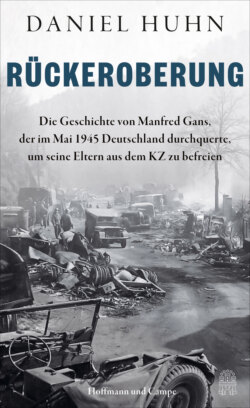Читать книгу Rückeroberung - Daniel Huhn - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Zeitenwende
ОглавлениеDer 30. Januar 1933 ist ein nasskalter Tag in Borken. Else sitzt mit ihren drei Kindern am Mittagstisch, das Radio läuft im Hintergrund. Plötzlich unterbricht der Nachrichtensprecher das laufende Programm. Der Ansager verkündet, dass ihm gerade eine Nachricht hereingereicht worden sei: Reichspräsident Hindenburg habe Adolf Hitler zum Reichskanzler berufen. Für Familie Gans wie für viele Millionen Menschen im Land kommt die Nachricht nicht völlig überraschend. Dennoch ist Else wie versteinert. Manfred, damals zehn Jahre alt, versteht ihre plötzliche Untergangsstimmung noch nicht. Als er in den folgenden Tagen in der Schule jedoch erlebt, welchen Jubel die Ernennung Hitlers unter einigen seiner Klassenkameraden auslöst, ahnt er, dass ihm eine schwere Zeit bevorsteht. Einen ersten Eindruck davon bekommt er schon wenige Wochen später.
Nach wochenlangen Vorbereitungen schwärmen am 1. April 1933 um Punkt zehn Uhr im ganzen Land junge Männer der Sturmabteilung (SA) aus und positionieren sich und ihre Kampfparolen vor jüdischen Geschäften, Kanzleien und Arztpraxen: »Deutsche! Wehrt Euch! Kauft nicht bei Juden!« steht auf ihren Schildern. Auch wenn der Einkauf in den jüdischen Geschäften (noch) nicht verboten ist, versuchen die Nationalsozialisten durch sozialen Druck den Betrieb der jüdischen Geschäfte zu stören. Die Uniformierten mahnen, beschimpfen und bedrohen Kunden, die ihrem Aufruf nicht folgen wollen.
Schon im Kaiserreich und auch noch während der Weimarer Republik ließen Polizei und Justiz antisemitische Hetzer oft tatenlos gewähren. Nun aber sind die Aktionen vom Staat verordnet.
Die Presse in Großbritannien und den USA hat bereits seit der Machtübernahme Hitlers die Maßnahmen der Nationalsozialisten aufmerksam und kritisch verfolgt. Erste Stimmen, die den Deutschen mit Handelsboykotten drohen, wurden schon kurz nach der Machtübernahme laut. Hitler ist wütend und macht eine Verschwörung des internationalen Judentums dafür verantwortlich. Seine Vergeltung lässt nicht lange auf sich warten und mündet dann in jenen sogenannten Reichsboykotttag am 1. April 1933.
In Borken positionieren sich vor dem Kaufhaus der jüdischen Familie Heymans die Braunhemden der SA. Manfred ist an diesem Tag in der Schule. Obwohl er und seine Brüder orthodox leben, müssen sie auch am Samstag zum Unterricht. Ihre Bücher bringen sie schon am Vortag zur Schule, da sie am Schabbat selbst nichts tragen wollen. Ihre Lehrer gestehen ihnen sogar zu, dass sie am Schabbat nicht schreiben müssen. An diesem Tag aber kommt es anders. Um kurz nach elf Uhr steht plötzlich Manfreds Klassenlehrer Heinrich Tinnefeld in der Tür und bittet ihn und die drei weiteren jüdischen Mitschüler, kurz auf den Flur zu kommen. Dort verkündet er ihnen, dass sie die Schule unverzüglich verlassen sollen, da er nicht für ihre Sicherheit garantieren könne. Also gehen Manfred, seine Brüder und die anderen jüdischen Mitschüler nach Hause, wo sie auf verblüffte Eltern treffen. Die Nachricht, dass man die Sicherheit der Schüler in der eigenen Schule nicht mehr gewähren könne, macht Manfreds Vater wütend. Er lässt seine guten Beziehungen spielen und ringt dem Schulleiter das Versprechen ab, dass die jüdischen Schüler zukünftig ohne Bedenken am Unterricht teilnehmen können. Manfred, Karl und Theo besuchen also wieder die Schule, wo sie nun jedoch endgültig zu Außenseitern geworden sind. Die drei Brüder und die verbliebenen sechs jüdischen Mitschüler fassen daher einen Entschluss: Fortan wollen sie sich konsequent von den nicht-jüdischen Schülern auf dem Schulhof fernhalten. Sie finden, dass die selbstbestimmte Abgrenzung leichter zu ertragen ist, als wenn sie bloß abwarten, bis die anderen Schüler sie ausgrenzen oder die Schule die Segregation gar anordnet.
Einen Monat später, am 1. Mai, organisiert der Ortsverband der NSDAP einen Aufmarsch in der Stadt. Während die Borkener katholischen Verbände den Nationalsozialisten noch zu Jahresbeginn voller Misstrauen gegenüberstanden, sind sie nun eifrig bemüht, im Zirkus der NSDAP mitzuspielen. So marschiert die katholische Jugend am »Tag der nationalen Arbeit« einträchtig neben der Borkener Hitler-Jugend. Manfred beobachtet die Parade vom Straßenrand aus. Plötzlich erkennt er inmitten der Menge ein bekanntes Gesicht: Sein Biologielehrer Peter Dahmen, den er eigentlich mag, trägt nun auch das Abzeichen der Partei.
Der Schulalltag im Nationalsozialismus wandelt sich nicht plötzlich, jedoch stetig. Im Deutschunterricht werden unliebsame Autoren aus dem Lehrplan gestrichen. Das Fach »Leibeserziehung« steht nun fast täglich auf dem Stundenplan und wandelt sich für die älteren Schüler zu einer vormilitärischen Ausbildung. Im Geschichtsunterricht wird den Schülern Ehrfurcht vor den Helden der deutschen Vergangenheit eingebläut und zugleich der deutsche Führungsanspruch in der Welt. Den wohl größten Umbruch erfährt das Fach Biologie, in dessen Mittelpunkt die sogenannte Rassenkunde rückt. Bereits in Mein Kampf proklamierte Hitler: »Es soll kein Knabe und kein Mädchen die Schule verlassen, ohne zur letzten Erkenntnis über die Notwendigkeit und das Wesen der Blutreinheit geführt worden zu sein.« In Borken übernimmt diese Aufgabe Biologielehrer Dahmen, der von nun an den Rassenkundeunterricht leitet. Gemäß Lehrplan vermittelt er die vermeintlich körperliche und seelische Überlegenheit der »nordischen Rasse« gegenüber anderen Volksgruppen, vor allem gegenüber den Juden. Manfreds Bruder Karl ist der Erste, der sich dieser Unterweisung aussetzen muss. Mit der zweibändigen Ausgabe Soziologie der Juden von Arthur Ruppin unter dem Arm zieht Karl in den Unterricht. Lehrer Dahmen trägt vor, warum Juden übermäßig oft verbrecherisch seien und sich kaum sozial engagieren würden. Zu jeder Behauptung, die sein Lehrer in den Raum wirft, liefert Karl Gegenargumente. Die Mitschüler genießen das Spektakel; wohl weniger, weil sie Karl solidarisch zur Seite stehen, sondern weil sie der offene Schlagabtausch zwischen Schüler und Lehrer, zwischen David und Goliath, amüsiert. Als für Manfred zwei Jahre später der Rassenkundeunterricht ansteht, tut er es seinem Bruder gleich. Dr. Dahmen kommt erneut auf die Judenfrage zu sprechen. Er will seinen Schülern weismachen, die Juden hätten eine Veranlagung zum »Handelsmann«, und wieder freuen sich die Mitschüler über den Schlagabtausch, allerdings ohne für Manfred Partei zu ergreifen. In seinem Notizbuch resümiert Manfred die Stunde: »Zum Schluss glauben wir uns gegenseitig nichts mehr. Die Klasse macht Risches – außer den Anständigen.« Risches ist das jiddische Wort für Antisemitismus.
Einige Lehrer im Kollegium stehen den jüdischen Schülern jedoch so gut es geht zur Seite. Als Manfreds Cousin Karl-Heinz Gans als letzter jüdischer Schüler 1934 sein Abitur ablegt, erlaubt sich der Pfarrer und Studienrat Dr. Engelbert Niebecker gar eine Spitze. Er lässt den Abiturienten in der mündlichen Hebräischprüfung einen Absatz aus dem Alten Testament übersetzen. Dieser endet mit dem Satz: »Die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr.« Den zwei uniformierten Nationalsozialisten im Prüfungsgremium, wohl eher ideologisch überzeugt als biblisch gebildet, bleibt der kleine Seitenhieb verborgen. Karl-Heinz Gans aber bekommt ein »Sehr gut« für die Prüfung und erinnert sich noch mehr als ein halbes Jahrhundert später an diesen kleinen Triumph.
Es ist jedoch unübersehbar, dass das NS-Regime seine Präsenz in den Schulen mit jedem Monat verstärkt. Bald schon hängen Hakenkreuzfahnen vor dem Gebäude und Porträts von Adolf Hitler in den Klassenzimmern. Schulfeiern werden nun mit dem Deutschlandlied und dem Horst-Wessel-Lied beschlossen. Um diese Schmach nicht über sich ergehen lassen zu müssen, haut Manfred vorher meist heimlich ab. Anfang 1937 verkündet Rektor Dr. Alex Hermandung stolz, dass vor dem Schulgebäude demnächst auch die Fahne der Hitler-Jugend wehen werde. Dies war keine Selbstverständlichkeit, sondern eine Auszeichnung für die Schulen, die nachweisen konnten, dass mehr als 90 Prozent der Schülerschaft der Hitler-Jugend beigetreten waren; eine Quote, die das Borkener Gymnasium kurz zuvor erreicht hatte. Verglichen mit anderen Schulen war das eher spät.
© United States Holocaust Memorial Museum, Washington, DC sowie das Manfred Gans Estate
Manfred mit Schulmütze, Borken circa 1935
Manfred ist mittlerweile einer von drei verbliebenen jüdischen Schülern. Der Schulalltag wird für ihn immer unerträglicher. Einer der Lehrer nimmt die jüdischen Schüler im Unterricht gar nicht mehr dran, ein anderer gibt ihnen durchgehend die schlechtesten Noten – aus Prinzip.
Die Lokalzeitung ist da bereits längst gleichgeschaltet und preist die Schmähungen gegen Juden als Wohltaten. Lediglich die Presse aus den nahe gelegenen Niederlanden beobachtet die Entwicklung mit Sorge und berichtet regelmäßig über den Sittenverfall im Nachbarland, etwa als im Mai 1935 SA-Männer am Schabbat die Tür zur Synagoge im Borkener Ortsteil Gemen aufstoßen und die Gemeindemitglieder mitten im Gebet beschimpfen, bespucken und mit Steinen bewerfen. Kurze Zeit später besiegeln die Nürnberger Gesetze die weitgehende Entrechtung der Juden. Die letzten Hemmungen fallen. Wer es weiterhin wagt, in einem jüdischen Geschäft einzukaufen, muss befürchten, kurze Zeit später am sogenannten Stürmer-Kasten bloßgestellt zu werden – so heißt der Aushang der antisemitischen Propagandazeitung Der Stürmer, die am Marktplatz im Ortszentrum von Borken ausgestellt ist.
Aufgrund der immer weitreichenderen wirtschaftlichen Einschränkungen müssen Moritz und Else Gans ihre Büroräume im Stadtzentrum aufgeben. Ihren Betrieb führen sie so gut es geht von zu Hause weiter. Es ist noch nicht lange her, da gehörten sie zu den wohlhabendsten Borkener Familien, nun ist ihnen die Grundlage jeder wirtschaftlichen Existenz genommen. Es wird immer klarer, dass nur die Auswanderung einen Ausweg bieten könne. Bereits 1934 hatte Moritz auch im niederländischen Utrecht ein Unternehmen aufgebaut. Nun nutzt er seinen Firmensitz dort sowie viele weitere geschäftliche Kontakte im Ausland, um Bekannte bei der Ausreise zu unterstützen. Zusammen mit seinem Schwager Alexander Moch beobachtet er die Situation aufmerksam. Gemeinsam loten die beiden verschiedene Fluchtoptionen aus. So reisen sie 1935 zusammen nach Palästina, um sich ein eigenes Bild von den jüdischen Siedlungen dort zu machen. Mit guten Neuigkeiten kehren sie zurück. Henny, Elses Schwester, war bereits kurz nach Hitlers Machtübernahme emigriert. Mit ihrem Mann hat sie sich inzwischen ein gutes Leben in Tel Aviv aufgebaut. Sie ist bereit, eines der Gans-Kinder aufzunehmen. Doch noch wollen Moritz und Else abwarten, denn je älter die Jungs, desto leichter wäre es, sie ziehen zu lassen. Nur ein Jahr später ist es dann aber so weit. Als Erster im Hause Gans ist Manfreds älterer Bruder Karl an der Reihe. Sein Vater begleitet ihn den weiten Weg bis nach Triest. Wenige Tage nach seinem 16. Geburtstag betritt Karl dort ein Schiff, das ihn nach Palästina bringt. Noch an Bord beschließt er, seinen jüdisch-orthodoxen Glauben und seinen deutschen Namen abzulegen. Weder mit dem Land, aus dem er stammt, noch mit den vielen religiösen Konventionen, die sein Leben bisher prägten, will er fortan zu tun haben. Beides empfand Karl schon länger bloß als eng und lästig. Unter dem Namen Gershon Kaddar immatrikuliert er sich auf der Mikwe Israel, einer führenden Landwirtschaftsschule. Unterkunft findet er bei seiner Tante Henny in Tel Aviv.
Wie es in Borken weitergeht, erfährt Gershon (für die Familie weiterhin Karl) aus den Briefen seines jüngeren Bruders Manfred. Dem gelingt es, sich trotz all der Einschränkungen und Ausgrenzungen einen abwechslungsreichen Alltag zu gestalten, auch weil die Familie noch einige finanzielle Rücklagen hat. Er erkundet mit dem Fahrrad die umliegenden Dörfer, baut aufwendig konstruierte Modellflugzeuge und unternimmt sogar kurze Reisen. Mit seinen Cousins fährt er für eine Woche nach Hamburg – mit vollem Programm. Regelmäßig geht er ins Kino und verpasst kaum einen Kassenschlager der boomenden Filmbranche. Er verschlingt die Bücher von Karl May, liest aber auch eifrig Romane und politische Literatur von Autoren, die längst verboten sind. Manfred musiziert und fotografiert. Vor allem aber organisiert er sich in einer Gruppe jüdischer Jugendlicher, die hitzig über kulturelle und politische Themen diskutiert. Alles dreht sich um die zentralen Fragen: Wie lange können sie noch bleiben, und wo werden sie eine Zuflucht und ihre Zukunft finden? Mit seinen Eltern beratschlagt Manfred verschiedene Optionen: Soll er seinem Bruder schon bald nach Palästina folgen? Oder sich zunächst in Deutschland auf die Auswanderung vorbereiten und eine der vielen jüngst aufgebauten jüdischen Landwirtschaftsschulen besuchen? Soll er sich lieber in den vermeintlich geschützten Raum eines jüdischen Internats begeben? Oder wäre es doch die bessere Option, Verwandten und Bekannten der Eltern nach England oder in die USA zu folgen?
Während im Hintergrund auf Hochtouren Auswanderungspläne geschmiedet werden, läuft der Alltag weiter. Im April 1938 muss Moritz Gans in der Borkener Zeitung lesen, dass er seinen verbliebenen Besitz fortan dem Finanzamt melden muss und dieses sich vorbehält, sein Vermögen »im Interesse der deutschen Wirtschaft« zu beschlagnahmen. Moritz, den zu dieser Zeit keine antijüdische Maßnahme mehr überraschen kann, ist weitsichtig genug gewesen, einen Teil seines Geldes noch rechtzeitig über die Grenze zu bringen. Ihren Geschäftsbetrieb in Borken müssen die Eheleute Gans aber bald einstellen. Fortan leben sie vom Ersparten.
Dennoch wird in dieser sorgenvollen Zeit noch einmal groß gefeiert. Im Mai 1938 ist das Haus der Familie Gans voller Menschen. Moritz und Else laden zur Bar-Mizwa ihres jüngsten Sohns Theo ein. Die lange Kaffeetafel reicht über drei Räume. Am stilvoll eingedeckten Tisch sitzen dicht beieinander knapp 30 Gäste. Frischer Spargel mit Zunge und Pökelbrust wird gereicht, dazu »Salat Modern«. Es wird der letzte Anlass sein, zu dem die Großfamilie zusammenkommt – und die letzte Bar-Mizwa, die in Borken begangen wird.
Obwohl fast alle in der Stadt Manfred, Theo und ihre Cousins kennen, will spätestens ab 1938 niemand mehr mit ihnen gesehen werden oder gar mit ihnen sprechen. Die Stimmung wird immer feindseliger. Einmal wird Manfred auf offener Straße schwer angerempelt. Ein anderes Mal bekommt er beim Boxtraining gewaltig Haue, weil er Jude ist. Welche Erlösung muss in dieser Situation wohl der Besuch von Familie Lamm gewesen sein, die sich für den Sommer angekündigt hat.