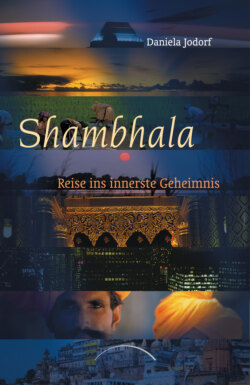Читать книгу Shambhala - Daniela Jodorf - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7
Оглавление__________________________________________________
Im Büro fertigte ich eine Abschrift des Interviews mit Elly Montgomery an. Rondorf kam eine Stunde später. Er sah aus, als hätte er die Nacht durchgezecht. Seine Augen waren rot geädert, er war unrasiert, und eine widerliche Alkoholfahne wehte ihm voraus. Breitbeinig wankte er zu seinem Schreibtisch. Ich kochte Kaffee – so stark, dass der Löffel darin stehen blieb. Rondorf schüttete ihn kochend heiß in sich hinein und fragte: „Wie war das Interview mit der Gattin des Botschafters?“ Immerhin konnte er sich an meine gestrige Aufgabe erinnern.
„Die Abschrift liegt vor Ihnen.“
Er nahm das Papier zur Hand und las mit zusammengekniffenen Augen. Dann brach er in schallendes Gelächter aus: „Das ist ja ein idealistischer Blödsinn, den Sie da mit der lieben Elly Montgomery verzapft haben. Mir war klar, dass Sie noch ziemlich grün hinter den Ohren sind, aber das hier schlägt dem Fass den Boden aus.“
Ich spürte einen Kloß im Hals. War es Verletztheit, Angst oder Wut?
„Die Suche der indischen Frau nach einer eigenen Identität…“ Rondorf schwieg einen Moment lang bedrohlich. Dann fing er an zu schreien, während ich mich ängstlich auf meinem Stuhl zusammenkauerte.
„Soll ich Ihnen mal was sagen? Hier geht es nicht um Identität, um eitel Sonnenschein und große Ideale. Hier geht es um Macht! Die Frauen wollen die Macht der Männer. Das ist das Problem. Punkt. Wachen Sie endlich auf, Frau Von und Zu. Das, was Sie hier treiben, ist kein Journalismus, sondern Gefühlsduselei.“
Ich sagte kein Wort, aber in mir schrie es: „Ratte, mieses Schwein, Säufer“ und Schlimmeres. Krampfhaft biss ich mir auf die Lippen. Warum war ich nur so feige und sagte ihm nicht die Meinung? Doch was hätte ein offenes Wort genützt? Rondorf hatte sein vernichtendes Urteil über mich längst gefällt. Es war reine Energieverschwendung, ihn vom Gegenteil überzeugen zu wollen. Vielleicht hatte er ja sogar Recht und ich war wirklich idealistisch und naiv. In Rondorfs Gegenwart kannte ich mich selbst nicht wieder. Ich fand mich schwach und hasste mich für meine Schwäche. Und dennoch forderte mich eine leise innere Stimme auf zu kämpfen. Ich durfte nicht klein beigeben. Ich musste herausfinden, ob Rondorfs Urteil gerechtfertigt war. War ich eine naive Traumtänzerin? Oder war Rondorf ein gescheiterter Pessimist? Ich hing am Trapez und unter mir war kein Netz. Das war meine Prüfung.
Rondorf warf mir das Interview herüber. Es fiel neben meinem Schreibtisch zu Boden. „Das können wir so auf keinen Fall gebrauchen. Sehen Sie zu, was Sie daraus machen können. Wenn Sie nicht bald anfangen, der Realität ins Auge zu sehen, haben Sie hier in Indien keine Chance!!“
Der Satz stand bedrohlich im Raum. Realität! Welcher Realität? Rondorfs Realität oder meiner? Gab es vielleicht noch eine dritte Realität, die weit realer war, als diese beiden?
„Ich gehe jetzt nach Hause und ruhe mich aus. Wenn ich zurückkomme, will ich etwas Anständiges sehen.“
Als Rondorf die Tür hinter sich zugeschlagen hatte, brach ich in Tränen aus. Noch nie zuvor hatte ein Mensch derart vernichtende Kritik an mir geübt. Aber es war nicht damit getan, Rondorf als Rüpel abzustempeln und ihm die Schuld für mein Leid zu geben. Irgendwie glaubte ich, meine Misere selbst verschuldet zu haben. Ich hatte mir eine Herausforderung gewünscht. Hier war sie. Einen Moment lang überlegte ich, ob ich das Interview mit Elly Montgomery überarbeiten sollte. Ich tat es nicht. Das Gespräch war so verlaufen, wie ich es beschrieben hatte.
Meine Wut entlud sich wieder einmal in einem Anfall von Putzwut. Ich räumte das Chaos auf, das Rondorf hinterlassen hatte: die Flaschen in den Müll und die Papiere in die Aktenordner. Als ich einige Papiere in den Ordner mit der Aufschrift „Verschiedenes“ heftete, fiel eine graue Mappe heraus, die letzte Woche ganz bestimmt noch nicht hier gewesen war. Ich besah sie mir von allen Seiten. Auf dem Deckel stand in ungelenker Handschrift „Frauenrechte“. Warum hatte Rondorf den Inhalt nicht zu den anderen Papieren mit dem Thema gepackt? Ich fühlte mich wie eine Verräterin, als ich die Mappe öffnete. Auf der Innenseite des abgegriffenen Deckels klebte ein Zettel mit einer Buchstaben-Zahlenkombination: „Lf 202“.
„Wenn Rondorf jetzt zurückkommt, bringt er mich um“, dachte ich. Doch meine Neugier war stärker als meine Angst. Die Mappe enthielt eine Menge unzusammenhängender Notizen: Adressen von verschiedenen indischen Bibliotheken, die Adresse der Theosophischen Gesellschaft und den Namen eines Geschichtsprofessors aus Mumbai: Ananda Kapoor. Außerdem fand ich die Kopie einer Karte oder eines Lageplans mit der Aufschrift NORBULINGKA. Der Name kam mir irgendwie bekannt vor. Aber woher? Mit Frauenrechten hatte das alles jedenfalls bestimmt nichts zu tun. Viel eher war es ein klarer Beweis dafür, dass Rondorf etwas vor mir verheimlichte und dass seine Einschüchterungsversuche das Ziel hatten, mich abzulenken. Ich legte die Mappe zurück in den Ordner, aus dem sie gefallen war, und stellte ihn wieder ins Regal. Was hatte das zu bedeuten? Adressen von Bibliotheken des ganzen Landes, die Theosophische Gesellschaft, der Name Norbulingka. Interessierte sich Rondorf plötzlich für religiöse Themen? Das kam mir noch unwahrscheinlicher vor als seine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Frauenthema. Dunkel erinnerte ich mich, dass er vor etwa zwei Jahren über Professor Kapoor berichtet hatte. Hatte dieser Artikel nicht einen ganz anderen Tenor gehabt als das, was Rondorf sonst schrieb?
Ich verließ das Büro, damit ich Rondorf an diesem Tag nicht noch einmal begegnen musste. Zu Hause hängte ich mich umgehend ans Telefon und rief Philipp in der Berliner Redaktion an. „Was hast du herausgefunden, Phil?“
„Also, Caro, ich habe ein bisschen mit Frau Wittich geflirtet und sie hat mir die aktuelle Liste der zur Zeit in Arbeit befindlichen Auslandsberichte gezeigt. Rate mal, was bei Rondorf vermerkt war.“
„Was?“ Ich schrie fast in den Hörer.
„N.N.“
„Das glaube ich nicht.“
„Ich habe anschließend sofort mit Bernd gesprochen. Er war bei der letzten Redaktionssitzung dabei. Rondorf wollte das nächste Thema erst nach eingehender Recherche benennen und hat um eine Bearbeitungszeit von mehreren Monaten gebeten. Er hat angeblich sehr geheimnisvoll getan und man hatte den Eindruck, als wolle er sich mit einem Knüllerthema einen tollen Abgang verschaffen.“
Das erklärte die Besessenheit, mit der Rondorf bei der Sache war.
„Was für ein Knüllerthema, Philipp? Doch wohl kaum ‚Die Rechte der indischen Frau und ihre sich wandelnde Rolle in der Gesellschaft‘?“
„Ich sagte es ja schon: Bezüglich des Themas hüllt sich Rondorf in Schweigen.“
„Sagt dir der Name Norbulingka etwas?“, fragte ich Philipp.
„Kommt mir bekannt vor, mehr aber auch nicht.“
„Was ist mit Ananda Kapoor, Professor für Geschichte an der Universität Mumbai? Erinnerst du dich, dass Rondorf vor ungefähr zwei Jahr über ihn und seine Forschungen berichtet hat? Könntest du mir den Artikel aus dem Archiv besorgen und per Kurier nach Delhi schicken?“
„Gern. Ich glaube, es ging in dem Artikel um den roten Faden in der Evolution der Menschheit und einige mystische Verknüpfungen. Das Thema passte nicht zu Rondorf, und die Art, wie er es behandelte, auch nicht. Ich war versucht zu glauben, dass er seinen journalistischen Stil ändern wollte. Aber die folgenden Artikel trugen wieder seine alte Handschrift: nüchtern, sachlich, ein wenig zynisch.“
In meinem Hirn arbeitete es fieberhaft. „Was sagt dir der Begriff Theosophische Gesellschaft?“
„Nichts.“
„Phil, pass bitte auf, dass keiner mitkriegt, was wir mit Rondorf vorhaben. Rondorf ist ein unberechenbarer Choleriker.“
Phil versprach, Vorsicht walten zu lassen und mir den Artikel noch heute zuzuschicken. In der Zwischenzeit konnte ich mich ja mit den Informationen beschäftigen, die ich bereits hatte, zum Beispiel mit dem Namen „Norbulingka“. War das ein Ort? Ein Bauwerk? Die Zeichnung legte so etwas nahe. Ich hätte sie mir kopieren sollen. Plötzlich kam mir eine Idee. Ich kramte meinen Indien-Reiseführer aus dem Regal und suchte im Inhaltsverzeichnis. N, No, Nor,… Unglaublich, da war es! Norbulingka, Seite 273. Ich las: „Das Norbulingka-Institut liegt etwa 14 km von Mc Leod Ganj und 4 km von Dharamsala, der buddhistischen Enklave der Exiltibeter in Indien, entfernt. Es ist ein Nachbau des einstigen Sommerpalastes des Dalai Lama, des religiösen und politischen Oberhaupts der Tibeter. Der ursprüngliche Palast in Lhasa wurde im Jahre 1754 vom 7. Dalai Lama erbaut und beherbergte ein blühendes Zentrum tibetischer Kunst und tibetischen Wissens sowie zahlreiche Tempel und Klöster. Um das alte Wissen auch nach der Annektierung Tibets durch die Chinesen zu erhalten und zu verbreiten, bauten die Exiltibeter unter der Führung des 14. Dalai Lama eine exakte Kopie des Sommerpalastes. Der Grundriss der Palastanlage ist der Gestalt eines Buddha nachempfunden. Sie liegt in einem herrlichen, nach japanischem Vorbild angelegten Garten und beherbergt Tempel, Klöster und eine Bibliothek.“
Erst am nächsten Tag wagte ich mich wieder in die Höhle des Löwen. Mein Kampfgeist war erwacht und ich hatte beschlossen, Rondorfs Einschüchterungsversuche als das zu werten, was sie waren: Manöver zur Ablenkung der lästigen Kollegin. Trotz meiner guten Vorsätze schlug mir die beklemmende Stimmung im Büro aufs Gemüt. Rondorf sagte kein Wort zu der Tatsache, dass ich das Interview nicht überarbeitet hatte, und hüllte sich auch sonst in missbilligendes Schweigen. Erst gegen Mittag kam er auf mich zu: „Frau von Teubner, …“
Er kannte meinen Namen also doch.
„…für den Rest der Woche brauche ich Sie nicht mehr. Ich habe Ihnen eine Liste mit Interviewpartnern zusammengestellt, die Sie abklappern können. Es reicht, wenn Sie am Montagnachmittag wieder hier sind.“
Heute war Donnerstag. Rondorf gab mir zwei volle Tage frei?
Ich warf einen Blick auf die Liste. Bis auf zwei neu hinzugefügte Adressen waren es dieselben Institutionen, mit denen ich bereits Termine gemacht hatte. Ich stellte mich dumm und fragte: „Aber Herr Rondorf, waren Sie denn dort nicht schon?“
Unwirsch kam die Antwort: „Das habe ich nicht geschafft. Ich habe Ihnen neue Termine gemacht.“
Widerstandslos nahm ich meine Aufgabe entgegen. Die Aussicht auf vier Tage ohne Rondorf war einfach zu verlockend. Im Auto kam mir die rettende Idee. Ich würde mein eigenes Spiel eröffnen, bei dem Rondorf nach meinen Regeln spielen musste. Den Eröffnungszug hatte ich klar und deutlich vor Augen. Rondorf wollte, dass ich einem Artikel über die sich wandelnde Rolle der indischen Frau schrieb. Und genau das würde ich tun – aber auf meine Art.
Am frühen Nachmittag rief ich wieder in Berlin an, diesmal nicht bei Philipp, sondern bei Aurich persönlich.
„Frau von Teubner. Wie geht es Ihnen in Indien?“
„Hervorragend!“, log ich.
„Was kann ich für Sie tun?“
„Ich brauche Ihr Einverständnis für einen Bericht, den ich gern selbständig schreiben würde. Ich bin seit meiner Ankunft immer wieder auf ein Thema gestoßen, das einen ausführlichen Bericht wert ist. Ich bin nicht sicher, inwieweit Sie davon ausgehen, dass Rondorf und ich gemeinsam arbeiten, solange er noch im Dienst ist. Jedenfalls wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir für dieses Thema freie Hand ließen.“
„Haben Sie Kompetenzstreitigkeiten mit dem lieben Rondorf? Er ist für seine Dominanz bekannt. Deshalb arbeitet er schon seit Jahren allein. Er ist nicht Ihr Vorgesetzter, das wissen Sie! Es steht Ihnen frei, Ihre Themen selbständig zu wählen und zu bearbeiten. Sie sollen sich in Indien lediglich so weit etablieren, dass Sie eigenständig arbeiten können, wenn Rondorf eines Tages die Feder fallen lässt.“
Das war es, was ich hören wollte.
„Leider sind eindeutige Arbeitsplatzbeschreibungen unter den gegebenen Umständen nicht viel wert. Ich möchte das Problem auf meine Weise lösen, aber dazu brauche ich Ihr Okay.“
„Das haben Sie. Ich muss den Artikel natürlich auf der nächsten Redaktionssitzung noch vorstellen. Wie lange werden Sie dafür brauchen?“
„Zwei Wochen.“
„Ich stehe hinter Ihnen.“
„Danke, Herr Aurich!“
„Viel Erfolg.“
Damit war der erste Schritt getan. Endlich war ich so frei, die Mittel meiner Berichterstattung selbst zu wählen. Eigentlich war der Artikel im Wesentlichen fertig. Ich brauchte nur noch aussagekräftige Bilder. Sie zu besorgen würde nicht länger als zwei Tage dauern. In der restlichen Zeit wollte ich herausfinden, was Rondorf vorhatte.
Am Freitag kam das Paket aus Berlin an. Es enthielt die April-Ausgabe des „Magazins“ von 1997. Ich setzte mich auf die Terrasse, um Rondorfs Bericht eingehend zu studieren. Professor Kapoor lehrte an der Universität Mumbai Geschichte mit dem Schwerpunkt Evolutionstheorie. Im Zuge seiner Forschungen hatte er wichtige Erkenntnisse über den Lauf der Geschichte gewonnen. Die Ansichten der Wissenschaftler zu diesem Thema gingen auseinander.
Manche waren der Meinung, der Lauf der Geschichte sei von einem übergeordneten schöpferischen Wesen vorherbestimmt, das die Ereignisse hervorbrachte und sie wieder zu sich zurückführte. Diese Ansicht war vor allem in gottesfürchtigen Gesellschaften und im christlichen Europa der frühen Jahrhunderte verbreitet. Man glaubte an die Macht des Schicksals und daran, dass das Leben des Einzelnen und der Gemeinschaft bis ins Detail vorherbestimmt war. Ein freier Wille des Individuums existierte nicht.
Die Weltsicht der Renaissance und der Aufklärung stellte die menschliche Vernunft über das Schicksal und gab dem Menschen sein ersehntes Selbstbestimmungsrecht. Geschichte war der Ausdruck dieser Freiheit des menschlichen Willens, die Zukunft etwas, das der Mensch nach eigenen Vorstellungen gestalten konnte. Die Vernunft triumphierte über die Natur und den göttlichen Willen. Der Mensch wurde als stark und mächtig angesehen, als Ebenbild Gottes im wahrsten Sinne des Wortes. Er wurde selbst zum Schöpfer.
Später entwickelte sich der so genannte Historismus. Seine Verfechter glaubten weder an ein Wirken Gottes noch an einen Einfluss des Menschen auf den Lauf der Geschichte. Geschichte verlief nach diesem Modell rein chaotisch, ohne Ausgangspunkt und Ziel, ohne Sinn und roten Faden. Der Mensch war nicht mehr dem göttlichen Willen, sondern dem willkürlichen Zufall ausgeliefert und fühlte sich aufgrund dessen noch ohnmächtiger als gegenüber einem göttlichen Schöpfer, den er zumindest für gerecht und allwissend hielt.
Modernere Philosophen und Wissenschaftler betrachteten Geschichte als zyklisch, beziehungsweise periodisch. Geschichte sei nichts anderes als die konstante Wiederholung der gleichen Gegebenheiten in den verschiedenen Kulturen, die willkürlichen Schwankungen unterliegt. Hegel prägte den Begriff der „rhythmischen Veränderung“, die zwar kulturelle Fortentwicklung bedeutet, aber auf dem Zufallsprinzip beruht und keinen höheren Sinn hat, obwohl sie periodisch auftretenden, erkennbaren Mustern folgen soll.
Rondorf präsentierte die unterschiedlichen Ansichten mit Hilfe von Interviews, Tabellen und Analysen des Instituts von Professor Kapoor. Die gegenwärtig herrschende Meinung sprach sich grundsätzlich für ein Geschichtsmodell aus, das auf dem Zufallsprinzip beruht. Höhepunkte und Krisen in Kulturen wiederholten sich zwar in regelmäßigen Abständen, aber das ließ auf kein Muster mit klarem, einheitlichen Ziel schließen.
Konträr dazu stand die innovative und singuläre Theorie Professor Kapoors. Die Art, wie Rondorf diese Theorie präsentierte, hatte nichts mehr mit dem knallharten Stil zu tun, den man von ihm gewohnt war. Er verlor die Distanz und drückte sich plötzlich ungewöhnlich emotional und schwammig aus. Rondorf zitierte den Professor, der den Lauf der Geschichte bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts leidenschaftlich als kulturelle Evolution mit höherem Ziel beschrieb. Geschichte war nach Professor Kapoor keine bloße Anhäufung willkürlicher Begebenheiten, sondern vielmehr ein sinnvoller Evolutionsprozess, der Zustände höherer Einheit zum Ziel hatte. Während Aristoteles von einem „großen Beweger“ gesprochen hatte, war der zentrale Begriff in Professor Kapoors Lehre die „höhere Einheit“, der alles zustrebt. Professor Kapoor räumte dem Göttlichen wieder einen Platz im Geschichtsmodell und im Leben der Menschen ein. Wenn eine Kultur unterging, wie beispielsweise das alte Rom, dann geschah das nur, weil sie überholt war und einer neuen Art des Sozialgefüges und der zwischenmenschlichen Auseinandersetzung weichen musste, damit sich die Menschheit weiterentwickeln konnte. Das Alte musste sterben, damit das Neue an seinen Platz treten konnte. Kapoor war der Ansicht, die Zeit ermögliche eine Evolution des individuellen und des kollektiven Bewusstseins. Das lebende System der verschiedenen Kulturen mache eine sinnvolle, zielgerichtete Entwicklung durch und strebe nach höchstmöglichem Bewusstsein und nach höchster Erkenntnis. Auf der jetzigen „Entwicklungsstufe“, auf der nach Kapoors Meinung so etwas wie globales Bewusstsein entstand, war es entscheidend, dass sich jeder einzelne Mensch dieser historischen beziehungsweise menschlichen Evolution bewusst wurde. Nur so konnte die Menschheit aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und ihre Aufgabe für die Zukunft erkennen. Diese Aufgabe verlangte von jedem Einzelnen echtes Verständnis des Lebens und seiner Gesetzmäßigkeiten und damit die Entwicklung seines individuellen Bewusstseins. Höhere Einheit war nur durch höheres Bewusstsein zu erlangen. Erst dann erfüllte das individuelle Leben seinen Sinn und war im Einklang mit den kosmischen Gesetzmäßigkeiten. Und bis dahin lebten wir als bloße Vernunft-Tiere und erfüllten lediglich unsere körperlichen Bedürfnisse, während wir unsere geistigen Bedürfnisse nicht erkannten, geschweige denn unsere spirituellen.
Hier endete der Artikel. Rondorf ließ offen, wie dieses höhere Bewusstsein erworben werden konnte, und die beeindruckende Hypothese des Professors blieb reine Theorie. Das passte absolut nicht zu Rondorfs journalistischem Stil. Er war dafür bekannt, dass er Hypothesen und Theorien verabscheute, wenn es keine Beispiele für ihre praktische Anwendung gab. Ich fragte mich, warum er seinen Grundsätzen ausgerechnet dieses eine Mal untreu geworden war.
Suchte Rondorf etwa nach Beweisen für die praktische Anwendbarkeit dessen, was Professor Kapoor theoretisch beschrieben hatte? Die Vermutung schien mir ebenso absurd wie Rondorfs Beschäftigung mit der Rolle der indischen Frau. Oder hatten diese Themen etwas gemeinsam? Schließlich ging es in beiden Fällen um Wandel und Entwicklung – um Evolution! War das derselbe Rondorf, der mich kürzlich als naive Weltverbesserin beschimpft hatte? Wie konnte dieser Choleriker nach einer schönen neuen Welt suchen, einer höheren Einheit, die meines Erachtens nicht anders zu nennen war als … Gott? Wie konnte er überhaupt an die Existenz eines höheren Sinnes glauben, Pragmatiker und Realist, der er war? Rondorf war weit davon entfernt, seine Karriere als Esoteriker zu beenden, der durch plötzliche Eingebung und wundersame Läuterung dazu bewegt worden war, über den metaphysischen Grund des Lebens zu sinnieren. Es musste mehr dahinter stecken. Mehr – oder etwas anderes. Vielleicht eine andere Motivation?
In mir reifte ein Plan, den ich sofort in die Tat umsetzen wollte. Kurz nach Mitternacht zog ich mich tiefschwarz an und bestellte ein Taxi zum Connaught Place. Obwohl ich mir einredete, in edler Mission unterwegs zu sein, fühlte ich mich wie ein Einbrecher. Nachdem ich die knarzende Treppe überwunden hatte, öffnete ich blitzschnell die Tür zum Büro, schlich zu Rondorfs Schreibtisch und schaltete seinen Computer ein. Mir war noch nie aufgefallen, was für einen Lärm der Rechner beim Hochfahren machte. Der Schweiß tropfte mir von der Stirn. Mittlerweile war es auch nachts feuchtheiß. Mein Herz klopfte laut und das Atmen fiel mir schwer. Der Computer verkündete mit einem Piepen, dass er für die Nutzung bereit war. Nur etwas fehlte noch. Das Passwort. Kannte ich Rondorf gut genug, um seinen Assoziationen auf die Schliche zu kommen? Ich hatte drei Versuche. Rondorf war weder verheiratet noch hatte er Kinder. Diese Namen fielen also flach. Sein Geburtsdatum? Kannte ich nicht. Es war unwahrscheinlich, dass er seine Whiskymarke als Passwort gewählt hatte. Was wusste ich über Rondorfs Lebenslauf? In Berlin geboren und aufgewachsen, dann im Ausland unterwegs, zunächst in Südamerika, dann in Asien. Mindestens zehn Jahre hatte er in China verbracht. Nach Indien war er erst Mitte der Achtziger gekommen. Mir fiel nicht ein brauchbares Wort ein. Leichtsinnig gab ich „China“ ein. Falsch. Zwei Versuche blieben. Der Computer war relativ neu. Es musste etwas sein, das Rondorf in den letzten ein bis zwei Jahren beschäftigt hatte. Im Geiste rief ich die Überschriften seiner letzten Artikel ab. Vor einigen Jahren hatte Rondorf über die Herrschaft der Großmoguln in Indien geschrieben. Er hatte damals die aggressive, expansive Politik des Nachfolgers von Shah Jahan gelobt. „Aurangzeb“. Nervös gab ich die Buchstaben ein. Wieder falsch! Mir blieb ein lächerlicher Versuch. Halbherzig gab ich einer plötzlichen Eingebung folgend „Shangri-La“ ein – und Sesam öffnete sich. Ich erschrak. War Rondorf etwa derjenige, der die Fährte legte, die mich zu Babas Shangri-La führte?
Ich kopierte sämtliche Dateien von der Festplatte auf eine mitgebrachte Diskette und durchsuchte das Archiv nach weiteren versteckten Ordnern. Doch außer der grauen Mappe, die ich schon kannte, fand ich nichts. Vorsichtig warf ich den Kopierer an und kopierte sämtliche Notizen, inklusive der Zeichnung vom Norbulingka. Dann fuhr ich den Computer wieder herunter und schaltete ihn ab. Plötzlich hörte ich das wohlbekannte Knarzen der morschen Holztreppe. Geistesgegenwärtig versteckte ich mich unter Rondorfs Schreibtisch. Die Tür öffnete sich und der Lichtstrahl einer Taschenlampe schwenkte durch den Raum. Schritte kamen auf Rondorfs Schreibtisch zu. Mein Herz hämmerte wild. Über mir blätterte jemand in den Papieren. Der Einbrecher trug teure englische Mokassins. Wer außer mir wagte es, nachts in das Büro einzudringen, und warum?
Nach einer Ewigkeit entfernten sich die Schritte fast geräuschlos und hielten an meinem Schreibtisch inne. Der Einbrecher wühlte nun auch in meinen Papieren. Der Lichtstrahl der Taschenlampe glitt suchend über alle Möbel und Wände. Endlich entfernten sich die Schritte in Richtung Ausgang. Ich atmete erleichtert auf. Doch dann zögerte der Eindringling und kam zurück. Er musste das Archiv entdeckt haben. Ich hörte, wie er die Tür hinter sich schloss. Blitzschnell verließ ich mein Versteck, schlich über die knarzende Treppe ins Freie und kauerte mich in eine dunkle Nische des schräg gegenüberliegenden Hauseingangs. Lange Zeit rührte sich nichts. Dann trat ein Mann aus dem Eingang zum Büro. Er war groß und schlank und trug schwarze Kleidung, genau wie ich. Sein Gesicht war von einer Mütze verdeckt. Er bewegte sich leicht und mit ungewöhnlicher Grazie. Auf dem Parkplatz riss er sich die Mütze vom Kopf und drehte mir sein Gesicht zu. Es war klassisch schön und von dunkler Färbung. Ein Inder. Er sah zufrieden aus. Offenbar hatte er gefunden, wonach er gesucht hatte. Dann stieg er in einen bereitstehenden Jeep und fuhr davon. Ich merkte mir das Kennzeichen: DL 2344 CH.
Schon vor Sonnenaufgang war ich wieder auf den Beinen und durchforstete die kopierten Dateien nach brauchbaren Anhaltspunkten. Aber offenbar war die ganze Mühe umsonst gewesen. Ich fand lediglich eine Liste mit den wichtigsten Bibliotheken des Landes und weitere Informationen zum Thema kulturelle und historische Evolution. In welchem Zusammenhang stand das alles mit Shangri-La?