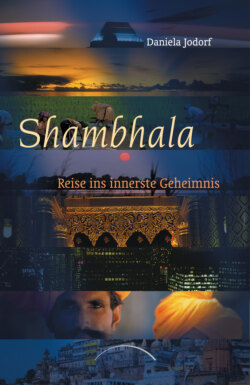Читать книгу Shambhala - Daniela Jodorf - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
Оглавление__________________________________________________
Eine Woche vor meiner Abreise setzte ich mich persönlich mit Herrn Rondorf, meinem neuen Kollegen in Delhi, in Verbindung. Ich kannte ihn bisher nur aus den Geschichten, die man sich über ihn erzählte, und denen zufolge war Rudolf Rondorf ein außergewöhnlicher Journalist, so etwas wie eine lebende Legende. Er wurde vielfach als derber Haudegen beschrieben, der gerne vulgäre Sprüche machte und entsprechende Witze erzählte, und doch wurde er von den meisten in der Berliner Redaktion hoch geachtet, wenn nicht sogar gefürchtet. Die Mimik zahlreicher Gesichter erzählte mir eine Geschichte, die ich nicht glauben wollte: Mit Rondorf kann man nicht zusammenarbeiten.
Am Telefon gab er mir eine Kostprobe seines außergewöhnlichen Charakters.
„Sie sind also das junge Ding, das bald mit mir zusammenarbeiten wird?“
Seine Stimme war tief und rau, und er schrie so laut ins Telefon, dass mir die Ohren dröhnten. Die Kommunikation wurde zusätzlich dadurch erschwert, dass die Verbindung sehr schlecht war und mir alles, was ich selbst sagte, mit zeitlicher Verzögerung als Echo entgegenkam.
„Ich bin Caroline von Teubner“, hörte ich meine beleidigte Stimme und fühlte mich wie ein Idiot.
„Nun, wie auch immer, Frau Von und Zu. Kommen Sie erst mal her, dann klären wir die Lage. So aus der Ferne hat es gar keinen Sinn, irgend etwas besprechen zu wollen. Wann kommen Sie an?“
„Am Elften um 0.30 Uhr aus Zürich“, antwortete ich einsilbig.
Immerhin versprach Rondorf, mich abholen zu lassen.
„Ich werde einen Fahrer zum Flughafen schicken, der Sie zum Hotel bringt. Alles Weitere klären wir dann, wenn Sie ausgeschlafen haben.“
Ich traute meinen Ohren nicht, als es in der Leitung klickte, weil Rondorf ohne ein Abschiedswort eingehängt hatte. Ich musste verrückt sein, freiwillig die Harmonie meiner ruhigen Berliner Redaktion gegen die Zusammenarbeit mit diesem rüpelhaften Einzelgänger einzutauschen.
Im Flugzeug von Zürich nach Delhi schlief ich die meiste Zeit und erwachte erst wieder, als wir bereits im Dunkeln in einer neuen Zeitzone über Pakistan flogen. Bis Delhi hatten wir noch mehr als eine Stunde Flugzeit. Ich blickte angestrengt aus dem Fenster zu meiner Rechten und ließ mich von den Lichtern einzelner Städte und unzähligen Feuern, die die öde Wüstenlandschaft unter uns erhellten, in die Welt meiner Phantasie entführen. Zum ersten Mal in meinem Leben war ich im Orient. Ich fühlte mich wie ein neugieriges Kind auf Entdeckungsreise – aufgeregt und voller Begeisterung. Alles, was auf mich zukam, war neu und spannend. Ein angenehmer Schauer lief durch meinen Körper, und ich drückte meine Nase an die Scheibe des vereisten Fensters, um besser sehen zu können. Mit einem Mal verstand ich kaum noch, warum ich auch nur einen Moment lang gezögert hatte, mich für Indien zu entscheiden.
Dann ging alles sehr schnell. Nach einer halben Stunde flogen wir bereits über die Vororte der indischen Hauptstadt. Gelbliche Straßenlaternen verbreiteten ein gespenstisches Licht, das in Schleiern bis in unsere sich stetig verringernde Flughöhe drang. Auch hier waren überall brennende Feuer zu sehen. Unter mir pulsierte das Leben. Das also war Indien!
Kurz nach der Landung wurde die Klimaanlage im Flugzeug abgestellt, und als die Türen aufschwangen, schlug mir ein Schwall feuchtwarmer Luft und ein starker, fast beißender Geruch nach verbranntem Holz entgegen. Ich saß in einer der vordersten Reihen und wurde von den hinausdrängenden Passagieren mitgerissen, sobald ich den Mittelgang betreten hatte. Das Flughafengebäude war moderner und sauberer als ich erwartet hatte. Ein neuer Geruch nahm mir kurze Zeit den Atem: Mottenpulver oder Desinfektionsmittel? Ich versuchte, langsam und tief durchzuatmen, bis es mir ohne Husten gelang, die fast pulverige Luft in mich aufzunehmen.
Inzwischen befand ich mich, dem Strom folgend, auf dem Weg zur Passkontrolle im Erdgeschoss. Vor den Schaltern, hinter denen Beamte der Einreisebehörde in abgewetzten Uniformen saßen, hatten sich bereits endlos lange Schlangen gebildet. Ich machte mich auf stundenlanges Warten gefasst und betrachtete die Menschen um mich herum. Hier entdeckte ich eine junge Frau in einem blauen Sari, die ihr höchstens drei Monate altes Baby auf dem Arm wiegte und dabei vor sich hin summte. Vor mir wartete ein Sikh mit weißem Turban und dichtem schwarzem Vollbart. Links neben mir entdeckte ich einen indischen Geschäftsmann im maßgeschneiderten Anzug, direkt neben einer bunt gemischten Gruppe junger deutscher Rucksacktouristen. Meine ersten Eindrücke hätten nicht widersprüchlicher sein können. Hier aufgeregte Touristen auf der Suche nach mystischen Erlebnissen im spirituellen Indien, dort Inder, die gelassen warteten und mich mit ihrer unbekümmerten Ruhe ansteckten. Durch das neutrale Beobachten meiner Umgebung gewann ich Distanz zu meinen eigenen Gedanken und Gefühlen und erkannte plötzlich ganz deutlich, dass ich aus reiner Trägheit und Feigheit fast bereit gewesen wäre, die Bequemlichkeit und Sicherheit meines eingespielten Berliner Lebens dem Neuen und Ungewissen vorzuziehen, das mich hier erwartete.
Das Leben hatte es mir immer leicht gemacht. Es war ein sehr angenehmes Leben gewesen, aber leider auch ein geradliniges, vorprogrammiertes, stets berechenbares. Ich war als behütetes einziges Kind wohlhabender Eltern aufgewachsen. Mein Großvater hatte eine Reederei in Bremen besessen und war vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges in die USA ausgewandert, um der Nazi-Herrschaft zu entgehen. Politik war ihm von jeher ein Dorn im Auge gewesen. Als „reine Zeitverschwendung“ hatte er sie bezeichnet, bis ihm die Umstände eine politische Stellungnahme abverlangten. Er wählte die Emigration ins feindliche Ausland. Einzig die Tatsache, dass Friedrich von Teubner loyale Freunde in hohen Positionen hatte, ermöglichte es ihm, sein Vermögen und die Reederei über die Kriegsjahre hinwegzuretten, wenn auch mit Rüstungsaufträgen.
Zwischen 1940 und 1945 gründete mein Großvater eine zweite Reederei in Boston, die bald noch mehr Gewinn abwarf als die deutsche Muttergesellschaft. Nach dem Krieg beschloss er, in Boston zu bleiben, schickte aber seine beiden im Exil geborenen Söhne – meinen Vater Karl und seinen Bruder Frank – auf ein deutsches Internat. Zu diesem Zeitpunkt war das Leben der beiden Söhne bereits verplant. Jeder sollte später eine der Reedereien übernehmen – eine Entscheidung, die mit dem Einverständnis der Jungen getroffen worden war. Frank würde die Reederei in Boston bekommen, Karl die Werft in Bremen. Und so geschah es, als Großvater 1960 starb.
1964 heiratete mein Vater, und fünf Jahre später wurde ich geboren. Meine Eltern hielten eine fundierte Schulbildung für die beste Mitgift, die sie ihrer Tochter geben konnten. Daher schickten sie mich, sobald ich alt genug war, auf ein Schweizer Internat. Von da an war ich nur noch selten zu Hause in Bremen. Früh hatte ich – sehr zur Freude meines konservativen Vaters – meinen Traumberuf gewählt: Journalistin. Natürlich ließ er es sich nicht nehmen, mir die besten Ausbildungsplätze zu vermitteln: zuerst ein Volontariat bei einer bekannten Hamburger Tageszeitung und anschließend zwei Jahre auf einer Journalistenschule in West-Berlin. Später arbeitete ich kurze Zeit als freie Journalistin und verbrachte anschließend drei Jahre an einer Bostoner Eliteuniversität, wo ich mit Auszeichnung abschloss.
Zurück in Berlin war ich zum ersten Mal nicht gezwungen, auf Vaters Beziehungen zurückzugreifen. Ich traf einen Bekannten von der Journalistenschule wieder, Philipp Stein. Er arbeitete mittlerweile bei der Zeitschrift „Das Magazin“ und gab mir den Rat, meine Bewerbung „blind“ an die Redaktion zu senden. Er hatte gehört, dass in absehbarer Zeit ein Posten in der Südeuropa-Redaktion frei werden könnte. Und so war es. Meine vielversprechende Karriere beim „Magazin“ hatte begonnen.
Doch leider hatten all diese glücklichen Fügungen einen schalen Beigeschmack für mich, der mich häufig an mir selbst und meinen Fähigkeiten zweifeln ließ. Vieles war mir in den Schoß gefallen, vieles hatte mein Vater mir ermöglicht, und manchmal kam es mir vor, als beruhte nichts auf meiner eigenen Leistung. Wäre ich allein, ohne fremde Unterstützung jemals in der Lage gewesen, all das zu erreichen? Manchmal fühlte ich mich wie ein Trapezkünstler, der sich geschmeidig durch die Lüfte schwingt, weil er weiß, dass unter ihm ein Netz ist, das andere zu seiner Sicherheit aufgespannt haben. Was wäre, wenn diese Menschen das Netz nicht mehr hielten? Würde ich dann abstürzen? Ins Nichts?
Die Versetzung nach Indien und die damit einhergehende Beförderung war nichts als eine logische Konsequenz des Vorausgegangenen. Auch wenn Herr Aurichs Angebot mich überrascht hatte, waren die Dinge doch letztlich ganz so gelaufen, wie ich es gewohnt war – glatt, für meinen Geschmack zu glatt. Wieder hatte ich das Gefühl, mir diese Versetzung nicht selbst erkämpft zu haben, obwohl sie unbestreitbar auf meinen „herausragenden“ persönlichen Leistungen beruhte. Diesmal war es nicht mein Vater gewesen, der mich protegiert hatte, sondern Herr Aurich.
In dem Moment, als ich als Beobachter in der Schlange der Wartenden stand, wurde mir klar, dass dies meine Chance war. Bisher hatten andere meinen Lebensweg geebnet. Jetzt war ich auf mich allein gestellt. Jetzt würde sich zum ersten Mal zeigen, was und ob ich überhaupt etwas konnte. Jetzt würde sich zeigen, ob ich in der Lage war, ohne Netz am Trapez zu turnen.
Ich war an der Reihe. Der Grenzbeamte winkte mich zu sich heran, und ich reichte ihm meine Papiere. Während er meine Daten in den Computer eingab, fragte er mit hart rollendem R:
„Is this your first time in India?“
„Yes.“
„You‘ll work here?“
„Yes, for a german news magazine.“
Er stempelte meinen Pass, gab ihn mir zurück und lächelte.
„Welcome to India, Madam.“
Meine beiden Koffer warteten schon auf mich. Jemand hatte sie mit anderen Gepäckstücken fein säuberlich neben das Transportband gestellt. Ich warf sie auf einen Gepäckwagen und schob sie entschlossen vor mir her – hinaus in die indische Nacht.
Die Geräuschkulisse im Inneren des Flughafens war seltsam ruhig und gedämpft gewesen, so als schlucke der Marmor der Böden und Wände alle Lebensäußerungen, aber nun trat ich wie durch eine unsichtbare Schleuse und tauchte in das Gemurmel Tausender von Stimmen ein, die sich in fremdartigen Lauten artikulierten. Mein Blick fiel auf das Ende des Ganges, der hinaus ins Freie führte. An einem Zaun aus Maschendraht hingen Menschen über Menschen. Sie klebten förmlich in den Maschen, winkten und riefen laut oder starrten jeden Ankommenden stumm und durchdringend an. Panisch schob ich meinen Gepäckwagen in die vorgegebene Richtung und suchte in dieser Menschentraube verzweifelt nach dem Fahrer, den Rondorf mir zu schicken versprochen hatte. Ich war schon sicher, dass ich ihn in diesem Chaos niemals finden würde, als jemand meinen Namen rief: „Miss von Teubnerrr!“
Suchend blickte ich mich um und entdeckte einen schmächtigen Kerl mit Schnauzbart, der ein weißes Schild mit meinem Namen durch die Luft schwenkte. Erleichtert steuerte ich auf ihn zu und signalisierte ihm, dass ich die Gesuchte war. Er übernahm wortlos meinen Wagen, und ich presste meine Handtasche an mich und gab mir alle Mühe, meinen eiligen Führer im Gedränge nicht aus den Augen zu verlieren. Zum Glück hatte er das Auto – einen beigefarbenen Ambassador – gleich hinter dem Eingang zum Parkplatz abgestellt. Er warf meine Koffer in den Kofferraum, verfrachtete mich auf den Rücksitz und ließ den Motor an. Noch immer hatten wir kein einziges Wort gewechselt.
Wir ließen das Flughafengelände, das sich mit seinen geraden Straßen bis in weite Ferne zu erstrecken schien, schnell hinter uns. Ich klebte mit der Nase an der Scheibe und versuchte angestrengt, ein paar Blicke auf die Stadt zu erhaschen, die mein neues Zuhause werden sollte. Auch mein Fahrer taute allmählich auf und kramte in seinem spärlichen Repertoire nach den englischen Worten für Moschee, Bahnhof und Krankenhaus. Schließlich steigerte sich seine Fremdenführerleidenschaft so sehr, dass er immer öfter den Blick von der Straße und die Hände vom Lenkrad nahm, um mich wild gestikulierend auf die Sehenswürdigkeiten seiner Stadt hinzuweisen. Ich brachte nicht mehr als ein klägliches „Aha“ heraus und hoffte inständig, dass ihm die Straße vor uns ebenso wichtig war wie diese Sightseeingtour, für die ich weder Augen noch Ohren hatte.
Irgendwann landete ich wider Erwarten sicher im Hotel und fand mich kurz darauf – endlich allein – auf meinem Zimmer wieder. Mit letzter Kraft hievte ich einen meiner beiden Koffer auf den Kofferständer, um wenigstens das Nötigste auszupacken. Da schreckte mich das Klingeln des Telefons aus meiner mechanischen Tätigkeit. Rondorfs polternde Stimme schrie mir ein paar raue Willkommensworte ins Ohr und kam dann ohne diplomatische Umschweife zur Sache: „N‘abend, Frau Von und Zu. Sie sind also sicher gelandet. Ich überlasse Ihnen Kuber, den Fahrer, der Sie vom Flughafen abgeholt hat, für die nächste Zeit, bis Sie einen eigenen gefunden haben. Wir treffen uns morgen in meinem Büro. Die Adresse haben Sie ja. Sagen wir … um elf. Ich nehme an, dass Sie von der langen Reise müde sind und ein bisschen Schlaf brauchen.“
Zunächst wollte ich seinen Redefluss unterbrechen und ihn daran erinnern, dass mein Name Caroline von Teubner war. Aber das erschien mir plötzlich lächerlich und ich war froh, dass ich die kleinlichen Worte gerade noch hatte hinunterschlucken können, um seine Instruktionen für den folgenden Tag entgegenzunehmen. Widerspruch meinerseits war nicht vorgesehen. Bevor Rondorf das Gespräch abrupt beendete, hatte ich gerade noch Gelegenheit, den Termin zu bestätigen: „Morgen um elf in Ihrem Büro.“
Dann war die Leitung tot und ich stand müde, deprimiert und fassungslos mit dem Hörer in der Hand vor dem breiten Bett und meinen unausgepackten Koffern.
Pünktlich um 10.30 Uhr durchquerte ich ausgeschlafen und gut gelaunt das Foyer meines Hotels und trat hinaus in das morgendliche Delhi. Der Geruch der nächtlichen Feuer hatte sich im Licht des Tages bereits verflüchtigt, und die laue Luft duftete nach Frühling. Obwohl die Temperaturen in der Nacht nicht unter 20 Grad gefallen waren, hatte die Dunkelheit Erfrischung gebracht. Der Wagenmeister kam freundlich nickend auf mich zu und fragte nach der Nummer meines Wagens. Ich kannte sie nicht. Die ersten Eindrücke kurz nach meiner Ankunft waren so überwältigend und vielfältig gewesen, dass ich kaum an das Notwendige hatte denken können. Schließlich kam ich gleichzeitig mit dem Wagenmeister auf die Idee, den Fahrer mit „Mr. Rondorf‘s car“ rufen zu lassen. Die Ansage hallte durch den Lautsprecher auf den Parkplatz, und wenige Minuten später kam der beige Ambassador vor meinen Füßen zum Stehen. Kuber sprang aus dem Wagen und riss eine der hinteren Türen für mich auf. Ich fragte mich, ob er die ganze Nacht im Auto verbracht hatte.
Während der Fahrt fing Kuber plötzlich wieder an, wild mit den Händen zu fuchteln und aufgeregt aus dem Fenster zu zeigen. Wir passierten wohl wieder eine Sehenswürdigkeit, die seinen Stolz erregte. Aufgeregt rief er:
„India Gate, Madam, India Gate, yes, yes!“
Inmitten einer gepflegten Grünfläche, von breiten Prachtstraßen umgeben ragte ein Triumphbogen empor. Der rötliche Sandstein, aus dem er erbaut war, gab ihm etwas Weiches, beinahe Melancholisches. Mein Blick glitt über die Rasenfläche auf die gegenüberliegende Straßenseite und in die Ferne, wo ich auf einem Hügel den Regierungspalast, Rashtrapati Bhawan, erkannte. Ich hatte Glück, denn der Wagen hielt gerade an einer Ampel und so konnte ich mich ganz dem beeindruckenden Gebäude und meinen Gedanken an jene imperialistische Macht widmen, die es einst erbaut hatte. Ich fühlte mich plötzlich zurückversetzt in die Zeit der britischen Herrschaft, des British Raj, in der ein englischer Vizekönig in Indien regiert hatte. Ich dachte an stilvolle Picknicks im Freien, an Gewürze und Tee, Handel und Expansion. Und an den Tag der indischen Unabhängigkeit im August 1947…
Der Wagen fuhr wieder an und schlängelte sich an zahlreichen Verkehrsinseln vorbei, die mit den buntesten und größten Blumen bepflanzt waren, die ich je gesehen hatte. Schließlich erreichten wir Connaught Place, ein Zentrum aus Geschäften, Restaurants und Büros in mehreren konzentrischen Kolonnaden, welches ebenfalls von den Briten erbaut worden war. Hier, wo die Häuser alle gleich aussahen, hatte auch Rondorf sein Büro. Kuber hielt auf dem überfüllten Parkplatz vor einem Gebäudekomplex namens N-Block. Irgendwo zwischen kreuz und quer parkenden Wagen stellte er den Motor ab und deutete auf eine schmale Tür, die den Eingang zu einem Treppenhaus erkennen ließ. „Office!“
Das also war mein zukünftiger Arbeitsplatz.
Die Hitze schlug mir ins Gesicht, als ich aus dem klimatisierten Wagen stieg. Mir wurde schwarz vor Augen. Ich hielt einen Moment inne, bis der unangenehme Schwindel verflogen war, und kletterte dann über Stoßstangen und Motorradrikschas hinüber zum Hauseingang.
Die Atmosphäre am Connaught Place gefiel mir. Preiswerte Hotels, Restaurants, Cafés, Reisebüros und einfache Läden reihten sich unter schattigen Arkaden aneinander. Alles wirkte ein bisschen schmuddelig. Neben der Treppe, die Kuber zufolge in Rondorfs Reich führte, lag die Filiale einer englischen Fastfood-Kette. Ich musste ein Lachen unterdrücken, als ich mir zum Vergleich Bilder der repräsentativen Berliner Redaktion in Erinnerung rief. Vergeblich suchte ich nach einer Klingel. Die Tür stand offen, ohne einladend zu wirken. Eine Reihe schmutziger Schilder gab Auskunft über die im Haus Ansässigen. Zögernd trat ich in das Halbdunkel des engen Flures. Es dauerte einige Zeit, bis sich meine Augen an das gedämpfte Licht gewöhnt hatten und ich meine Füße sicher auf die ausgetretenen Treppenstufen setzen konnte. Sie knarrten unter meinen Füßen und derselbe beißende Geruch, der mir heute Nacht am Flughafen den Atem genommen hatte, stieg mir in die Nase. Das Büro lag im ersten Stock. Neben der Tür glänzte ein poliertes Messingschild. Darunter fand ich einen Klingelknopf. Nervös zupfte ich den Kragen meines Kleides zurecht und drückte entschlossen auf die Klingel. Ein blecherner Ton erklang. Keine Reaktion. Ich lauschte angestrengt. Der Lärm der Straße war so deutlich zu hören, als seien die Wände aus Papier. Im Inneren des Büros regte sich nichts. Ich klingelte erneut, diesmal energischer und drei Mal hintereinander. Wieder Stille. Zaghaft stieß ich gegen die Tür. Sie war nur angelehnt, aber dennoch fühlte ich mich wie ein Eindringling, als ich das Büro betrat. Es war nicht viel größer als dreißig Quadratmeter. Unmittelbar hinter der Tür grenzte eine Art Tresen, der ursprünglich vielleicht als Rezeption gedacht war, den Raum vom Eingangsbereich ab. Stickige Luft, die nach abgestandenem Rauch und Alkohol roch, schlug mir entgegen. Eine Klimaanlage gab es hier offensichtlich nicht. Mein erster Impuls hieß Flucht. Ich wollte rückwärts zur Tür hinauslaufen, die Treppe hinunter rennen, zum Flughafen fahren und mit der erstbesten Maschine zurück nach Berlin fliegen.
„Feigling!“, beschimpfte ich mich selbst. „So schnell gibt man nicht auf.“
Ich quetschte mich also links am Tresen vorbei und konnte nun den ganzen Raum überblicken. Und endlich entdeckte ich Rondorf in einer Nische, die ich vorher nicht hatte einsehen können. Er saß mit dem Rücken zu mir auf seinem chaotischen Schreibtisch und telefonierte in fließendem Englisch. Weil ich nicht unaufgefordert mithören wollte, wandte ich meine Aufmerksamkeit dem abstoßenden Raum zu. Trotz der schwülen Wärme fröstelte ich. Rondorfs Schreibtisch war aus schwerem, dunklem Holz. Zwischen Bergen von Papier und überquellenden Aschenbechern stand ein Notebook und daneben ein altmodisches, schwarzes Telefon, das er gerade benutzte. Rondorfs Schreibtisch gegenüber stand ein nagelneuer, blank gescheuerter Holztisch, von dem ich vermutete, dass er erst kürzlich für mich angeschafft worden war.
Der Lärm der Straße drang an mein Ohr, und die Mittagshitze nahm unbarmherzig Besitz von dem kleinen Raum. Allein die Vorstellung, jeden Tag so eng mit Rondorf zusammenarbeiten zu müssen, löste heftigen Widerwillen in mir aus. Zerknirscht setzte ich mich auf einen Stuhl, den ich in einer Ecke neben achtlos an die Wand gelehnten Büchern fand, und beobachtete Rondorf, der keine Anstalten machte, das Gespräch zu beenden und sich mir zuzuwenden. Er schien mich absichtlich zu ignorieren.
Endlich warf er den Hörer ärgerlich auf die Gabel. Dann erst stand er auf und kam, ohne ein Wort zu sagen, auf mich zu. Auch ich erhob mich der Höflichkeit halber und blickte ihm direkt in die Augen. Rondorf war ein attraktiver Mann. Seine ehemals blonden, jetzt von grauen Strähnen durchzogenen Haare waren ein wenig schütter, was seiner rauen Attraktivität allerdings keinen Abbruch tat. Eisblaue Augen blickten aus fast 1,90 Meter Höhe kühl und prüfend auf mich herab. Rondorf besaß Charisma. Auf unheimliche Weise schien er den ganzen Raum zu füllen und mir so gut wie keinen Platz zu lassen. Ich wollte mich dagegen wehren, aber es war bereits zu spät. Ich spürte, dass Rondorf mich einschüchtern wollte. Unwillkürlich hatte ich das Gefühl, als prüfe er gnadenlos, ob ich ihm gewachsen war. Binnen Sekunden hatte er das Büro in eine Arena verwandelt, in der sich nun ein unerbittlicher Zweikampf entwickelte, der von sehr subtilen Regeln bestimmt wurde. Rondorf schaute mich unverwandt an, blickte auf mich herab, wie um mir zu zeigen, dass ich ihm niemals gewachsen sein würde.
Ich hatte keine Wahl. Rondorf hatte mich von der ersten Sekunde, noch bevor wir uns persönlich begegnet waren, in ein Spiel verwickelt, das ich nicht spielen wollte. Rondorfs Blick tat seine Wirkung, denn ich war nicht stark genug, ihm standzuhalten. Unsicher wich ich diesen stahlblauen Augen aus, die mich eindringlich musterten und mir zu sagen schienen: „Das ist mein Territorium!“
Ich war arglos hierher gekommen. Was man sich über Rondorf erzählte, hatte ich für absolut übertrieben gehalten. Rondorf sollte ein schwieriger, aber brillanter Journalist sein. Nun gut, hatte ich gedacht, eine kleine Meise haben wir alle. Das bringt der Beruf mit sich, und wer ein bisschen skurril ist, hat oft ein feines Gespür für interessante Geschichten. Wie zum Teufel hätte ich auf eine solche Situation gefasst sein sollen? Noch stärker als zuvor spürte ich den Impuls, wegzulaufen. Aber mein Wille siegte erneut. Also blickte ich Rondorf so offen wie möglich in die Augen und sagte, während ich ihm provokativ die Hand entgegenstreckte, mit sanfter, aber fester Stimme: „Guten Tag, Herr Rondorf. Ich bin Caroline von Teubner. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit.“
Gleich danach schämte ich mich für die offensichtliche Heuchelei. Rondorf griff achtlos nach meiner Hand und drückte sie rau.
„Ha“, brummte er verächtlich. „Nehmen Sie Platz. Ihren Schreibtisch haben Sie ja schon gefunden. Wollen Sie etwas trinken? Tee, Wasser, Cola?“
„Cola, gerne.“
Ich ließ mich schwitzend zurück auf den Stuhl fallen, auf dem ich vor dieser anstrengenden Begrüßung gesessen hatte. Rondorf ging in einen Nebenraum und kam mit zwei Gläsern, Eiswürfeln und einer Flasche Cola zurück. Er stellte die Gläser auf meinen Schreibtisch und goss sie bis obenhin voll. Ich hatte nicht den Mut, ihm zu sagen, dass ich kein Eis wollte, weil mein Magen noch nicht an das indische Wasser gewöhnt war. Das hätte Schwäche signalisiert, zumindest hätte Rondorf es so gewertet. Also hielt ich den Mund und schlürfte gegen meinen Willen Cola mit Eiswürfeln.
Rondorf setzte sich auf meinen Schreibtisch und schien sich plötzlich zu erinnern, dass Höflichkeit unser Kennenlernen erleichtern könnte. Mit etwas freundlicherem Blick fragte er: „Sind Sie in Ihrem Hotel gut untergebracht?“
„Ja, bestens, danke.“
„Nun, Sie haben eine Woche Zeit, sich eine permanente Bleibe zu suchen.“
Er stand auf, ging zu seinem Schreibtisch, fischte erstaunlich zielsicher einen Zettel aus dem Chaos und drückte ihn mir in die Hand.
„Das ist die Adresse eines Maklers, mit dem die meisten Ausländer zusammenarbeiten, wenn sie nach Delhi kommen. Sie können ihn gleich von hier aus anrufen, ich habe Sie bereits angekündigt. Er wird Ihnen ein paar vorausgewählte Wohnungen zeigen. Achten Sie darauf, dass das Apartment bewacht ist und wählen Sie eine gute Gegend. Ich empfehle Greater Kailash oder Defence Colony. Dort sind die Mieten zwar sehr hoch, aber Sie sind wenigstens sicher. Das ist das Wichtigste für eine alleinstehende, ausländische Frau in Delhi.“
Alleinstehend klang aus Rondorfs Mund wie eine Krankheit. Argwöhnisch fragte ich mich, woher diese plötzliche Besorgnis rührte. Noch bevor ich antworten konnte, setzte er seinen Monolog fort: „Ich habe gleich noch einen Termin. Nehmen Sie sich diese Woche Zeit für die Wohnungssuche und um sich zu akklimatisieren. Wenn Sie Hilfe brauchen, rufen Sie mich an. Ansonsten sehen wir uns nächsten Montag um neun hier im Büro! Übrigens – entschuldigen Sie die brüllende Hitze. Die AC ist ausgefallen. Sie können mein Telefon benutzen, um den Makler anzurufen. Nächste Woche haben Sie einen eigenen Anschluss.“
Während ich noch kombinierte, dass mit AC wahrscheinlich die Aircondition gemeint war, die ich vorhin vermisst hatte, streckte Rondorf mir die Hand zum Abschied entgegen und ging. Als er schon fast aus der Tür war, rief er über die Schulter: „Ihr Büroschlüssel liegt auf dem Tresen. Schließen Sie bitte beide Schlösser ab, bevor Sie gehen.“
Mit Rondorf verschwand die unerträgliche Spannung aus dem Raum. Ich sackte auf meinem Stuhl zusammen, erleichtert und erschüttert zugleich. Warum hatte ich mich nur dazu hinreißen lassen, meinen herrlichen Job in Berlin für die Arbeit mit diesem Ekel aufzugeben? Warum nur? Ich versuchte, mich mit der Aussicht zu beschwichtigen, dass es nur zwei Jahre wären, bevor Rondorf in Pension ging. Zwei Jahre konnten endlos lang sein. Warum ich? Ich fühlte mich schon jetzt unterjocht, unfrei und gefangen in einem winzigen Raum, in dem es auch noch laut, stickig und heiß war. Rondorf würde mich unnachgiebig daraufhin prüfen, ob ich eine würdige Nachfolgerin für ihn war. Und ich wusste schon jetzt, wie sein Urteil ausfallen musste. Rondorf würde alles daran setzen, mir zu beweisen, dass ich niemals so gut sein konnte wie er.
Am liebsten hätte ich Julie in Berlin angerufen. Aber dort war es jetzt kurz nach sieben. Julie schlief bestimmt noch. Resigniert trank ich meine geeiste Cola aus und wählte die Nummer des Maklers.
Die Wohnungssuche ging schnell und unkompliziert vonstatten. Mr. Chopra, der Makler, war höflich und zuvorkommend. Er hatte schon am selben Nachmittag Zeit und zeigte mir vier von Rondorf vorausgewählte Objekte. Ich entschied mich spontan für das vierte Apartment, das wir uns ansahen. Es war groß und hell und lag in einer ruhigen Straße in Greater Kailash, ganz in der Nähe des Marktes. Und es stand leer. Ich konnte also nächstes Wochenende einziehen, sobald meine Möbel aus Deutschland da waren.