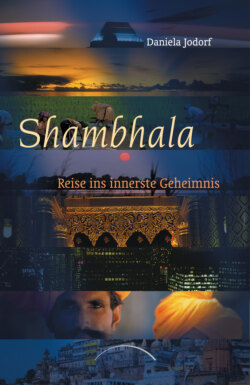Читать книгу Shambhala - Daniela Jodorf - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
Оглавление__________________________________________________
Meine Möbel aus Deutschland trafen am Freitagnachmittag ein. Außerdem hatte die Frau des Maklers eine Notiz in meinem Apartment hinterlassen. Sie wollte am Samstag mit einer geeigneten Haushälterin bei mir vorbeischauen. Ihr Mann hatte mich davon überzeugt, dass ein indischer Haushalt ohne Haushälterin undenkbar war. Während die Möbelpacker meine Umzugskisten auspackten, fuhr ich in die Stadt, um ein paar indische Einrichtungsgegenstände zu kaufen. Ich fand einen Teetisch, silberne Becher und einen bronzenen Buddha von stattlicher Größe und erhabener Schönheit. Während ich über seine kühle metallene Haut strich, dachte ich: „Buddha, der Erwachte.“
Jemand schien auf meine Gedanken zu antworten. Ich sah das Bild eines sehr vertrauten, weisen Mannes vor meinem geistigen Auge: „Buddha ist der Erwachte, aber auch du kannst erwachen. Du suchst das Geheimnis des Lebens noch immer in den falschen Dingen und lebst wie im Schlaf. Es ist an der Zeit, aufzuwachen.“
Plötzlich wusste ich auch, wer da so entschieden mit mir sprach. Es war Baba, der Schlangenbeschwörer vom Taj Mahal. Krachend fiel der Bronzebuddha aus meinen kribbelnden Fingern, die plötzlich nicht mehr greifen konnten. Ich fühlte Hunderte von Augenpaaren auf mich gerichtet. Ein Verkäufer rannte herbei, hob den Buddha vom Boden auf und fragte besorgt, ob ich in Ordnung sei. „No problem“, gab ich indisch gelassen zur Antwort.
Der Verkäufer verpackte den Buddha, der den Sturz unbeschadet überstanden hatte, in eine feste Tragetasche und reichte sie mir mit verständnisvollem Lächeln. Ich zahlte schnell, um von meiner Verlegenheit abzulenken. Erst als ich wieder im Wagen saß, entspannte ich mich. Es geschahen seltsame Dinge. Sehr seltsame Dinge.
Kuber fuhr am Connaught Place vorbei. Kurz entschlossen bat ich ihn, am Büro zu halten. Es schien mir eine gute Idee, Rondorf vor dem Wochenende noch einmal aufzusuchen und mein berufliches Engagement zu bekunden. Vielleicht konnte ich mir zur Einarbeitung Material mit nach Hause nehmen. Ich brauchte endlich eine Aufgabe. Mir fehlte die geistige Beschäftigung schon so sehr, dass mir meine Phantasie die übelsten Streiche spielte. Das kannte ich zwar, aber diesmal war es so schlimm wie nie zuvor. Ich stand also wieder ein wenig nervös im schmierigen Flur des N-Blocks und betätigte die Klingel unter dem Messingschild. Mein eigener Schlüssel lag irgendwo in meiner Wohnung.
„Herein! Die Tür ist offen.“
Weiter als bis zum Tresen kam ich nicht. Papiere über Papiere lagen kreuz und quer auf dem Boden und auf beiden Schreibtischen. Dazwischen und darauf standen benutzte Kaffeetassen, verschmierte Colagläser und leere Whiskyflaschen. Es roch nach kaltem Rauch, Alkohol und Fett aus dem Fastfood-Restaurant unter uns. Dieser Rondorf war einfach ekelhaft. Und schon stapfte er durch das Chaos auf mich zu. „Waren wir nicht für Montagmorgen verabredet?“, fragte er spöttisch grinsend und mit hochgezogener Augenbraue. Dass ihm mein Besuch ungelegen kam, entging mir nicht. „Sie haben uns verabredet“, dachte ich.
„Ich war in der Nähe und dachte, ich könnte vielleicht ein paar Unterlagen mit nach Hause nehmen, um mich übers Wochenende vorzubereiten.“
„Sehr ambitioniert, Frau Kollegin. Aber ich glaube nicht, dass das nötig sein wird. Ich bin die ganze nächste Woche in Mumbai und Sie haben das Office und alle Unterlagen für sich. Das sollte als Vorbereitung doch wohl genügen, oder nicht?“
Sein Ton ließ mich ahnen, dass er mich für beschränkt hielt und alles andere als kollegiale Zusammenarbeit im Sinn hatte. Auf diese schroffe Unverschämtheit konnte ich nur abweisend reagieren. Ich drehte mich also auf dem Absatz um und rief im Hinausgehen: „Schönes Wochenende, Herr Rondorf!“
Ich war in Rage. So war bisher noch niemand mit mir umgesprungen. Dieser Rondorf weckte meine Wut ebenso wie meinen Kampfgeist. Auf der ganzen Rückfahrt nach Hause murmelte ich vor mich hin: „Dir zeig ich’s. Jetzt erst recht. Möge der Bessere gewinnen.“
Ich hatte also nicht wirklich etwas zu tun an meinem ersten Wochenende in Delhi. Außer Rondorf kannte ich keine Menschenseele, und die wichtigsten Touristenziele hatte ich bereits erkundet. Um mich zu beschäftigen und das aufkommende Heimweh zu bekämpfen, kaufte ich am Samstagmorgen in aller Herrgottsfrühe nicht nur Lebensmittel, sondern auch Werkzeug und bewaffnete mich gleich nach dem Frühstück mit Hammer und Nägeln, um meine Bilder aufzuhängen. Kaum hatte ich mein Lieblingsbild, den Roerich, im Schlafzimmer aufgehängt, klingelte es.
Zwei Frauen standen vor der Tür. Mrs. Chopra, die Frau des Maklers, trug einen Blütenkranz und ein goldglänzendes Tablett, auf dem zwei Töpfchen standen. Eines davon war mit Reis gefüllt, das andere enthielt eine blutrote, kreidige Paste. Die kleine Frau neben ihr verbeugte sich mit vor der Brust zusammengelegten Händen, als Mrs. Chopra sie vorstellte: „Sahana, Ihre künftige Haushaltshilfe.“ Dann erklärte sie: „Wir Inder weihen jedes neu bezogene Haus mit einer Puja ein. Das ist ein religiöser Ritus, der das Haus und seine Bewohner segnet und ihnen Glück und Reichtum bringt. Normalerweise macht das ein Priester, aber es kann auch ein älteres Familienmitglied übernehmen. Ich denke, in Ihrem Fall reicht es, wenn das Ritual von einer älteren Freundin durchgeführt wird. Was meinen Sie?“ Ich nickte und bat die beiden Frauen herein. Mrs. Chopra sah sich suchend nach einem geeigneten Platz für die Puja um und fand ihn vor dem Buddha, der seit gestern auf dem Teetisch in einer Ecke des Wohnzimmers stand. Sahana breitete eine mitgebrachte Decke vor dem Altar aus, auf der wir alle drei nach Mrs. Chopras Anweisung niederknieten. Mrs. Chopra legte dem Buddha die Blumengirlande um, zündete Räucherstäbchen an, die köstlich nach Sandelholz dufteten, und steckte sie dem Buddha in die gefalteten Hände. Dann legte sie die Hände vor der Brust zusammen. Ich tat es ihr nach. Während sie ein paar Sanskritworte murmelte, spürte ich eine ungeheure Kraft um uns herum. Sie schien den ganzen Raum zu erfüllen, und ich fragte mich staunend, ob eine Segnung eine tatsächlich spürbare Sache war. Während Mrs. Chopra mir viel Glück und Segen in meinem neuen Heim wünschte, tauchte sie den Ringfinger ihrer rechten Hand zuerst in den Reis, dann in das rote Pulver und drückte mir die klebrige Masse schließlich zwischen die Augenbrauen. Ich spürte ein leichtes Kribbeln, einem Ziehen gleich, das mein Bewusstsein augenblicklich auf diesen Punkt, der auch als das Dritte Auge bezeichnet wird, zu konzentrieren schien. Das Kribbeln verschwand, sobald der Druck von Mrs. Chopras Finger nachließ, und ich sah zu, wie Mrs. Chopra die gleiche Geste nun auch bei Sahana ausführte. Dann reichte sie mir das Tablett und bat mich, auch ihr die Segnung zuteil werden zu lassen. Verlegen kam ich ihrer Bitte nach.
Es überraschte mich, wie selbstverständlich Mrs. Chopra sofort nach der Zeremonie zum Alltagsgeschäft überging. Für sie hatte der Ritus offenbar keinen höheren Stellenwert als die nachfolgende Konversation über Sahanas Bezahlung und ihre Arbeitsbedingungen, bei der wir uns schnell und zur Zufriedenheit aller einig wurden.
Mrs. Chopra sah sich bewundernd im Wohnzimmer um.
„Sie haben das Apartment sehr schön hergerichtet.“
Ich führte sie und Sahana durch die Wohnung. An der Schlafzimmertür blieb Mr. Chopra wie angewurzelt stehen und starrte verzückt auf den Roerich, den ich gerade über dem Bett angebracht hatte. Ihre Reaktion berührte mich. Da war jemand, der angesichts dieses Bildes genau dasselbe empfand wie ich: Ruhe, Frieden, tiefen Respekt, Freude und Wachheit der Sinne.
„Gefällt Ihnen das Bild?“, fragte ich, um das Schweigen zu beenden.
„Woher haben Sie es?“, fragte sie zurück.
„Es stammt aus Russland. Ich habe es erst kürzlich auf einer Versteigerung in Berlin gekauft.“
„Da haben Sie einen unermesslichen Schatz erworben. Hüten Sie ihn wohl!“
Ihre Worte klangen prophetisch, irgendwie raum- und zeitlos und gerade deshalb so bedeutsam, dass ich den Eindruck hatte, als kämen sie nicht aus dem Mund der Frau, die mir gegenüberstand. Es ließ sich nicht mehr verleugnen: Meinem neuen Leben in Indien wohnte etwas Geheimnisvolles inne, das jede Gelegenheit nutzte, sich bemerkbar zu machen. Überall tauchten Bilder und Vieldeutigkeiten auf. Fremde Menschen sagten mir Dinge, die mich so tief berührten, als kämen sie aus meiner eigenen Seele. Und doch machten sie keinen Sinn, ließen sich nicht einordnen, verstehen oder gar erklären. Zeitweise hatte ich das Gefühl, dass sich meine Grenzen erweiterten oder dass sich etwas in mir unmerklich auflöste, vergrößerte und weitete. Meine Wahrnehmung veränderte sich, wurde zunehmend schärfer und objektiver. Gleichzeitig schlich sich eine grauenhafte Kälte in meine Glieder, die mich regelrecht erstarren ließ. Ich hatte Angst; Angst, den Verstand zu verlieren.
Rondorf trug einen hellen, zerknitterten Sommeranzug und wühlte in dem Wust von Unterlagen auf seinem Schreibtisch. Mein Schreibtisch war leer, mein Telefon angeschlossen und auch der Rest des Büros sah wesentlich besser aus als am Freitag. Rondorf machte sich allerdings nicht die Mühe, sich mir zur Begrüßung zuzuwenden. Er murmelte nur ein kurzes „Guten Morgen“ in die vor ihm liegenden Unterlagen und wühlte dann weiter in dem Papierberg, der kurz davor war, vom Schreibtisch zu fallen. Endlich hatte er gefunden, wonach er gesucht hatte. Eilig warf er die Papiere in eine abgegriffene Ledertasche, die er sich unter den Arm klemmte, und erklärte im Telegrammstil: „Ich bin spät dran. Meine Maschine geht in einer Stunde. Freitag bin ich zurück. Wir sehen uns Montag. Und … machen Sie hier mal ein bisschen Klarschiff!“
Während ich mich scheinbar ungerührt an meinen Schreibtisch setzte, schimpfte ich innerlich: „Bin ich hier die Putzfrau? Verschwinde endlich, Blödmann!“
Treffsicher kombinierte ich, dass die Aufgabe, mit der ich mich nun eine Woche lang vertraut machen durfte, im Aufräumen des Büros bestand, und riss als Erstes alle Fenster auf. Dann suchte ich mir im Branchenbuch einen Reparaturdienst, der die Klimaanlage noch heute in Ordnung bringen konnte, und steckte meine ganze Wutenergie in die rigorose Beseitigung des herumliegenden Unrats. Während ich die zerknitterten Papiere sortierte, stieß ich immer wieder auf Notizen und kopierte Artikel neuesten Datums zu einem Thema: „Die Rolle der Frau in der indischen Gesellschaft“. Ich lachte laut. Unvorstellbar, dass der rüde Rondorf sich mit einem so sensiblen Thema beschäftigte. Gerne hätte ich die sortierten Papiere ordentlich abgelegt, aber dieses Büro hatte kein Archiv. Es gab wohl einen Raum mit ausreichend Regalen, aber auch dort lag alles nur wild durcheinander. Selbst Rondorf musste inzwischen den Überblick verloren haben. Und doch: Wenn ich hier irgendwie arbeiten wollte, musste ich diese Sisyphusarbeit hinter mich bringen. Am Donnerstagabend heftete ich mit schweren Gliedern und schmerzendem Rücken die letzten Blätter in einen der von mir persönlich gekauften Ordner. Das Büro erstrahlte in neuem Glanz, und kühl war es auch wieder. Ich war zufrieden.
Das Telefon klingelte. Ich war schon so darauf eingestellt, ausschließlich Rondorfs willkürliche Befehle auszuführen, dass ich ganz selbstverständlich davon ausging, nur er könne am anderen Ende der Leitung sein. Aber es war Philipp Stein aus der Berliner Redaktion.
„Caro, ich wollte mal hören, wie es dir so geht! Was machst du? Wie ist Rondorf? Julie hat mir erzählt, du hättest schon ein Apartment gefunden. Ich soll dir Grüße von Michael bestellen.“
Philipp redete wie ein Wasserfall auf mich ein und schien weniger an meinen Antworten als an seinen eigenen Fragen interessiert. Endlich fand ich eine Gelegenheit, ihn zu unterbrechen: „Phil, jetzt mach‘ mal halblang. Wie soll ich so viele Fragen auf einmal beantworten?“
Philipp lachte glucksend und bat mich zu erzählen, wie es mir bisher ergangen war. Ich versuchte, meine Enttäuschung so neutral wie möglich zu formulieren.
„Carolinchen, Carolinchen, das hört sich an, als müsstest du nun doch endlich erwachsen werden.“
Ungehalten maulte ich: „Ich bin erwachsen! So ein dämlicher Kommentar ist das Letzte, was ich zur Zeit gebrauchen kann. Was bist du, mein Freund oder Rondorfs Komplize?“
„So war das nicht gemeint. Du weißt doch, wie sehr ich deine Arbeit schätze. Ich wollte nur sagen, dass du in Indien sicher viel lernen wirst“, fügte er schnell hinzu, aber zu spät. Seine Worte hatten mich an meiner empfindlichsten Stelle getroffen, und das wussten wir beide. Schlagartig fühlte ich mich von meiner Angst, meiner Schwäche und meiner Einsamkeit überwältigt. Ich hörte mich in den Hörer jammern: „Phil, kannst du nicht bald mit Julie herkommen? Ich fühle mich so allein. Rondorf ist ein Ekel. Ich brauche jemanden zum Reden, richtig, nicht nur am Telefon.“
„Ich werde mit Julie reden. Mal sehen, was sich machen lässt. Aber du weißt ja, der Job lässt mir nicht viel Zeit für private Reisen.“
Ich spürte einen fetten Kloß im Hals. Um die Fassung zu wahren, beendete ich das Gespräch abrupt – und bereute es sofort. Bald würde ich vom Alltag meiner Berliner Freunde so weit entfernt sein, dass ich nicht mehr in der Lage war, Freuden, Hoffnungen, Sorgen und Befürchtungen mit ihnen zu teilen. Schon jetzt hatte ich das Gefühl, dass mein neues Leben Philipp so fremd war, dass ich über die für mich wichtigsten Ereignisse gar nicht mit ihm gesprochen hatte.