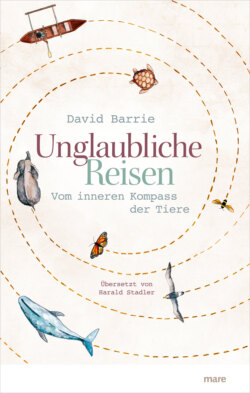Читать книгу Unglaubliche Reisen - David Barrie - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5. KAPITEL Tanzende Bienen
ОглавлениеNeben Konrad Lorenz (1903–1989) und Nikolaas Tinbergen (1907–1988) war Karl von Frisch (1886–1982) einer der Gründerväter der Ethologie, der vergleichenden Verhaltensforschung. Das außergewöhnliche Werk dieses unermüdlich arbeitenden Trios wurde 1973 mit der Verleihung eines gemeinsamen Nobelpreises gewürdigt. Ihre vielleicht beeindruckendste und sicherlich bekannteste Leistung war die Entdeckung der Tanzsprache von Honigbienen, deren Erforschung allerdings viele Jahre in Anspruch nahm.1
Honigbienen erkunden das Umfeld ihrer Stöcke auf der Suche nach dem Nektar und den Pollen, die die Lebensgrundlage des Bienenvolks bilden, und legen bei ihren Sammelflügen Entfernungen von bis zu zwanzig Kilometern zurück. Karl von Frisch untersuchte, wie Bienen zwischen verschiedenen Blüten unterscheiden, und richtete sie darauf ab, Schälchen mit Zuckerlösung aufzusuchen, als Ersatz für den Nektar, mit dem sie sich für ihre langen Flüge stärken.
Dabei machte von Frisch eine verblüffende Beobachtung. Er stellte fest, dass die Bienen gelegentlich zu einer leeren Schale zurückkehrten, so als wollten sie überprüfen, ob sie wieder aufgefüllt worden war; und wenn er tatsächlich Zuckerwasser nachgefüllt hatte, tauchten in erstaunlich kurzer Zeit zahlreiche weitere Bienen an der Futterstelle auf. Es schien, als wüssten sie irgendwie, was er getan hatte.
Im Jahr 1919 lieh sich von Frisch einen speziellen Bienenstock aus, bei dem er durch eine Glasscheibe beobachten konnte, wie sich die Bienen im Inneren verhielten – auf der vertikalen Oberfläche der Honigwabe. Er brachte ein paar Bienen dazu, an einem Napf in der Nähe Nahrung aufzunehmen, und markierte sie dabei mit roten Farbpunkten. Dann wartete er, bis das Schälchen leer war, bevor er es wieder auffüllte. Nur kurze Zeit später kam eine der dressierten und farblich markierten Bienen zu dem Gefäß und flog schließlich zu ihrem Stock zurück.
Als von Frisch das Verhalten der Biene beobachtete, traute er seinen Augen nicht: Es war »so entzückend und fesselnd«. Die Biene schwirrte auf der Oberfläche der Wabe umher und wackelte dabei mit ihrem Hinterleib; die anderen Bienen sahen sich aufgeregt nach ihr um und berührten ihren Hinterleib mit den Fühlern. Wenn eine der gekennzeichneten Bienen in der Menge war, machte diese sich sofort auf den Weg zu der Futterschale, aber schon bald tauchten dort auch viele der nicht markierten Bienen auf.
Anfangs vermutete von Frisch, dass die Rekruten einem Kundschafter zu der Nahrungsquelle folgten, doch er konnte keinerlei Belege für diese These finden. Also richtete er seine Aufmerksamkeit – wie Fabre und Lubbock vor ihm – auf den Geruchssinn. Er dressierte die Bienen, sich an Näpfen zu bedienen, die auf stark duftenden Oberflächen standen; Gerüche wie etwa Pfefferminze oder Bergamotte blieben sicherlich an ihren Füßen und Körpern haften.
Die rekrutierten Bienen zeigten eine starke Vorliebe für Futterorte, die mit diesen Düften gekennzeichnet waren. Später führte von Frisch ähnliche Experimente im Innern eines Gewächshauses durch und benutzte dabei echte Blüten statt Schälchen mit Zuckerlösung. Die Versuche lieferten dieselben Ergebnisse. Er folgerte daraus, dass die Bienen mit ihren Tänzen ihre Artgenossen im Stock sowohl auf das Vorhandensein von Nahrung als auch auf deren Qualität aufmerksam machten. Von Frisch vermutete zu Recht, dass die Rekruten daraufhin die neue Nahrungsquelle ausfindig machten, indem sie einfach nach der Quelle jenes Geruchs suchten, den sie am Körper der Tänzerin wahrgenommen hatten.
Dass Bienen in der Lage sind, miteinander zu kommunizieren, war eine bahnbrechende Erkenntnis. Vielen Wissenschaftlern fiel es zwar schwer zu glauben, dass Insekten so raffiniert sein können; doch Karl von Frisch war aufgrund der Qualität seiner Arbeit – und der geistreichen Vorträge, Bücher und Filme, durch die er sein Werk verbreitete – eine weltbekannte Persönlichkeit geworden, bevor 1939 der Zweite Weltkrieg begann. Sein Ruf schützte ihn jedoch nicht vor den üblen Machenschaften des Naziregimes. Als jemand aufdeckte, dass von Frischs Urgroßeltern Anfang des 19. Jahrhunderts vom Judentum zum Christentum konvertiert waren, geriet der Wissenschaftler in Konflikt mit den antisemitischen Dekreten der Nazis und drohte seine Professur an der Universität München zu verlieren. Er konnte seine Stellung nur behalten, weil er mit seinen Untersuchungen zur Steigerung der Honigerzeugung einen wichtigen Beitrag für die Ernährung der Bevölkerung während der Kriegsjahre leistete.
Doch das Leben war hart: 1944 trafen die Bombenangriffe der Alliierten auch München. Das Haus und die Bibliothek des Professors wurden zerstört, ebenso sein kurz zuvor eingerichtetes Labor. Glücklicherweise fand er mit seiner Familie und einigen seiner Studenten Zuflucht auf seinem schönen Landgut in Brunnwinkl am Fuß der österreichischen Alpen unweit von Salzburg. Die Landung der Alliierten im Juni 1944 und die darauffolgenden Kämpfe in Nordfrankreich bildeten den düsteren Hintergrund, vor dem von Frisch und seine Kollegen eine bedeutsame Beobachtungsreihe starteten, die ihn veranlasste, seine ursprüngliche Theorie über die Bedeutung des Bienentanzes abzuändern und weitaus detaillierter auszuarbeiten.
Das Wetter im August 1944 war ideal für Bienenstudien. Eine Kollegin des Forschers führte ein Experiment durch, mit dem Bienen angeregt werden sollten, mehr Honig zu erzeugen und mehr Blüten zu bestäuben, indem sie zu besseren Nektarquellen an entfernteren Standorten geführt wurden. Von Frisch schlug seiner Kollegin vor, die Bienen darauf abzurichten, einen parfümierten Napf in der Nähe ihres Stocks aufzusuchen und das Gefäß dann an einer anderen, ferneren Stelle zu platzieren.
Seiner lange vertretenen Theorie zufolge durfte man darauf vertrauen, dass die Bienen den Napf an der neuen Position auffinden konnten. Dafür müssten sie einfach nur die Quelle des ihnen bekannten Duftes aufspüren. Aber von Frisch staunte nicht schlecht: Nachdem der Napf umgestellt worden war, tauchte keine einzige Biene auf, und die Kollegin stand ratlos da.
Im Laufe jenes Sommers dressierte von Frisch die Bienen, zu duftmarkierten Nahrungsquellen zu fliegen, von denen einige sehr nah am Stock platziert waren und andere bis zu 300 Meter entfernt. Er beobachtete Folgendes: Wenn die Kundschafter konditioniert waren, eine entfernte Nahrungsquelle aufzusuchen, flogen ihre Rekruten häufig direkt dorthin – und ignorierten eine viel nähere Stelle, auch wenn diese mit demselben Geruch gekennzeichnet war. Dieses Verhalten kam von Frisch sehr merkwürdig vor. Entgegen seiner ursprünglichen Theorie schien es so, als suchten die Rekruten nicht bloß irgendeine Nahrungsquelle, die »richtig« roch; sie spürten vielmehr aktiv eine entferntere Stelle auf und ignorierten dabei eine nähere. Von Frisch vermerkte in seinem Notizbuch lakonisch, dass es so wirkte, als seien die Bienen zu einer Art Verständigung über Entfernungen imstande.
Als von Frisch die Möglichkeit ausschloss, dass die Bienen einer ätherischen Duftspur folgten, wurde klar, dass sie tatsächlich auf Informationen zu Entfernungen reagierten. Darüber hinaus schienen sie auch Vorlieben für bestimmte Richtungen zu zeigen. Konnte es sein, dass die Tänze der Kundschafter nicht nur Angaben zur Qualität einer Futterquelle vermittelten, sondern auch die Richtung und die Entfernung zum Bienenstock verrieten?
Nach dem Krieg setzte von Frisch alles daran, diese faszinierenden Fragen zu beantworten. Mithilfe eines Farbmarkierungscodes, der es ihm ermöglichte, zahlreiche einzelne Kundschafter zu unterscheiden, wies er nach, dass die Geschwindigkeit des Tanzes tatsächlich eng mit der Entfernung der zuletzt besuchten Futterquelle korrelierte.
Bereits im Sommer 1945 hatte er einige Beobachtungen gemacht, die sogar noch verblüffender waren. Die Bienen, die am Nachmittag von einer bestimmten Nahrungsquelle zurückkehrten, bewegten sich bei ihrem Schwänzeltanz mit dem Kopf nach unten über die Oberfläche der Wabe, doch ihre Richtung änderte sich im Lauf des Tages allmählich – in Übereinstimmung mit dem sich verändernden Sonnenazimut.
Als Nächstes untersuchte von Frisch, in welchem Verhältnis die Richtung des Tanzes zu den Positionen der Futterquellen stand, die er in den vier Himmelsrichtungen – Nord, Ost, Süd und West – um den Stock herum aufgestellt hatte. Die Ergebnisse waren wahrlich verblüffend. Die Richtung des Tanzes spiegelte durchweg die Beziehung zwischen der Richtung der Futterquelle und dem Sonnenazimut wider. Frisch fasste seine Erkenntnisse folgendermaßen zusammen: »Tanzrichtung genau nach oben bedeutet: Du musst in der Richtung des Sonnenstandes fliegen, um zur Trachtquelle zu kommen. Schwänzellauf kopfunten heißt, genau von der Sonne fort führt der Weg zur Futterstelle.«2
Das war nicht nur der klare Beweis für eine Form von Himmelsnavigation bei einer Insektenart, sondern vor allem auch dafür, dass die Kundschafter ihren Artgenossen Informationen über den Standort einer Nahrungsquelle mitteilen konnten.
Anschließend stellte von Frisch einen Bienenstock in einer eigens konstruierten Hütte auf, damit er die für die Bienen verfügbaren visuellen Informationen systematisch manipulieren konnte, während sie ihren Schwänzeltanz vollführten. Wenn er kein Sonnenlicht in die Hütte eindringen ließ (die dann für den Beobachter mit – für die Bienen unsichtbarem – Rotlicht beleuchtet wurde), zeigten sich die Tiere vollkommen desorientiert. Schaltete er jedoch eine Taschenlampe an, richteten die Bienen ihre Tänze sofort so aus, als handelte es sich um die Sonne – genau wie Lubbocks Ameisen. Und indem von Frisch den Taschenlampenstrahl herumschwenkte, brachte er die Bienen dazu, in jede von ihm gewählte Richtung zu tanzen.
Dann bemerkte er, dass die Bienen ihre Tänze manchmal korrekt auszurichten vermochten, auch wenn sie nur ein kleines Stück vom Himmel sehen konnten. Und so ging er ähnlich vor wie Santschi bei seinen viel früheren Experimenten mit den Wüstenameisen (von denen er damals allerdings nichts wusste): Er brachte im Dach ein Ofenrohr an, sodass die Bienen nur einen kleinen Kreisausschnitt des Himmels ohne Sonne sahen. Solange der Himmel klar war, konnten die Bienen korrekt tanzen, aber sie wurden orientierungslos, wenn Wolken über den Lichtkreis zogen. Als Nächstes versuchte von Frisch, den Bienen durch die Öffnung ein zurückgespiegeltes Bild des Himmels zu zeigen, und stellte dabei fest, dass die Ausrichtung der Tänze umgekehrt wurde.
Als von Frisch diese rätselhaften Erkenntnisse mit Physikern erörterte, lieferten diese eine mögliche Erklärung. Sie äußerten die Vermutung, die Bienen könnten sensibel für die Polarisation des Sonnenlichts sein.3
Seit Langem war bekannt, dass das Licht der Sonne aus elektrischen und magnetischen Wellen besteht, die im rechten Winkel zueinander schwingen. Jede mögliche Ausrichtung dieser Wellen erscheint im Sonnenlicht, solange es luftleeren Raum durchdringt; wenn es aber die Erdatmosphäre durchquert, werden einige seiner Bestandteile herausgefiltert. Dieser Prozess wird als Polarisation bezeichnet. Die charakteristischen Muster am Himmel, die dabei entstehen, nennt man fachsprachlich »E-Vektoren« (abgekürzt für »elektrische Vektoren«). Mit bloßem Auge können wir diese Muster nicht sehen, aber mithilfe von Polarisationsfiltern bekommen wir eine vage Vorstellung davon, wie sie womöglich für Tiere aussehen, die sie wahrnehmen können.
Das Band der stärksten Polarisation an einem wolkenlosen Himmel mit der Sonne im Rücken
Versuchen Sie einmal, sich an einem wolkenlosen Vormittag mit dem Rücken zur Sonne zu stellen. Setzen Sie nun eine Sonnenbrille mit Polarisationsfilter auf. Wenn Sie direkt nach oben in den Himmel blicken, sollten Sie einen dunkelblauen Streifen sehen können, der vom linken zum rechten Rand des Horizonts verläuft. Sobald Sie sich nun langsam um neunzig Grad drehen, egal ob nach links oder nach rechts, werden Sie feststellen, dass sich der dunkle Streifen allmählich aufhellt. Er markiert den Bereich der stärksten Polarisation, und seine Ausrichtung am Himmel hängt vom Azimut der Sonne ab.
Von Frisch kam zu folgendem Schluss: Wenn die Bienen diese Muster wahrnehmen können, ist es überhaupt nicht nötig, dass sie die Sonne selbst sehen; die E-Vektoren allein ermöglichen es ihnen, den Sonnenazimut zu ermitteln. Diese These konnte er schon bald mithilfe von polarisierenden Filmen beweisen, die er während einer Vortragsreise durch die Vereinigten Staaten von Edwin Land, dem Erfinder der Polaroid-Kamera, erhielt.4