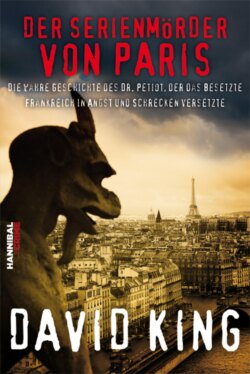Читать книгу Der Serienmörder von Paris - David King - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеMEIN LIEBER KOMMISSAR, ICH BENEIDE IHRE ERMITTLER NICHT, DENN SIE MÜSSEN DEN ÜBERRESTEN NAMEN GEBEN.
(Dr. Albert Paul)
Die Pariser Zeitungen schlachteten die Geschichte des Monsters aus dem eleganten 16. Arrondissement nach allen Regeln der Kunst aus. Marcel Petiot wurde als „der neue Landru“ tituliert, nach dem berüchtigten französischen Mörder, den man 1921 schuldig gesprochen hatte, elf Menschen getötet zu haben, zehn davon waren seine Geliebten. Le Petit Parisien wählte für diese auflagensteigernde Umschreibung am Montag, dem 13. März, eine Schlagzeile mit einer Buchstabengröße von fast fünf Zentimetern. Auch der L’Oeuvre nutzte die Titulierung an diesem Morgen und berichtete, dass 25 oder möglicherweise 30 Frauen in dem Beinhaus getötet oder „bei lebendigem Leibe verbrannt“ worden waren. L’Oeuvre und die zahlreichen Mistreiter auf dem Zeitungsmarkt der Hauptstadt lieferten sich einen wahren Wettstreit in der farbenprächtigsten Beschreibung des Mörders als eines sadistischen Triebtäters, der Frauen bis aufs Blut quälte, bevor er ihren letzten Überlebenskampf durch einen Spion beobachtete und sie nach dem Eintreten des Todes zerstückelte.
Le Matin betonte insbesondere die „dämonische und erotische“ Natur des Verbrechens. Alle in der Rue Le Sueur entdeckten Leichen – abgesehen von den zerstückelten, verbrannten oder durch den Löschkalk unkenntlich gewordenen Überresten – waren nackt. Wann hatte der Mörder seinen Opfern die Kleider ausgezogen? War es bevor oder nachdem er sie gefesselt an die Haken der schalldichten Zelle gehängt hatte? Um die Vorstellungskraft der Leser anzuregen und ihnen wahre Alpträume zu verkaufen, berichtete die Zeitung, dass Dr. Petiot eine furchterregende Maske trug, während er die Opfer quälte und sie daraufhin umbrachte.
Die von den Deutschen kontrollierte französische Presse berichtete über den Petiot-Fall für den Heimatmarkt, wohingegen die staatliche deutsche Nachrichtenagentur Deutsches Nachrichtenbüro (DNB) die Meldung über die „verkohlten und verstümmelten Skelette von 25 Frauen“, gefunden auf dem Grundstück des Arztes, international verbreitete. Fast jede Nacht berichtete das Organ detailliert über Petiot, der mit seinem Fahrrad in das leere Haus nahe des Triumphbogens gefahren war, um seinem bestialischen Handwerk nachzugehen, nämlich die Grube bis an den Rand mit Leichen zu füllen und den aus dem Schornstein aufsteigenden übelkeitserregenden Rauch zu verursachen.
Das DNB, wie auch die Pariser Presse, berichtete gelegentlich, dass Georgette Petiot von den Aktivitäten ihres Mannes gewusst oder ihn sogar dabei unterstützt hatte. Manchmal wurde sie aber auch als Ehefrau dargestellt, die nichts von dem Doppelleben ihres Gatten ahnte. Meist charakterisierte die von den Deutschen kontrollierte Presse Petiot als Raubtier, das es besonders auf Frauen abgesehen hatte. Sie beschrieben einen Arzt, der seine Frau zu Hause zurückließ und sich zu nächtlichen Rendezvous in der Rue Le Sueur aufmachte. Die Nachbarn schauten weg, da sie nichts von der vermeintlich romantischen Liaison wissen wollten.
Die weiblichen Besucher des Hauses, von denen angenommen wurde, sie seien „zwielichtige Damen der Pariser Halbwelt“, wollten angeblich Heroin, Kokain oder ein anderes Narkotikum. Doch sie erhielten nicht „den weißen Puder des Vergessens, sondern begegneten dem Tod höchstpersönlich“. Schnell folgerte man, dass Petiot den Frauen tödliche Substanzen in die Vene injizierte. Es war allerdings nicht klar, ob es sich um eine noch zu identifizierende Droge handelte, um die Überdosis eines Generikums oder eventuell eine selbsterfundene Mischung.
Wegen seiner guten Beziehungen gelang es Karl Schmidt, einem deutschen Journalisten des DNB, als einem der ersten, durch die dreieckige Kammer geführt zu werden. Er spekulierte, dass der Schlächter seine Opfer unter Drogen setzte, sie dann in den Raum zerrte, wo er sie fesselte und an die Haken der hinteren Wand hängte. Der Mörder richtete danach den Strahl zweier Scheinwerfer auf ihre Gesichter und beobachtete „die Qualen bis zum letzten Aufbäumen“. Vorher hatte der Arzt, dabei seine medizinischen Fähigkeiten einsetzend, sie immer weiter malträtiert, wahrscheinlich, um die Schmerzen so lange wie möglich erträglich zu machen. Danach zerstückelte er „den in sich verkrümmten Körper“ und warf die Teile in die Grube mit dem Löschkalk.
Massu wollte sich nicht zu voreiligen Schlüssen hinreißen lassen. Bekannt für seine Vorsicht, zog er eine behutsame Vorgehensweise vor und baute den Fall Stück für Stück auf, um Fehler zu vermeiden, die durch ein schnelles und oberflächliches Handeln entstehen konnten. Er war skeptisch, speziell wenn die Beweise zu klar oder offensichtlich erschienen.
„Ich habe schon oft erklärt“, meinte Massu gegenüber Canitrot, dem Sekretär der Mordkommission, „dass man sich hüten sollte, aus den offensichtlichen Beweisen voreilige Rückschlüsse zu ziehen.“ Wenn Polizisten ihre Theorie zu schnell auf „solchen Beweisen“ aufbauten, verfingen sie sich meist in einem undurchdringlichen Dickicht, mit möglicherweise „katastrophalen“ Folgen. Das fundamentale Problem, das sich jeder Ermittler vor Augen halten müsse, bestünde in der Interpretation der Beweise. Einerseits war Massu erleichtert, von der Gestapo unmissverständliche Instruktionen zu erhalten, dabei hoffend, dass sie der Ermittlung nicht in die Quere kamen oder sie behinderten. Doch andererseits sorgte er sich auch. Es kam selten vor, dass die Gestapo sich augenblicklich für einen französischen Kriminalfall interessierte. Wenn die Geheimpolizei sogar eine unverzügliche Verhaftung befahl, geschah das meist, um einen Täter dingfest zu machen, dessen Verbrechen schwerer wogen als eine oppositionelle Haltung gegenüber dem Regime. Bedeutete das womöglich, dass der Besitzer des Hauses in der Rue Le Sueur Nummer 21 die Résistance unterstützte?
Ohne zu übertreiben, konnte man den Fall als zutiefst verwirrend bezeichnen. Gegenüber den Gräueltaten des berüchtigten Serienmörders Henri Landru oder den erst kurz zuvor stattgefundenen Morden von Eugen Weidmann war es nicht exakt nachzuvollziehen, wie Petiot oder der Mörder seine Opfer getötet hatte. Es ließen sich weder Stichverletzungen noch Hämatome feststellen. Die Körper der Opfer im Keller wiesen keine Blutspuren auf. Auch an weiteren Stellen im Haus fanden sich keine Blutspuren. Wie der Journalist Jacques Perry es ausdrückte, gab es viele Leichen, doch keinen Hinweis auf einen Mord.
Am Morgen des 13. März setzte sich dann eine Verkäuferin des Warenhauses Grand Magasins du Printemps am Boulevard Haussmann mit der Polizei in Verbindung, um ihre Geschichte zu erzählen: „Ich wäre beinahe umgebracht werden“, sagte sie mit sich überschlagender Stimme. Ihr Apotheker hatte sie am 11. März – wegen eines verstauchten Handgelenks – zu Dr. Petiot überwiesen. Petiot sah eher wie ein Maurer aus und nicht wie ein Arzt, denn sein Anzug war stark mit Kalk verdreckt.
„Mir lief ein kalter Schauer den Rücken herunter“, beschrieb sie ihren Gemütszustand beim Anblick Petiots, der sie während der Untersuchung des Handgelenks mit durchdringenden Augen anstarrte.
„Seine schwarzen Augen bohrten sich förmlich in meinen Körper. Ich dachte, er ist verrückt.“ Petiot röntgte die Hand, diagnostizierte eine Verstauchung und riet ihr wegen des fragilen Knochenaufbaus zu einer zusätzlichen Calcium-Einnahme. Er verschrieb eine Behandlung. Da er in der Praxis nicht über die notwendigen Instrumente verfügte, schlug er ihr eine „Spezialklinik“ vor. Sie lag in der Rue Le Sueur Nummer 21.
Obwohl es sicherlich nicht einfach war, wertvolle Informationen aus dem Geknäuel an Gerüchten und Anschuldigungen, die ihn erreichten, zu extrahieren, besaß Massu doch schon einige wertvolle Spuren. Die dringlichste Aufgabe bestand im Moment in der Verhaftung des Arztes. Der naheliegendste Aufenthaltsort war die Adresse, die Petiot auf dem Zettel in der Rue Le Sueur angegeben hatte und an die ihm die Post nachgestellt werden sollte: Rue des Lombards Nummer 18, Auxerre, das nur 150 Kilometer von Paris entfernt lag, in der burgundischen Region von Yonne. Bei näherer Untersuchung des Zettels fand Massu heraus, dass der Arzt zuerst eine andere Adresse aufgeschrieben, dann ausradiert und die neue in einer anderen Handschrift darübergeschrieben hatte. Ursprünglich stand dort nämlich Rue du Pont, Auxerre 55 oder 56.
Massu bat einen der Assistenten, die Reisevorbereitungen zu erledigen. Während der Besatzungszeit gab es nur einen unregelmäßigen und unzuverlässigen Fahrplan, und der nächste Zug war erst in einigen Tagen eingeplant. Doch Massu wollte natürlich nicht warten. Er rief einen Freund vom Fuhrpark der Polizeipräfektur an und sicherte sich für die Reise das Automobil Nummer 3313 inklusive genügend Treibstoff, der bei der strengen Rationalisierung nicht leicht erhältlich war, sogar für einen Leiter der Mordkommission. Sein Sekretär und zwei Inspektoren begleiteten ihn. Um 6 Uhr morgens befanden sich die vier schon auf der Fahrt nach Auxerre.
Massu beschäftigte sich immer noch mit der Frage, wie der Mörder seine Opfer ausgewählt hatte, wie er sie sodann in das Stadthaus lockte und – so stellte er sich das schreckliche Szenario vor – wie er ihnen die lange Nadel in eine Vene stach, um die tödliche Injektion zu verabreichen. Danach zerhackte er die Körper, entledigte sich der inneren Organe und warf die Überreste in die Grube mit dem Kalk. Der Löschkalk entzog den Leichenresten aufgrund seiner spezifischen Eigenschaften das Wasser, wodurch der Täter sie später leichter verbrennen konnte. Massus Verdacht klang, wie er selbst einräumte, „grauenhaft und eiskalt wie die Geschichten von Edgar Allan Poe“.
Der Kommissar musste unbedingt herausfinden, wer dem Arzt den Löschkalk verkauft hatte und wer ihm bei der schrecklichen Arbeit geholfen hatte. Eines stand fest: Der Doktor – oder wer auch immer der Mörder war – konnte nicht so viele Menschen allein umgebracht haben. Und eine weitere Frage drängte sich auf: Wie gelang es dem Täter, sich der Aufmerksamkeit der Nachbarn zu entziehen? Massu war noch weit davon entfernt, den Fall zu verstehen, ganz abgesehen davon, den Mörder zu finden und genügend Beweise zu seiner Verurteilung vorzulegen. Zum ersten Mal während seiner langen Dienstzeit plagten Massu Schlafprobleme.
„Chef“, fragte der Sekretär während der Fahrt, „stimmt es, wie so geredet wird, dass in der Praxis in der Rue Caumartin Schnitzereien mit dem Antlitz des Teufels gefunden wurden?“
„Ja, da gab es aber noch viel interessantere oder schlimmere Entdeckungen, je nachdem, wie man es sieht.“ Der Kommissar wollte sich nicht näher dazu äußern, sondern nuschelte nur etwas von „bestialischen, obszönen und schweinischen Zeichnungen“, die bei Petiot entdeckt worden seien.
„Ist der Doktor ein Drogensüchtiger?“, fragte ein Inspektor und griff damit ein weiteres Gerücht auf.
„Das kann man beinahe mit Bestimmtheit sagen“, antwortete Massu, eventuell ein wenig vorschnell. Drogen waren eine naheliegende, aber allzu leichte Erklärung, warum sich ein bei Tageslicht respektierter und angesehener Arzt in der Nacht in ein Monster verwandelte.
Vor der Ankunft in Auxerre machten die Ermittler einen Zwischenstopp in Villeneuve-sur-Yonne, der Stadt, in der Petiot das Amt des Bürgermeisters bekleidete. Oberinspektor Marius Battut und Inspektor Rochereau suchten zuerst das ehemalige Haus des Mordverdächtigen in der Rue Carnot 56 auf. Der derzeitige Bewohner, ebenfalls Arzt, erzählte ihnen, dass Petiot dort bis zum Juli 1934 wohnhaft war. Er hatte Petiot nur ein einziges Mal gesehen und sich nicht weiter mit ihm unterhalten. Der neue Besitzer, so vermerkte Battut, „wollte keine interessanten Informationen liefern“.
Die Gendarmen der Polizeiwache in Villeneuve-sur-Yonne waren hingegen hilfsbereiter. Sie erzählten ihren Kollegen, dass Petiot „einen sehr schlechten Ruf“ genoss. Während seiner Amtszeit als Bürgermeister sei er in den Verdacht geraten, mehrere Diebstähle begangen zu haben, darunter Kanister mit Öl und Treibstoff. Einmal wurde er beschuldigt, die Elektrizitätswerke betrogen zu haben, indem er den Zähler in seinem Haus manipulierte. Darüber hinaus erfuhren die Pariser Ermittler, dass eine seiner Geliebten unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen war.
Am 11. März 1930, 14 Jahre vor der Entdeckung in der Rue Le Sueur, ließ sich Armand Debauve, der Besitzer einer Molkereigenossenschaft vor den Toren von Villeneuve-sur-Yonne ein Gläschen Wein in Frascots Bistro schmecken. Um ungefähr 20 Uhr kam ein aufgeregter Bewohner angerannt: Die Molkerei brenne! Debauve kehrte auf dem schnellsten Weg nach Hause zurück. Auch das Privathaus stand in Flammen, und seine Frau lag – wie ihm die Feuerwehrmänner berichteten – tot auf dem Boden der Küche, den Kopf mit Blut verschmiert.
Die Ermittler fanden schnell heraus, dass das Feuer absichtlich gelegt worden und das Opfer, die 54-jährige Henriette Debauve, durch mehrere Schläge mit einem stumpfen Gegenstand auf den Kopf ums Leben gekommen war. Die Größe der Wunden wies auf einen Hammer hin. Unter den gestohlenen Gegenständen befand sich exakt ein solches Werkzeug.
Nicht lange nach dem Unglück sahen Nachbarn, wie Bürgermeister Petiot mit seiner Frau zu der Ruine des Bauernhauses fuhr. Er kam wohl – wie Augenzeugen anfänglich vermuteten –, um der Familie des Opfers sein Beileid auszusprechen. Für einen erfahrenen Arzt und Weltkriegsveteranen wirkte er allerdings merkwürdig beunruhigt, ja sogar nervös. Dann, und das erstaunte die Zeugen, stieg er recht bald wieder in den Wagen und fuhr nach Sens, um mit seiner Frau ins Kino zu gehen.
Petiot hatte das Opfer mit Sicherheit gekannt. Die beiden waren einander vor einigen Jahren von „dem alten Frascot“ vorgestellt worden, der schon zuvor den Kontakt zwischen Petiot und dessen Geliebter Louisette Delaveau hergestellt hatte. Frascot traf sich sogar einige Male mit dem Doktor und Henriette zum Abendessen. Die beiden schienen sich ineinander verliebt zu haben. Sie wurde seine Patientin und – so glaubten es zumindest die Ermittler – mit ziemlicher Sicherheit seine Mätresse.
Den Fall kennzeichneten viele Auffälligkeiten: Das Feuer brach an einem Dienstag aus, als Debauves Mann in ein Bistro gegangen war. Es handelte sich um den zweiten Dienstag im Monat – tags darauf bezahlte die Molkerei den Bauern immer die gelieferte Milch. Der Safe wurde unter Gewalteinwirkung geöffnet. Allerdings fand der Täter dort kein Geld vor, da Debauve es bereits früher am Tag unter dem Küchenschrank versteckt hatte.
Interessanterweise gelang es der Polizei, deutlich erkennbare Fingerabdrücke auf einem Brandeisen sicherzustellen, das aus dem Schuppen entwendet und mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Aufbrechen des Safes benutzt worden war. Die Beamten sicherten die Fingerabdrücke der 21 Angestellten, doch sie stellten keine Übereinstimmung fest. Als man Petiot um seine Fingerabdrücke bat, weigerte der sich zuerst standhaft. Robert Seguin, sein Nachfolger im Amt des Bürgermeisters von Villeneuve-sur-Yonne, beschrieb den Tumult, der ausbrach, als Petiot schließlich nachgab. Er verlor seine Haltung und riss wutentbrannt eine Seite aus dem Buch des Einwohnermeldeamts. „Zornig presste er die Finger in die Tinte, drückte sie auf das unersetzliche Papier und keifte: ‚Macht doch, was ihr wollt. Das bringt nichts – das werdet ihr schon sehen.‘“ Petiot stürmte daraufhin aus dem Amtszimmer und knallte die Tür zu.
Massu bat die Ermittler der Brigade Mobile von Dijon um die Akte des Debauve-Mordes, doch niemand fand sie. Das erregte das Misstrauen der Beamten. Schnell gab es wilde Spekulationen, und viele glaubten, dass der Bürgermeister seinen Einfluss geltend gemacht hatte, um sie zu vernichten. Jahre darauf wurde das Dossier durch einen Zufall dann doch gefunden. Es war nicht unter dem Buchstaben D für Debauve eingeordnet worden, sondern unter M für Mord. Es war erstaunlich dünn und enthielt weder Vernehmungsprotokolle noch einen Hinweis über Petiots Erscheinen am Tatort.
Verständlicherweise erregte ein Verbrechen solchen Ausmaßes die Aufmerksamkeit nicht nur der Polizei, sondern auch der Presse und der Einwohner. Ein freier Mitarbeiter des Lokalblatts Le Petit Régional verfügte über erstaunlich viele Informationen. Durch seine Recherchearbeit vervollständigte sich das Bild, was sogar die Ermittler verblüffte. Neben einigen bedeutenden Erkenntnissen eher theoretischer Natur fand er die Tatwaffe, also den Hammer, in einem kleinen Flüsschen in der Nähe der Molkerei. Der Täter hatte ihn dort mit hoher Wahrscheinlichkeit hineingeworfen, damit die Fingerabdrücke durch den sich bildenden Rost unkenntlich werden. Der freie Mitarbeiter ließ seine Reportagen stets inkognito drucken. Seine Identität wurde erst 1945 enthüllt. Es war Marcel Petiot.
Frascot behauptete damals, dass er exklusive Informationen zu dem Fall habe, und er deutete an, Petiot vor dem Feuer bei der Molkerei gesehen zu haben, womit er indirekt empfahl, dass die Jagd auf den Mörder im Büro des Bürgermeisters beginnen sollte.
Was genau Frascot über den Tatabend wusste, wird wohl niemals enthüllt werden, denn wenige Wochen nach Debauves gewaltsamen Tod traf er sich mit Petiot an der Bar des Hôtel du Dauphin. Während des Gesprächs klagte er über einen schmerzhaften Rheumaschub. Petiot erzählte ihm von einem neuen, bahnbrechenden Medikament, das die Symptome mit hoher Sicherheit lindere, wenn nicht sogar vollständig kuriere. Um dem alten Freund einen Gefallen zu erweisen, bot ihm der Arzt eine kostenlose Injektion an. Die beiden begaben sich auf den Weg zu Petiots Praxis, die die Straße hinab lag. Drei Stunden später war einer der wichtigsten Zeugen im Mordfall tot.
Dem offiziellen Autopsiebefund zufolge war die Todesursache Frascots ein Aneurysma, verursachte durch „einen Unfall … einen plötzlich verlangsamten Herzschlag oder eine nicht bekannte Nebenwirkung einer subkutanen Injektion“. Das lag sicherlich im Bereich des Möglichen, doch der Doktor, der die Autopsie durchführte und die Sterbeurkunde unterzeichnete, war Villeneuve-sur-Yonnes Gerichtsmediziner. Und diese Position – wie Massu voller Erstaunen und Entsetzen feststellte – wurde von einem gewissen Dr. Marcel Petiot besetzt.
Nach einer Beerdigung auf dem Passy-Friedhof kehrten die Totengräber in Petiots Haus zurück. Sie bargen die Knochen und verwesende Körperteile aus der ausgetrockneten Grube, legten sie in hölzerne Behälter, die entfernt an Särge erinnerten und ließen sie zum gerichtsmedizinischen Institut am Place de Mazas im 12. Arrondissement transportieren.
Das Institut Médico-Légal (IML) war eines der berühmtesten forensischen Laboratorien weltweit. Nachdem das IML 1914 aus dem ehemaligen Gebäude gleich hinter Notre Dame am Place de Mazas gezogen war, hatte es sich von der ursprünglichen Funktion eines Leichenschauhauses zu einer fortschrittlichen Institution entwickelt, die die Rolle der Wissenschaft im Rahmen kriminalistischer Untersuchungen revolutionierte. Alphonse Bertillon war einer der berühmtesten und innovativsten Ermittler, ein früher Verfechter des sogenannten „anthropometrischen“ Ansatzes, mit dessen Hilfe Individuen durch spezifische eindeutige Messergebnisse identifiziert werden konnten.
Die französischen Gesetze des 19. Jahrhunderts differenzierten zwischen Erst- und Wiederholungstätern, wobei man die Ersttäter eher milde bestrafen konnte, was meist auch geschah. Um diesen Vorteil auszunutzen, legten sich Kriminelle oft verschiedene Namen zu, womit sie – im Fall, dass der Betrug nicht aufgedeckt wurde – immer wieder als Ersttäter galten. Nach Bertillons Methode identifizierte man jeden Verbrecher nun ein für alle Mal anhand von elf Punkten: Größe, Länge der ausgestreckten Arme, Höhe und Breite des Kopfes, Länge des Fußes, des Mittelfingers, des kleinen Fingers, des Armes vom Ellbogen bis zum Mittelfinger und weiteren Merkmalen. Hierbei zog man die linke Seite vor, denn sie veränderte sich bei einem Rechtshänder durch harte physische Arbeit kaum. Durch die präzisen Messungen ließ sich eine Person unzweifelhaft identifizieren. Zwei Menschen mochten nach Bertillon ein, zwei, vielleicht sogar drei übereinstimmende Werte vorweisen, doch niemals elf. Hier lag seinen Berechnungen zufolge die Wahrscheinlichkeit bei 1:268.435.456. Um selbst diese Möglichkeit auszuschließen, fügte er dem Verfahren noch drei weitere Referenzpunkte hinzu: die Augen- und Haarfarbe sowie die Farbe des Teints.
Im Februar 1883, nach einer jahrelangen Bestandsaufnahme von Daten und einer Verfeinerung des Klassifizierungssystems, identifizierte Bertillon einen Wiederholungstäter erfolgreich, eine Leistung, die als erster wissenschaftlicher Ermittlungsansatz der Kriminalgeschichte in die Annalen einging. Im Laufe der nächsten Jahre demonstrierte Bertillon den Wert seiner Methode wiederholt und ertappte 1884 nicht weniger als 241 Straftäter und sogar 425 im darauffolgenden Jahr. Am Ende der Dekade waren es schon 3.500. Ungefähr zur Mitte der 90er Jahre des 19. Jahrhunderts konnte die Polizei einen Katalog mit fünf Millionen Profilen vorweisen.
Bertillon bereicherte die Ermittlungsarbeit durch weitere Techniken. Er standardisierte das Verbrecherfoto, indem er das Anfertigen einer Frontalaufnahme und einer Seitenaufnahme festlegte. Darüber hinaus forderte er von den Kollegen, immer eine Fotokamera zum Ort eines Verbrechens mitzunehmen, um dort die sogenannten Tatortfotos zu schießen. Zwar sträubte sich der Tüftler zuerst gegen die Technik der Daktyloskopie, der Abnahme von Fingerabdrücken, da er sie als Gefahr für sein eigenes System ansah, unterstützte die Anwendung der Methode dann aber doch. Bertillons Ansehen war innerhalb kurzer Zeit so rasant gestiegen, dass der britische Schriftsteller Sir Arthur Conan Doyle seinen Protagonisten Sherlock Holmes „seine tiefe Wertschätzung für den französischen Gelehrten“ ausdrücken ließ. Im Roman Der Hund von Baskerville beschreibt Dr. Mortimer, der Gegenspieler des fiktionalen Meisterdetektivs, Holmes und Bertillon als die zwei besten Ermittler Europas.
Zur Zeit des Falls Petiot leitete Dr. Albert Paul, Paris’ höchster Gerichtsmediziner, das IML. Der 65-jährige Forensiker bzw. Leichenbeschauer, wie man diesen Berufsstand ursprünglich bezeichnete, stammte aus einer Familie von Ärzten und Rechtsanwälten. Nachdem er sein Studium unter Paul Brouardel, einem führenden Experten auf den Gebieten der forensischen Pathologie und der forensischen Entomologie, also Insektenkunde, abgeschlossen hatte, wurde Paul 1918 Professor der forensischen Medizin an der Sorbonne und arbeitete an vielen bedeutenden Fällen, von denen besonders die Morde des Henri Landru in den Jahren 1920/1921 für großes Aufsehen sorgten. Landru führte die Behörden jahrelang an der Nase herum, während er in aller Seelenruhe reiche Frauen tötete, beraubte und dann deren Körper verbrannte.
Dr. Paul knackte schließlich den Fall, indem er Landrus Technik, sich der Leichen zu entledigen, kopierte, das heißt, er verbrannte menschliche Körperteile in einem Küchenherd. „Ein rechter Fuß“, erkannte Paul, „verbrannte in 50 Minuten, ein halber Schädel mit vorher entnommenem Gehirn in 36 Minuten, ein kompletter Schädel in 70 Minuten. Ein Kopf mit Gehirn, Haaren, Zunge usw. in ungefähr einer Stunde und 40 Minuten.“ Am schwierigsten war die Beseitigung des Rumpfs und des Thorax, was mit hoher Wahrscheinlichkeit erklärte, warum der Mörder in der Rue Le Sueur die Körper zerhackte, bevor er sie in die Flammen warf.
Dr. Paul war eine Legende auf seinem Fachgebiet und auch ein gern gesehener Gast der besseren Kreise der Pariser Gesellschaft, wo man ihn wegen der vielen Geschichten kannte, die er meist mit einem makabren Sinn für Humor erzählte. Kommissar Massu hatte großen Respekt vor dem Mann, den man „den Doktor der 100.000 Autopsien“ nannte. Die zwei hatten sich bereits vor 32 Jahren zum ersten Mal getroffen, im Frühjahr 1912, als beide noch ganz am Anfang ihrer Karriere standen – Massu bei der Brigade und Paul in der alten Gerichtsmedizin am Quai de l’Archevêché, bevor er nach dem Krieg seine Arbeit am Institut aufnahm. Massu erkannte schnell, dass der Leichenbeschauer ein empfindlicher Exzentriker war, der lange Fragen hasste und „Quasselstrippen“ auf den Tod nicht leiden konnte. Wenn Massu mit dem temperamentvollen Experten arbeitete, behielt er das stets im Hinterkopf.
Beim Fall Petiot assistierte Paul ein talentiertes Forensikerteam, bestehend aus den beiden Professoren Léon Dérobert vom Naturkundemuseum und René Piédelièvre von der medizinischen Fakultät der Universität von Paris. Sowohl Dérobert als auch Piédelièvre zählten zu den anerkanntesten Kapazitäten bei der Rekonstruktion fossiler Überreste und verfügten somit über ein Fachwissen, welches sich in diesem Fall als überaus wertvoll herausstellte. Paul hegte schon von Anfang an den Verdacht, dass die Arbeit an dem Fall weitaus komplizierter sein würde als bei Landru.
Die Gerichtsmedizin erhielt den Auftrag, die Opfer zu identifizieren, und zwar aus einer grauenhaften Masse verwester und verstümmelter Überreste, die man aus der Grube, dem Ofen und dem Keller in der Rue Le Sueur geborgen hatte. Dabei mussten sie Arme, Beine, Torsi und Oberschenkel wie bei einem Puzzle zusammenfügen, was der Arbeit an einem Dinosaurierskelett für das Museum ähnelte. Die Wissenschaftler sollten im günstigsten Fall die Anzahl der Opfer ermitteln, das Alter und das Geschlecht sowie die Todesursache und den Todeszeitpunkt. Ihre Berichte zählten zu den wichtigsten Beweismitteln für die Beamten, die nach jedem sich bietenden Strohhalm griffen, um die grundlegenden Fakten zu klären.
Paul arbeitete wie ein Besessener und durchsuchte einen riesigen Haufen von „Oberschenkelknochen, Schädeln, Schienbeinknochen, Rippen, Fingerknochen, Kniescheiben und Zähnen“, die auf seinem Marmortisch lagen. Er konnte zwei beinahe vollständige Skelette und zwei halbe Torsi rekonstruieren. Bei vielen Fundstücken konnten Knochengruppen bestimmt werden, wie zum Beispiel zehn Schlüsselbeinknochen, neun Brustbeinknochen, sechs Schulterblattknochen und ein komplettes Becken, doch meist standen den Wissenschaftlern nur Fragmente zur Verfügung, zu klein oder deformiert, um identifiziert zu werden. Dr. Paul und seine Kollegen fanden so viele Einzelstücke, dass man laut Arzt damit „drei Mülltonnen“ füllen konnte. Doch nicht nur Knochen lagen in dem grausigen Haufen – auch Kopfhäute mit Haaren. Diese ergaben zusammen ein Gewicht von beinahe fünf Kilogramm.
„Es ist keine Autopsie“, meinte Paul. „Es ist ein Puzzle.“ Ein Puzzle – oder wie die Ermittler schon bald erkennen sollten – verschiedene Puzzles mit vielen fehlenden Teilchen.