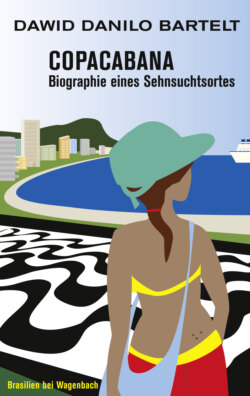Читать книгу Copacabana - Dawid Danilo Bartelt - Страница 10
Sandbank und Fels – Copacabana wird noch nicht entdeckt
ОглавлениеZurück in die Bucht von Guanabara: Es gibt eine große Gemeinsamkeit der Rio-Reisenden des 18. und 19. Jahrhunderts. Sie verschwenden bei ihrem Erstkontakt keinen eigenen Blick auf die Vielzahl der Strände, die die Fächer der Bucht zu bieten haben. Und auch im Zweitkontakt vermögen die Strände Rios wenig zu beeindrucken. Maria Graham, in Rio bald Zofe der späteren portugiesischen Königin Dona Maria, besuchte in der Umgebung von Rio nicht nur Kaffeeplantagen. Bei ihrem zweiten Rio-Aufenthalt zwei Jahre später stattete sie auch Copacabana einen Besuch ab:
»Ich schloß mich einem angenehmen Ausritt nach Copacabana an, einem kleinen Fort, das eine der kleinen Buchten hinter der Praia Vermelha verteidigt. Von dort hat man eine der schönsten Aussichten hier. Die Wälder der näheren Umgebung sind wunderschön und bringen eine exzellente Frucht in großen Mengen hervor, die Cambucá genannt wird; und zwischen den Hügeln finden sich Opossums und Gürteltiere in großer Zahl.«
Zehn Jahre später erlebte der Franzose Jean-Baptiste Debret Copacabana so:
»Mitten im Sand erblickt man die kleine Kirche, die sich auf einem kleinen Plateau erhebt. Rechts davon bildet eine Berggruppe eine zweite Ebene. Sie fällt zum Meer ab und verdeckt den Bogen dieser Sandbank. Dahinter taucht ihr äußerstes Ende auf mit seinen Feldern, geschätzt für ihre köstlichen Ananas-Früchte …«
Auf der Suche nach dem Pittoresken schweift der Blick auch über die »Sandbank« hinweg. Maria Graham erlebte den Strand von Gamboa sogar als »einen der angenehmsten Orte, die ich je betrachtet habe, mit einem wunderschönen Panorama, das alle Richtungen beherrscht«. Gamboa wurde im 20. Jahrhundert erst vom Hafen absorbiert, dann ganz eingedeicht und ist heute ein Stadtteil im Zentrum Rios.
Doch nicht einmal John Luccock, wiewohl als Brite aus dem Land der Seebadpioniere, war beim Anblick eines wahrhaftigen Badeparadieses der Gedanke an ein Eintauchen zu entlocken: Mit seinen Begleitern gelangte er zu einer »Bai, die unserer Beachtung wert schien. Sie wird auf der einen Seite vom festen Lande begrenzt, auf der anderen durch eine Restinga oder Sandbank, welche die See als Grenze sich gebildet hat. Diese Bank besteht aus weißem Sand, erhebt sich 20 Fuß über die Oberfläche der See und ist im Durchschnitt 400 Ruten breit und 20 englische Meilen lang. Größtenteils, besonders in der Mitte, ist sie ganz kahl, an andern Seiten ist sie mit verschiedenen Flechtenarten bedeckt, welche den Boden zusammenhalten, auf dem Gipfel wachsen ein wenig Unterholz und am nördlichen Ende etwas Mangle [Mangrovenbäume, D.B.]. Nach der See zu ist sie steil und die Brandung heftig; nach der Bai zu ist sie eben und sanft abhängig.«
Der Blick geht immer weg vom Strand. Der Sand hat keinen Wert, so weiß er auch ist. Weder Wellen noch ruhiges (und sicher angenehm warmes) Wasser wecken Lust auf ein Bad. Copacabana besticht durch das Panorama, interessiert aber vor allem unter militärischen Gesichtspunkten:
»Wer die Mühe nicht scheut und eine mannigfache Aussicht liebt, wird sich reichlich belohnt finden, wenn er den Telegraphen besteigt. [Dort] steht auf einem vorspringenden Felsen ein kleines Fort, welches sehr fest durch seine Lage ist, aber in jämmerlich zerfallenem Zustande sich befindet, und ohne eine einzige brauchbare Kanone, obgleich es eine Korporalwache hat. Diese Vernachlässigung ist indeß verzeihlich, indem es zu weit abliegt, um die Küste zu bestreichen, wo überdies auch die heftige Brandung die sicherste Vertheidigung ist, an den beiden äußersten Punkten der Bai ausgenommen. Der südlichste wird durch die runde, fast verfallene Kapelle Copo Cabano [sic!] verschönert. Diesen Ort sollen Schleichhändler sehr oft benutzen, indem die Wege ins Innere schmal und schwer zu passiren sind.«
Berufsspezifisch ist der Blick, den der Franzose Francis de Laporte de Castelnau um 1850 über Copacabana schweifen lässt. Auch er kommt über den Telegraphenhügel, den heutigen Babilônia, und findet sich nach steilem Abstieg »inmitten einer weißen Sandzunge, und das registriert man mit Interesse in diesen großen Ebenen: man findet keinen höheren Baum, nur hier und da einige Büsche, die wie Oasen aus dem Sand wachsen und sich aus sehr unterschiedlichen Pflanzen zusammensetzen, offenbar vor allem den Familien der Myrtazeen, der Guttiferen und der Leguminosen zugehörig …«
Es folgen lange Ausführungen über Beschaffen- und Besonderheiten von Früchten, Kakteen und anderen diesen Familien zugehörigen Pflanzen, über welchen der Botaniker gänzlich vergisst, dass er sich an einem sanft geschwungenen weißen Sandstrand befindet, der ihn auch anders entzücken könnte.
Auch das Buch des Deutschen Carl Schlichthorst über Rio de Janeiro, wie es ist legt vor allem Zeugnis ab über Schlichthorst und wie es ihm geht: schlecht natürlich, ist er doch ein arbeitsloser Soldat, der in Brasilien auf Reichtum und eine steile Karriere in der Kaiserlichen Armee hoffte und sich nun stattdessen, vor Heimweh krank, als Fremdenlegionär niedrigeren Patents und als Dolmetscher durchschlagen muss. Das Selbstbewusstsein, mit dem er seine mehr visionären als beobachtenden Beschreibungen dem Leser präsentiert, verhält sich proportional zum Mangel an Portugiesischkenntnissen. Das verschafft uns Einsichten von unfreiwilliger Komik. So sei die außerordentliche Fruchtbarkeit der Brasilianerinnen, die angeblich nicht selten zwölf bis 16 Kinder gebären, dem Zusammentreffen dreier Umstände zu verdanken: Die Frauen sitzen mit untergeschlagenen Beinen, sie schnüren sich nicht die Brüste ab, wie in Europa üblich, und sie baden sehr häufig. Die örtliche Geographie erfährt bei Schlichthorst eine einzigartige Benennung, und so wird aus Copacabana »Punto da Cabana«. Aus seinen Träumen von einer baldigen Heimreise weckt ihn sanft ein »liebliches Negermädchen«, das eine in Brasilien ansonsten unbekannte »Marimba« spielt und dieses schwere Standinstrument aus Holz und Kalebassen überraschend zwischen den Fingern hält; ein Mädchen »in der Blüthe ihrer Jahre, von herrlichstem Gliederbau, Augen wie Sterne, einem Mund, frisch wie eine eben aufgebrochene Rosenknospe, und Zähnen, welche Perlen an Glanz und Weiße übertreffen«. Sie übergibt das Instrument einer zweiten Frau, »dem Gewichte nach auch eine wahre afrikanische Schönheit«, und beginnt einen »Faddo« zu tanzen, womit der Fado gemeint sein dürfte, der im 18. Jahrhundert immerhin in einer brasilianischen tanzbaren Variante bekannt war. Das Ganze schaut sich Schlichthorst nach eigener Auskunft »mit aller Behaglichkeit eines westindischen Pflanzers« an, gemütlich auf einer Bank vor der Kirche ausgestreckt und eine Zigarre rauchend. Das »schöne Mohrenkind« singt zum Tanze dem Deutschen zufolge dieses Lied: »Auf Erden giebt’s kein Paradies! / Doch wär’ am Cariocanerstrand / Mein heißgeliebtes Vaterland, / Ich träumt’, ich wär’ im Paradies!«
Es ist hier nicht die Absicht, sich über den Autor lustig zu machen, sondern zu belegen, wie die Reisenden des 19. Jahrhunderts auch reisten: auf dem Eisbrecher ihrer Vorstellungen, der noch jedes Gestade erreicht hat. Indem sich in und an Copacabana seine erotischen Phantasien entzünden, macht Carl Schlichthorst allerdings eine für den Ort zukunftsweisende Vorläufererfahrung.