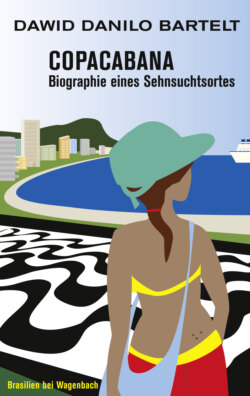Читать книгу Copacabana - Dawid Danilo Bartelt - Страница 12
Die Angst des Europäers vor dem Meer
ОглавлениеÜber Jahrhunderte hinweg ging den Europäern ein Bad im Meer wider alle Vernunft, aber auch wider allen Mythos. Denn das Meer war offen, noch nicht von Menschen durch- und vermessen und geprägt von einem unberechenbaren Chaos, das in der Vorstellungswelt der Zeitgenossen unter seiner Oberfläche tobte. Die mythologische Meeresfauna kennt gewaltige Schlangen, Wale oder den Leviathan, den biblischen Drachen. Überhaupt prägt die Bibel das Bild vom Meer als Hort von Unordnung und Instrument göttlicher Strafe, so zum Beispiel durch die Sintflut.
»Sein Brausen, sein Brüllen, die tosenden Ausbrüche seines Zorns können immer aufs neue als Erinnerung an die Sündhaftigkeit der ersten Menschen verstanden werden, die in den Fluten untergehen mußten«, wie es der Kulturhistoriker Alain Corbin in Meereslust. Das Abendland und die Entdeckung der Küste 1750 – 1840 (im französischen Original: Le territoire du vide) beschreibt.
Man darf nicht vergessen, dass die Mythologie höchst realen Verlusterfahrungen entsprach. Seefahrt war ein äußerst riskantes Unternehmen. Piraten, vor allem aber Stürme lauerten auf die Mutigen. Im Zeitalter der Entdeckungsreisen hatte sich die Schiffstechnik verbessert, doch zugleich nahmen Entfernungen und Wagnis zu. Die Flotte unter dem Kommando Pedro Álvares Cabrals, die im April 1500 Brasilien »entdeckte« und dann nach Indien weitersegelte, startete in Lissabon am 9. März 1500 mit 13 Schiffen. Am 23. Juni 1501 hatten es sechs, möglicherweise gar nur vier Schiffe geschafft, nach Lissabon zurückzukehren.
Noch bis etwa 1840 standen die Meereskatastrophen im Zentrum der Naturgeschichte der Erde und dann der Geologie. Im Angesicht des Meeres bleibt die Naturbetrachtung nicht bei der Naturwissenschaft stehen; Meer ist im Wortsinn Metaphysik. Erst die Expeditionen der Frühen Neuzeit, die ein ganzes Weltbild umstoßen, weil ihr Entdeckergeist das grenzenlose Meer einhegt, und die Ordnungsleistungen der Kartographie (wie die Erfindung der Längengrade im 18. Jahrhundert) machen den Ozean für das aufgeklärte Individuum beherrschbar.
»Küste«, »Ufer« und »Strand« hingegen scheinen fest umrissene und abgrenzbare Fix- und Orientierungspunkte zu sein. Doch auch die Küste ist ein Raum mit unscharfen Rändern, an denen sich die Elemente in unterschiedlicher Weise durchdringen.
Die Definition des Strandes im Duden trägt dieser Unsicherheit Rechnung: »Das flache und sanft ansteigende Ufer des Meeres, seltener eines Flusses oder Sees, das beim höchsten Wasserstand gewöhnlich noch überflutet wird; im allgemeinen besteht es aus Sand und kann von unterschiedlicher Länge und Breite sein; wird häufig mit dem Wort ›Küste‹ gleichgesetzt, bezeichnet aber nicht so sehr das rein sachlich Festgestellte und Gegebene, sondern beschreibt das dem Sprecher in irgendeiner Weise freundlich oder belebt erscheinende Ufer.«
Der Strand ist also weniger ein Faktum oder eine topographische Gegebenheit, sondern eher das Ergebnis einer Haltung. Der Strand ist ein kulturelles Produkt mit einer eigenen veränderlichen Materialität, jenseits von Sand, Salzluft, Sonnenschein und Brandung – und in Europa galt die Küstenlinie, das Grenzgebiet des monströsen Meeres, eben lange als ein Panoptikum der Katastrophen, an dem Wrackteile und Leichen einzusammeln waren. Und noch im 17. und 18. Jahrhundert glaubten Mediziner fest daran, dass das Meer Fäulnis errege.
Badekarren in Brighthelmstone um 1790 – Stich von Samuel Alken
Es wäre allerdings falsch zu sagen, dass die späte Sympathie für den Strand eine originäre Erfindung der Neuzeit wäre. Selbst wenn wir uns auf die europäische Kultur beschränken und bekennen, dass wir nicht wissen, ob die Tupinambá-Jugend, der Polynesier »als solcher« und die Hawaiianerinnen nicht seit jeher die Freuden des Strandes genossen haben: Schon die alten Römer hatten eine Art, sich zur Küste zu verhalten, die uns sehr bekannt vorkommt. Dieses Konzept nannte sich otium und meinte einen der römischen Oberschicht vorbehaltenen Zeitvertreib von Niveau, wie zum Beispiel Lektüre, philosophisches Gespräch, Spaziergänge und andere körperliche Ertüchtigungen. Diese Form der Selbstfindung brauchte besondere Orte. Gegen Ende der Republik kamen bei Cicero, Cäsar, Mark Anton und vielen anderen Villen in der Umgebung des kampanischen Küstenortes Pozzuoli in Mode. Dort standen Lustfahrten über das Meer, Wassersport, Bankette im Freien und Musik an.
Mit dem Untergang des Römischen Reiches aber schwand die Lust am Strand in Europa, und das Interesse an der Küste als »Landschaft« wich der mittelalterlichen Angst und Abscheu vor Ufer und Meer.
Dass Einzelne immer Vergnügen darin gefunden haben, sich am Strand aufzuhalten, dürfen wir annehmen. Doch von einer Konvention des Strandbesuchs oder einer ästhetisch verarbeiteten Naturanschauung der Küste kann erst im 18. Jahrhundert die Rede sein. Dafür brauchte es, so Corbin, das Ineinander von drei Entwicklungen, um Abscheu in Bewunderung zu verwandeln. Eine neue theologische Naturauffassung rechnete Meer und Küste nun dem Gesamtwerk der göttlichen Schöpfung zu, und die Grand Tourists entdeckten in Italien auf der Suche nach der Antike die Schönheiten der Strände. Doch vor allem war eines ausschlaggebend: Ärzte schickten ihre Patienten ans Meer, als sie die Heilkraft seines Wassers wie seiner Luft für Lungenkranke und Nervenleidende erkannten.
Die Europäer bedurften also der strengen Aufforderung jener Autorität, der sich auch João VI. unterwarf: der Medizin. Mitte des 18. Jahrhunderts folgten Lords und Earls dem Anraten britischer Hofärzte und ließen vorsichtig die See an ihre Haut heran. Der Landarzt Richard Russell hatte im Fischerdorf Brighthelmstone die spätere Thalassotherapie entwickelt, die Drüsenkranken Meerwasser verordnet. Der Gedanke war wirklich revolutionär: Das todbringende Meer konzentrierte nun in sich die Lebenskraft, die Meerluft ließ den Körper gesunden. Brighthelmstone wurde zu Brighton, dem bis heute wohl berühmtesten Seebad.
In vielen Seebädern entstanden auch Krankenhäuser, die die Badetherapie medizinisch flankierten, der Reichtum an Salzen, dazu Plankton, Algen und anderes aquatisches Kleingetier machten Meerwasser zum Multivitamin-Powerdrink des 18. Jahrhunderts.
Für die Entwicklung in Deutschland machte Georg Christoph Lichtenberg mit dem Besuch der englischen Seebäder eine »gute Entdeckung«, die er 1793 im Göttinger Taschen-Calender kundtat. Lichtenberg spielte die bereits etablierten Kur- gegen die neuen Seebäder aus, indem er erstere lobte, jedoch auf die noch heilsamere Wirkung des Meerblicks hinwies. Der Umweg über das Spa erleichterte mit Rücksicht auf kulturelle Gewohnheiten den Weg zum Strand erheblich. Nach einem positiv verlaufenen Probebad des Herzogs von Mecklenburg-Schwerin in der Ostsee entstand 1794 in Heiligendamm das erste deutsche Seebad.
Doch von Sinnlichkeit war der Strandaufenthalt auch nach Entdeckung der Seebäder noch weit entfernt. In Europa kamen zunächst die sogenannten bathing machines zum Einsatz, die teils noch Anfang des 20. Jahrhunderts in Gebrauch waren. Das waren mobile Bretterverschläge mit angeschlossenem Zelt, die vier bis sechs Personen aufnahmen. Ein Fuhrmann leitete das einspännige Gefährt ins Wasser, und die Badegäste, die sich unterwegs entkleidet hatten, stiegen, vor den Blicken der Umwelt geschützt, über eine am Gefährt befestigte Treppe hinab in die heilenden Fluten. Das Wasser musste übrigens kalt sein. John Floyer, Autor des Standardwerks History of Cold Bathing, empfahl 1702 eine Badetemperatur von unter zehn Grad Celsius!
Der Strand selbst hatte als Kulisse der Seebäder lediglich funktionalen Charakter, da er den Übergang ins flache Therapeutikum ermöglichte. Die Lust am Strand stellte sich mit den Seebädern keineswegs sofort und zwingend ein, begegnete man dort einer aufkeimenden »Vergnügungssucht« doch mit rigiden Baderegeln und beschränkte so den Strandbesuch auf das medizinisch notwendige Minimum. Da die Mediziner auch für die Seebäder von Anbeginn das Nacktbaden forderten, wird man leicht einsehen, dass jede Kulturgeschichte des Strandes zugleich auch seine Sittengeschichte ist. Seitdem die Lust am Meer erwacht war, hatten Behörden mit der Regelung der Geschlechter- und Textilienfrage zu tun. Historikern zufolge war Nacktbaden an englischen Küsten im 18. Jahrhundert die Norm, bei Männern noch weit ins 19. Jahrhundert verbreitet. In deutschen Seebädern war der ärztliche Rat nur mit Hilfe der Badekarren, also individuell und bei vollem Sichtschutz, umzusetzen. Am Strand trennten sich die Geschlechter und verhüllten sich in Ganzkörperwolle, die die Zeitläufte dann von Knöcheln und Handgelenken aufwärts Zentimeter für Zentimeter auflöste – bis zum Tanga und dem fio dental (»Zahnseide«), jenem textilen Nichts aus drei kleinen Nylondreiecken und etwas dünner Schnur, das die Brasilianerinnen in den 1970er Jahren zu tragen begannen. Wir kommen darauf zurück.
Lange waren die Bäder der (englischen) Aristokratie vorbehalten und damit tatsächlich so »exklusiv«, wie es in Zeiten des Massentourismus in der unnachahmlichen Paradoxie der Werbesprache heißt. Doch dann folgten die nouveaux riches nach, und damit war, in den Augen der Aristokraten, Snobismus und Vulgarität die Tür geöffnet. Um 1850 befand sich die britische Oberklasse in freiem Rückzug aus den heimischen Bädern und überließ die englische Küste der Mittelklasse und, später, von der Eisenbahn herbeigekarrt, den tuberkulösen Industriearbeitern aus den ungelüfteten Proletarierquartieren Manchesters oder Londons. So gewann die Meeresluft gesamtgesellschaftlich sanatorischen Wert. Den hatte sie auch für João VI.
»Das Bad tat ihm gut«, vermerkt der Berichterstatter knapp, und noch knapper: »Das Salzwasserbad machte Mode.« Der erleichterte Monarch ließ am Ort ein Badehaus errichten, das noch heute steht und das Museum der Stadtreinigung beherbergt.