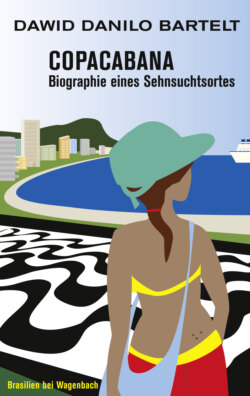Читать книгу Copacabana - Dawid Danilo Bartelt - Страница 7
Hauptstadt Portugals, Hauptstadt des Sklavenhandels: Rio im 19. Jahrhundert
Оглавление1763 wurde Rio Hauptstadt des Vizekönigreiches Brasilien, einer der größten Kolonien der »Neuen Welt«. Um 1800 hatte diese Hauptstadt etwa 43.000 Einwohner. Die Gestalt der alten Kolonialstadt veränderte sich. Die wehrhafte Festung ohne Planung und mit wenig Siedlungsraum begann, dem Modell der offenen Barockstadt zu weichen. Es entstanden Gebäude und Plätze, die der Repräsentation dienten statt einem merkantilen oder militärischen Zweck, sowie Parkanlagen, Gärten, breite Straßen und Villen. Das Geld dazu kam vom Meer und aus den Bergen. Über den Atlantik kamen die Handels- und Sklavenschiffe. Der Hafen war der Umschlagplatz einer Wirtschaft, die auf dem Export beruhte: Holz und Zuckerrohr zunächst, dann Edelmetalle und Kaffee. Basis des wirtschaftlichen Fortschritts war aber ebenso der Import Hunderttausender von Menschen schwarzer Hautfarbe, die nicht freiwillig kamen und ihr Menschsein schon verloren hatten, als sie an der Westküste Afrikas in den Schiffsbauch gestoßen wurden. Die afrikanische Beute blieb nur zu einem kleinen Teil vor Ort – als Haussklaven, Hilfsarbeiter in Hafen und Gewerbe oder in den Zuckerrohrplantagen der Region. Die meisten wurden weiterverkauft in die nach 1720 entdeckten Goldlager in den Bergen des heutigen Minas Gerais, was nichts anderes bezeichnet als die »Allgemeinen Minen«. Politische Dynamik ging von dort aus, wie durch die erste – alsbald niedergeschlagene – Unabhängigkeitsbewegung, die sich unter dem »Zahnzieher« Tiradentes 1789 in Vila Rica, dem heutigen Ouro Preto, formierte. Am Goldhandel verdiente Rio aber kräftig mit.
Die 43.000 Cariocas nahmen es weitgehend überrascht zur Kenntnis, dass sich im Januar 1808 der portugiesische Hofstaat nach Brasilien verfügte. Wohl niemand hätte sich vorstellen können, dass er 13 Jahre bleiben würde. Im März traf Prinzregent João mit seiner Entourage in Rio ein – und mit was für einer: Die Bevölkerung wuchs schlagartig um ein Drittel! Allen Schönredereien zum Trotz waren João und die Seinen vor den Truppen Napoleons, der in jener Zeit im Zenit seiner Macht stand, geflohen. Rio de Janeiro wurde so übergangsweise Hauptstadt des portugiesischen Weltreiches – das es noch immer war, wenn auch eines im freien Fall. Doch erst 1815 wurde dies amtlich, als Brasilien zum gleichberechtigten Teil des Vereinigten Königreiches von Portugal, Brasilien und den Algarven erhoben wurde. 1818 ließ sich der Prinzregent in Rio als João VI. zum König dieses Reiches krönen. Ein Jahr vorher hatte Prinz Pedro die Habsburgerin Leopoldine geehelicht. Nach der Rückkehr des Hofes nach Portugal sagte sich Pedro 1822 von seinem Vater los, und Brasilien von Portugal. Als Statthalter in Rio verblieben, erklärte er die Unabhängigkeit und sich selbst zum ersten Kaiser von Brasilien.
Daran war João VI. sicher nicht unschuldig, und vielleicht schlug er bereits den ersten Nagel in den Sarg der alten Zustände, als er eine Druckerpresse nach Brasilien mitbrachte und – absurd spät – das Totalverbot für Druckerzeugnisse aufhob. Nun konnten auch in Brasilien Zeitungen erscheinen, und damit potenzierte sich nicht nur die Menge an verfügbarer Information, sondern auch die Umschlagzeit von Austausch und Diskussion unter Intellektuellen. Ebenfalls neu war, dass Brasilien nun eine zentralisierte Verwaltung erhielt. Es entstanden Vorläuferinstitutionen des nationalen kulturellen Gedächtnisses, wie die Königliche Bibliothek (später die Nationalbibliothek), ein Botanischer Garten, ein erstes Museum. Das ließ – wieder ungewollt – bei einheimischen Geschäftsleuten, Literaten, Angehörigen freier Berufe und hohen Beamten das Bewusstsein keimen, dass Brasilien tatsächlich eine Einheit, vielleicht sogar eine Nation sei. Der Anstoß zur Unabhängigkeit ging aber von Portugal aus: Auf Druck einer liberalen Bewegung in Portugal, die eine Verfassung für die Monarchie forderte, musste João VI. 1821 nach Lissabon zurückkehren. Als die dortige Ständeversammlung auch Kronprinz Pedro zurückbeorderte und zugleich den Freihandel, die neuen zentralen Institutionen in Brasilien abschaffen und die einzelnen Provinzen wieder direkt portugiesischer Autorität unterstellen wollte, wurden in Rio Rufe nach Unabhängigkeit laut. Letztlich auch, um Brasilien für die Bragança-Dynastie zu sichern, entschloss sich Pedro, in Brasilien zu bleiben und sich selbst als Oberhaupt eines formal unabhängigen Gebiets auf den Kaiserthron zu setzen.
Die wirtschaftlichen Erwägungen der Pflanzeraristokratie und einheimischer Geschäftsleute und das politische Kalkül eines Teils der brasilianischen königlichen Beamten hatten damit die brasilianische »Nation« aus der Taufe gehoben. Eine Nation, die gleichsam auf dem Verwaltungswege begründet wurde: Der neue Kaiser löste die verfassungsgebende Versammlung alsbald auf und verfügte eine Verfassung nach seinem Gusto, die bis 1889 gelten sollte. So blieb das junge Brasilien eine Nation der Wenigen. Wählen, wo es nichts zu wählen gab, durften nur Männer über 25 Jahren mit einem bestimmten Mindestjahreseinkommen. Das waren 1872 fünf Prozent der Bevölkerung.
Während die Frauen und die ärmeren Freien sich immerhin als Brasilianer fühlen durften, so traf das für die größte gesellschaftliche Gruppe nicht zu. Zu jener Zeit hatte Rio etwa 112.000 Einwohner. Fast die Hälfte davon waren Sklaven. Der Sklavenmarkt lag bis 1824 gleich am Hafen, mitten im Zentrum. Doch auch der Valongo, der neue Sklavenmarkt, war eine der belebteren Gegenden Rios und alsbald Pflichtstation für Stadtrundgänge ausländischer Touristen. In keiner anderen brasilianischen Stadt gab es im 19. Jahrhundert »mehr Afrika«. Sklaven, in bunten Gewändern oder halbnackt, aneinandergekettet oder mit einem Korb auf dem Kopf, Sklaven, die sich als Tagelöhner verdingten, Sklavinnen, die am Straßenrand Essen verkauften, und vor allem Sklaven, die Lasten trugen: »Durch diese nützliche Menschen-Klasse werden alle Kaufmannsgüter vom Hafen in die Stadt geschafft; sie tragen vereint zu zehn und zwölf, durch Gesang oder vielmehr Geheul sich im Tacte haltend, schwere Lasten an großen Stangen«, beobachtete 1815 der deutsche Ethnologe Prinz Maximilian zu Wied-Neuwied. Sklaven trugen Wasser für die Haushalte oder Exkremente aus den Haushalten, die zusammen mit dem Müll ins Meer gekippt wurden, oder schleppten ihre Herrinnen in Sänften. Es gab kein Haus, keinen Garten, kein städtisches Handwerk und keine Manufaktur, wo nicht Sklaven tätig waren – als Hilfs-, aber auch als Facharbeiter. Sklaven liefen ausschließlich barfuß, fertigten aber Schuhe nach Maß an. Sklaven schmiedeten jene dornenbewehrten Halsbänder, die zu ihrer Bestrafung dienten. Sklaven backten das französische Weißbrot, das in Mode gekommen war und das sie selbst nie aßen. Ohne Sklaven hätte es, wirtschaftlich gesprochen, kein Rio de Janeiro des 19. Jahrhunderts gegeben.
Erst 1888, als zweitletztes Land Amerikas, schaffte Brasilien die Sklaverei offiziell ab. Sie hat vier Fünftel der bisherigen Geschichte Brasiliens nach der Eroberung von 1500 geprägt. Und sie wirkt in allen gesellschaftlichen Beziehungen nach – auch am Strand von Copacabana, wie wir noch sehen werden. Konservativen Berechnungen zufolge wurden während der Kolonialzeit, also bis etwa zu Beginn des 19. Jahrhunderts, zwei Millionen Afrikaner zwangsweise nach Brasilien verfrachtet und verkauft. Andere Schätzungen liegen bei fünf Millionen, und dabei muss man sich klarmachen, dass viele weitere zwar die Schiffe lebend betraten, aber während der Reise an den unglaublichen Zuständen unter Deck zugrundegingen. Ein Grund für die hohen Zahlen lag in der wirtschaftlichen Logik des Sklavenhandels und -gebrauchs: Die Preise für einen jungen männlichen Afrikaner waren derart, dass sich die »Sklavenzucht« nicht lohnte. Wenn der Sklave nach durchschnittlich 15 Jahren Arbeit verbraucht war und starb, war es billiger und somit rationaler, einen neuen zu kaufen, als Sklaven Kinder haben zu lassen, die dann über Jahre zu versorgen waren, bis sie denselben Nutzen brachten, zumal die Frauen als Schwangere, Wöchnerinnen und Mütter nicht die volle Arbeitsleistung bringen konnten. Es gab Sklavenfamilien, aber viele Frauen erlitten Aborte oder Totgeburten, und für die Lebendgeborenen lag die Aussicht, das Erwachsenenalter zu erreichen, bei fünf Prozent. Viele Sklavenkinder wurden ihren Eltern weggenommen und in kirchliche Findelhäuser abgeschoben. Weniger als ein Drittel von ihnen überlebte.
Natürlich hat es persönliche Beziehungen zwischen Sklaven und ihren Herren oder Herrinnen gegeben. Das gilt insbesondere für die, die im Haus tätig waren. Aber ein Sklave war, rechtlich wie faktisch, ein Wegwerfartikel. Die Sklavin Isaura, die 1986/1987 in der gleichnamigen Telenovela das Thema auf deutsche TV-Bildschirme brachte, war daher denkbar untypisch: Sie war weiß, sie kam frei und sie wurde nicht nur geliebt, sondern sogar von einem Plantagenbesitzer geheiratet.
So fußte die Gesellschaft des Kaiserreichs weiter auf einem offenen Gewaltverhältnis. Nicht nur deshalb waren die Menschen in der Stadt Rio de Janeiro ständig in Sorge um ihre Sicherheit. So etwas wie einen vertraglich gesicherten Arbeitsplatz gab es bis weit ins 20. Jahrhundert kaum. Auch der Staat hatte einem freien, aber armen Untertanen keinen Schutz zu bieten. In den nur ausnahmsweise gepflasterten Straßen bedrohten schlingernde Karren, ausschlagende Pferde, faulender Unrat und Kot das Wohlbefinden von Knochen und Nase. Und nach Einbruch der Dunkelheit, in Rio also etwa nach 18 Uhr, konnte es tatsächlich gefährlich werden. Denn »diese Stadt ist des Nachts miserabel beleuchtet«, wie 1833 der Engländer Charles Bunbury feststellte. »Viele der kleinen Straßen liegen in vollständiger Dunkelheit, in den anderen die Laternen derart weit auseinander, dass sie ihren Zweck verfehlen.« Die Klage über fehlende Straßenbeleuchtung durchzieht die Akten der Stadtverwaltung Jahrzehnt um Jahrzehnt. Gute Bedingungen für die capoeira. Capoeira bezeichnete schon im 19. und frühen 20. Jahrhundert die ritualisierten und von Musik begleiteten Kampftechniken, die heute junge Menschen in jeder europäischen Großstadt praktizieren. In der Hauptsache bildeten schwarze capoeiristas aber organisierte Gruppen, die sich der Polizei widersetzten, Passanten angriffen und Diebstähle begingen.
Die öffentliche Hand blieb nicht nur unsichtbar, sondern auch untätig. Das änderte sich zur Jahrhundertmitte. 1838 verkehrte der erste Pferdebus, ab 1850 erhielten die Straßen im Kommerzviertel Candelária flächendeckend Pflaster, 1854 brachten die ersten Gaslaternen mehr Licht in das beklagte nächtliche Dunkel. Für die 1860er Jahre konstatierte der Schweizer Johann Jakob von Tschudi bereits eine »ausgezeichnete Gasbeleuchtung: Die Flammen leuchten vorzüglich rein und klar und sind bis in die entferntesten Stadttheile in fast verschwenderischer Menge angebracht«. 1862 begann der Bau einer Kanalisation. Aber mit Ausnahme einiger Prachtstraßen wie der Rua do Ouvidor, deren Läden importierte Luxuswaren feilboten, war um die Jahrhundertmitte das Zentrum Rios, des alten kolonialen Rios, ein intensiv genutzter, kleiner Raum; eng, stickig und stinkig. Den größten Platz, den Campo de Sant’Ana, sah Tschudi 1858 so: »Man glaubt sich daselbst weit eher in einer Wasenmeisterei [Abdeckerei, D.B.], als im Mittelpunkte einer Residenz zu befinden. Verwüstete Grasplätze, ekelhafte Unrathhaufen, Leinen mit Wäsche behangen, alte, kranke Pferde und Maulthiere, die die letzten Tage ihres mühevollen Daseins hier noch so lange kümmerlich fristen, bis sie endlich todt zusammenstürzen und dann oft tagelang unverscharrt liegen bleiben.«
Die Oberen haben niemals im Stadtzentrum Rios Wohnung bezogen. Wer konnte, wohnte eher außerhalb und erhöht und überließ die Stadtstraßen den Händlern, den Wasserträgern und anderen Haussklaven, dem Markttreiben, den Mücken, dem Müll und dem Gestank.
Prinzregent João und die portugiesischen Adeligen bezogen chácaras, wie die herrschaftlichen Landhäuser genannt wurden, im kühleren São Cristóvão; die Niederen der Entourage suchten sich im benachbarten Rio Comprido eine Unterkunft. Catete, damals südlicher Stadtrand, wuchs um 1820 zum ersten Diplomatenviertel heran. Die französischen Künstler bevorzugten Tijuca, die zahlreichen englischen Geschäftsleute hingegen die strandnahen Glória, Flamengo und Botafogo, dazu etwas landeinwärts Laranjeiras, wo edle Residenzen langsam die Wochenendhäuser ablösten und Straßen die Gemüsefelder einebneten.
Und dann war in Richtung Süden Schluss. Eine Abfolge von Felsmassiven, beginnend mit dem Morro Cara de Cão, auf dem das Sankt-Johann-Fort die Einfahrt in die Bucht überwachte, weiter über den Zuckerhut, Urca, den Telegraphenhügel Babilônia, São João, Cabritos … Wie eine Wand ragten sie auf. Dahinter lagen Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon, die zwar bekannt, aber nur auf beschwerlichem Wege zu erreichen waren. Doch schon damals lohnten sie sich für eine Landpartie.