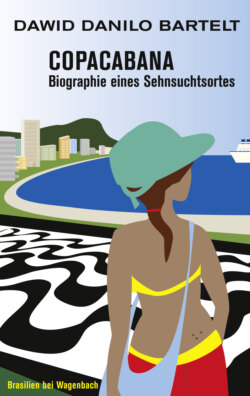Читать книгу Copacabana - Dawid Danilo Bartelt - Страница 6
Copacabana am Titicaca-See und die Schifffahrt einer Heiligen nach Rio de Janeiro
ОглавлениеCopacabana lag zwar offiziell innerhalb des Stadtgebiets, aber noch weit außerhalb aller Wahrnehmung. Es hieß auch gar nicht Copacabana, sondern Sacopenapan. Das Wort ist, dem brasilianischen Gelehrten Teodoro Sampaio zufolge, eine Abwandlung von çooco-apê-nupan und bedeutet soviel wie »Der Weg der Socós«, einem Raubvogel aus der Familie der Reiher, der in den Sümpfen lebte.
Das Kirchlein der Nossa Senhora de Copacabana (1905)
Sümpfe, Sand, Dünen, Lagunen und Felsenketten – das war das Copacabana des 16. Jahrhunderts. Das Land gehörte der portugiesischen Krone und wurde nach und nach in zumeist riesigen Lehen vergeben – der Ursprung des Großgrundbesitzes, der der brasilianischen Gesellschaft bis heute viele Probleme bereitet. Einem Versuch, nahe der großen Lagune Zucker zu produzieren, war gegen Ende des 16. Jahrhunderts wenig Erfolg beschieden. Sacopenapan hatte ab 1606 mit Afonso Fernandes wohl einen Besitzer, aber kaum neue Nutzer, und diente vornehmlich einer Viehherde als Weide.
Viele denken, dass Copacabana eine Bezeichnung aus dem Tupí-Guaraní sei, genauso wie carioca. Diese Bezeichnung für die Einwohner der Stadt (von kara‘ïwa: »weißer Mann« und oka: »Haus«) setzte sich im 18. Jahrhundert durch. Es könnte sogar Portugiesisch sein, wenn jemand einfach copa (Pokal, Kelch, Baumwipfel, auch Anrichte) und cabana (Hütte) zusammengefügt hätte. Doch das ist linguistischer Zufall. Tatsächlich ist »Copacabana« ein Wort aus einer indigenen Sprache. Aus einer allerdings, die auf der anderen Seite des Kontinents gesprochen wurde, von Rio so weit entfernt wie Moskau von Sizilien.
Der Name Copacabana ist vom Titicaca-See im Anden-Hochland aus nach Brasilien gelangt. Auf der bolivianischen Seite des Sees liegt eine Halbinsel: Copacabana. Copacabana war und ist heiliges Gebiet sowohl der alten Aymaras als auch ihrer Besatzer, der Inkas. Als die christlichen Spanier das Inkareich eroberten, knüpften sie an die religiöse Tradition an und errichteten ihrerseits ein Heiligtum. Hausherrin war Nuestra Señora de Copacabana (Unsere Liebe Frau von Copacabana).
Die schönste Bucht des auf knapp 4.000 Metern Höhe gelegenen Titicaca-Sees liegt auf der Westseite der Halbinsel, überragt von zwei Hügeln aus Basaltgestein. Dort hatten schon die Aymaras ein Dorf gebaut, das die Inkas nach 1320 zu einem blühenden Zentrum ausbauten. Die Hügel waren wie natürliche Wachtürme des Sees, und daher der Name kjopac kahuaña im Aymara. Kjopac bedeutet »See« oder auch »blau«; kahuaña heißt »Aussichtspunkt«, »Ausguck«. Im Quechua, das die Inkas sprachen, wurde daraus qopa qhawana (qopa: »türkisblau«, »Edelstein«; qhawana: »Ausguck«, »Hügel«). Die Spanier schliffen und transkribierten: Copacabana. Es hieß also soviel wie »Wacht über den See«, »Aussicht ins Blaue« oder auch »Ausblick zur blauen Perle«.
Der Titicaca-See ist der größte See Südamerikas und die nasse Naht zwischen Peru und Bolivien. Er gehört zu den wichtigen heiligen Orten Lateinamerikas. Die Bolivianer nennen ihn schlicht Lago Sagrado (Heiliger See). Copacabana ist ein religiöses Zentrum der ganzen Andenregion. Die Mythologie der Andenvölker vor der Herrschaft der Inkas nennt den See als einen der Orte der Schöpfung. Noch höhere Bedeutung verliehen der Gegend die Inkas, die dort ab dem 14. Jahrhundert herrschten. Ihnen galten die »Sonneninsel« und die benachbarte »Mondinsel« im See als Zentrum der Welt; der Tempel für den Sonnengott Wiraqocha auf der Sonneninsel war ihr heiligstes Heiligtum – ihr Jerusalem, ihr Mekka, ihr Rom.
Den Berichten zufolge, in denen Legenden und Fakten sich unauflöslich verweben, befand sich einige Jahrzehnte nach Eroberung des Inkareiches das heruntergekommene Örtchen Copacabana auf der Suche nach einem (katholischen) Schutzheiligen. Man konnte sich nicht zwischen dem Heiligen Sebastian und der Jungfrau von Candelária entscheiden. Da passte es, dass dem Indio Francisco Tito Yupanqui, vermutlich ein Nachfahr des letzten Inka-Gouverneurs von Copacabana, eine Vision zuteilwurde. Am See sitzend, blitzte vor ihm auf dem Wasser das Bild einer diademgeschmückten Frau auf. Die Jungfrau trug die Züge einer Einheimischen und das Jesuskind auf dem Arm. Yupanqui wollte das Bild künstlerisch festhalten, doch mangels Fähigkeit und Kenntnis scheiterte der erste Versuch. Er ging in die Silberminenstadt Villa Imperial (Potosí), brachte sich das Bildhauerhandwerk bei und schuf eine Holzstatue. Am 2. Februar 1582, dem Tag der Jungfrau von Candelária, wurde das Bildnis in der Kapelle von Copacabana aufgestellt.
Einige Wundergeschichten später hatte sich die »Jungfrau von Copacabana«, wie sie alsbald hieß, ersten Ruhm erworben. Insgesamt werden ihr 132 Wunder zugeschrieben. Der Synkretismus in Yupanquis Vision verfehlte seine integrierende Wirkung nicht. Die Pilger strömten nur so nach Copacabana, um der katholischen Heiligen mit sonnenkultischer Vergangenheit zu huldigen. Die meisten entstammten der indigenen Bevölkerung. Die Jungfrau leistete so einen wichtigen Beitrag zur kolonialen Mission. Schon 1614 musste eine größere Kapelle gebaut werden. Sie wich um 1670 einer Kirche, der noch heute bestehenden Basilika von Copacabana. Der 1650 gebaute Altar zeigt auf seinem Sockel Sonnenjungfrauen des Inka-Kults sowie eine Gestalt der Aymara-Mythologie, einen Menschenkopf mit leuchtend türkisblauen Augen, Schlangenhaaren und einem Raubkatzenschnurrbart: kjopac kahuaña, der »Blaue Seher«.
Nuestra Señora de Copacabana wird vor allem von Bolivianern und Peruanern verehrt, aber sie hat Gläubige in anderen Ländern Lateinamerikas sowie in Spanien, Portugal und Italien. Neben der vor allem in Mexiko und Mittelamerika verehrten Jungfrau von Guadalupe ist sie die bedeutendste Mariengestalt Amerikas.
Wann genau ein Bildnis der Jungfrau von Copacabana Rio erreichte, ist unklar. Es sollen peruanische Schmuggler gewesen sein, die sie von den Silberminen Potosís über Buenos Aires und übers Meer nach Rio mitbrachten und dort ließen, bevor sie ihre gegen das Silber eingetauschten Waren einschifften. Darunter waren auch die Sklaven, die dann ab Buenos Aires das Schmuggelgut nach Bolivien zu tragen hatten.
Ebenso wenig wissen wir, wann Fischer die kleine Kapelle ganz im Süden des Strandes auf einer abgeflachten Felsspitze errichteten, wo heute das Fort von Copacabana die zuweilen aufrührerischen Wellen bewacht. Doch der erste Aufenthaltsort der Heiligen mit Migrationshintergrund war eine Kirche in der Stadt. Dort erhielt eine Kopie der berühmten Statue vom Titicaca-See einen Altar in der Igreja da Santa Casa. 1637 musste die Jungfrau einer Nebenbuhlerin weichen. Nossa Senhora do Bonsucesso, nach der die Kirche auch bis heute benannt ist, nahm den Platz der Migrantin ein. Mitte des 17. Jahrhunderts wird die Jungfrau in der Landpfarrei Suruhy, unweit des anderen Endes der Bucht von Guanabara gelegen, aktenkundig. Dann verschwand sie im historischen Untergrund und tauchte erst 1732 wieder auf, in der ersten Nachricht von ebenjener Kapelle am Strand.
Auch hier wusste die Heilige für sich zu sorgen: Als das Kirchlein aus Lehm und Stroh über ihr zusammenzubrechen drohte, trug sie durch die Rettung eines anderen zu ihrer eigenen bei. Bischof Dom Antônio do Desterro war 1746 von Angola in die Erzdiözese Rio de Janeiro abgeordnet worden. Die Reise über den Atlantik verlief gut, und fast war der neue Bischof am Ziel, als er auf Höhe des Südendes von Sacopenapan in Seenot geriet. Gefährlich nahe ans Ufer abgetrieben, sah er auf der Felsspitze die Kapelle. In seiner Not gelobte Dom Antônio, sie zu restaurieren, sollte er den Wellen entkommen. Der Bischof überlebte und hielt sein Gelöbnis. Und die Heilige entfaltete ihren Charme weiter derart, dass alsbald ihr Name auf jenen Strand überging. Aus Sacopenapan wurde Copacabana.