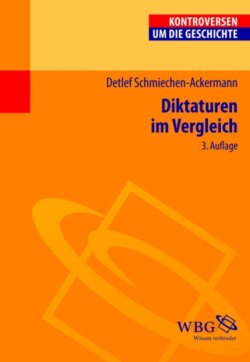Читать книгу Diktaturen im Vergleich - Detlef Schmiechen-Ackermann - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Das Signum des 20. Jahrhunderts: Aufstieg und Überwindung von „modernen“ Diktaturen
Оглавление„Die Diktatur bedroht ständig unsere Generation: wir sind es schon gewohnt, dass sie uns wie ein wildes Tier beschleicht, dessen Brüllen uns in der Nacht aufschrecken lässt, das uns so nahe kommt, dass wir manchmal seinen Atem verspüren. Jeder Abschnitt unseres Lebens ist durch eine Tyrannei gekennzeichnet. Mussolini betrat das Capitol, als wir noch mit Glaskugeln spielten; Hitler kam, als wir im Jünglingsalter standen; Franco und Pétain traten auf, als wir junge Männer waren; die Volksdemokratien entstanden, als wir den Weg der Reife beschritten; dann waren die Militärs des Mittleren Ostens an der Reihe, schließlich die unseren.“ (12, S. 7) Der französische Sozial- und Politikwissenschaftler Maurice Duverger (Geburtsjahrgang 1917) formulierte diese emphatische Warnung 1961 als einleitende Passage zu seiner Abhandlung „Über die Diktatur“, nachdem putschende Militärs während der Algerienkrise die Vierte Republik in ihre finale Krise gestürzt hatten. Überwunden wurde diese Staatskrise durch Übertragung von Sondervollmachten an die von General de Gaulle geführte neue französische Regierung und schließlich durch die Bildung der Fünften, präsidial geprägten Republik. Während des in den folgenden Jahren durchgeführten Prozesses der Dekolonisierung sah sich freilich auch das autoritäre Regime de Gaulles einer ständigen Bedrohung durch putschende Militärs ausgesetzt. „Demokratie“ und „Totalitarismus“ sind mithin, wie der Politikwissenschaftler Raymond Aron anhand des französischen Beispiels herausgestellt hat (2), nicht ausschließlich als trennscharfe systemtypologische Gegensätze zu fassen. Ebenso sind auch die autoritären und totalitären Potentiale zu analysieren, die in pluralistisch verfassten Gesellschaften vorhanden sein und im Extremfall zu deren Zerstörung führen können. Dabei ist freilich von Fall zu Fall nach den konkreten Ursachen und Rahmenbedingungen der politischen Entwicklung zu fragen und im Ergebnis sorgfältig zu differenzieren, etwa zwischen der fahrlässig „verspielten Freiheit“ der Weimarer Demokratie (30) oder der Zerstörung der spanischen Republik (ein komprimierter Überblick in: 4, S. 84ff.) sowie der bedrohlichen, aber letztlich doch bewältigten französischen Staatskrise im Übergang von der Vierten zur Fünften Republik oder der Aushöhlung der Demokratie durch den McCarthyismus (35). Dabei wird deutlich, dass auch die zweite Jahrhunderthälfte, die zumindest aus europäischer Perspektive vor allem als erfolgreiche Überwindung von diktatorischen Regimen zu beschreiben ist, noch im langen Schatten der weltanschaulich fundierten Diktaturen gestanden hat, die in der ersten Hälfte des Jahrhunderts in Ost-, Mittel- und Südeuropa einen scheinbar unaufhaltsamen Aufstieg erlebt hatten.
Die Krise der liberalen Demokratien und der Aufstieg ideologisch unterschiedlich ausgerichteter diktatorischer Bewegungen – diese beiden einander bedingenden Entwicklungen stellen für die Zeitspanne zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg das Schlüsselthema der europäischen Politikgeschichte dar. In den ersten Jahren der Zwischenkriegszeit standen diese Prozesse, psychologisch und soziologisch betrachtet, in einem engen Zusammenhang mit der Verarbeitung der Kriegsgräuel der vielfach traumatisierten und zudem nun häufig in ihren Gesellschaften „überflüssigen“ heimkehrenden Soldaten. Aus politologischer Sicht sind sie vor allem in den Kontext der schwierigen ökonomischen Bewältigung der drückenden Kriegsfolgelasten sowie des letztlich gescheiterten Versuches, eine stabile internationale Friedensordnung zu etablieren, einzuordnen.
In dem in seinen Bewertungen indifferenten und daher problematischen Sammelwerk zum „Prozess der Diktatur“ beschrieb 1930 der Herausgeber Otto Forst de Battaglia recht treffend den Zeitgeist: „Das Problem der Diktatur ist das beherrschende unserer politischen Gegenwart. Die Frage, ob das Erbe des 19. Jahrhunderts: ob die Lehre vom contrat social, die in der Ansicht von der natürlichen Gleichheit, von der angeborenen Freiheit aller Menschen wurzelnde Demokratie auch weiterhin die Staatsform des europäischen Kulturkreises bleiben solle, ist zur Diskussion gestellt und von den einzelnen Ländern, Nationen, Parteien verschieden beantwortet worden…“ (14, Geleitwort)
Unter den 28 Staaten, die im Europa der Zwischenkriegszeit existierten, befanden sich 1920 nur zwei Diktaturen: die aus der Oktoberrevolution geborene Sowjetunion sowie das autoritäre Horthy-Regime, das in Ungarn die von Bela Kun geführte kommunistische Rätediktatur abgelöst hatte (vgl. 36, S. 91 ff.). Mit dem inszenierten „Marsch auf Rom“ (am 28. Oktober 1922) und der schrittweise vollzogenen Machtübernahme Mussolinis etablierte sich die faschistische Alternative zu der in Russland aufgerichteten bolschewistischen Diktatur. Der italienische Faschismus hat in den zwanziger und dreißiger Jahren als dezidiertes Gegenmodell zur liberalen Demokratie auf viele europäische Länder ausgestrahlt, allerdings in den meisten Fällen nur zur Bildung von faschistischen Bewegungen, aber nicht zur Errichtung eines faschistischen Staates geführt (38, 58 ff.). Während sich in Großbritannien und Frankreich das demokratische System als stabil genug gegenüber den diktatorischen Herausforderungen erwies (37; 3; 29, S. 147 ff.), markierte die in Deutschland vollzogene Machtübertragung an Hitler einen entscheidenden Wendepunkt im Kräfteverhältnis zwischen demokratisch-pluralistisch verfassten und diktatorisch organisierten Gesellschaften in Europa. Bis zum Jahresende 1938 schmolz die Zahl der Demokratien auf zwölf zusammen, zwei Jahre später existierten nur noch fünf intakte demokratische Staaten: Großbritannien, Irland, Schweden, Finnland und die Schweiz (25, XI ff.). So kann für diese Periode mit Recht vom Zusammenbruch der Demokratien (13; 27; 39) und damit im Ergebnis von einem „Europa der Diktaturen“ gesprochen werden.
Der Politik- und Wirtschaftswissenschaftler Moritz Julius Bonn, nach eigener Charakterisierung ein „wandering scholar“ zwischen deutschen und amerikanischen Universitäten (5, S. 150 ff.), hatte bereits als mitlebender Zeitgenosse die „Krise der europäischen Demokratie“ als den die Zwischenkriegszeit prägenden politischen Prozess beschrieben (6). Seit den dreißiger Jahren wurde der beinahe unaufhaltsam erscheinende Aufstieg der Diktaturen und die bedrückende und zeitweise übermächtigende Erfahrung von „totalitärer“ Herrschaft nicht nur im unmittelbar betroffenen Europa, sondern auch in den USA zu einem beherrschenden Thema der historischen, vor allem aber auch der politik- und sozialwissenschaftlichen Forschung (vgl. hierzu Kap. III, 1). Während des Zweiten Weltkriegs und in der frühen Nachkriegszeit entstanden, häufig von aufgrund der nationalsozialistischen Verfolgungsmaßnahmen nach Amerika emigrierten Wissenschaftler(inne)n verfasst, grundlegende Referenzwerke der Diktatur- und Totalitarismusforschung wie etwa Sigmund Neumanns „Permanent Revolution“ (1942), Hannah Arendts „The Origins of Totalitarianism“ (1951) und „Totalitarian Dictatorship and Autocracy“ (1956) von Carl Joachim Friedrich und Zbigniew Brzesinski (31; 1; 15 sowie 10 und 16). Der in Prag geborene, seit 1934 in den USA tätige Historiker Hans Kohn beschwor in seiner 1950 vorgelegten „Zwischenbilanz“ zum zwanzigsten Jahrhundert die „Wiederbelebung des demokratischen Verantwortungsgefühls“ als Mittel gegen die bleibende Herausforderung durch Diktaturen und Revolutionen, mit der sich die westliche Zivilisation auseinander setzen müsse. Die erste Jahrhunderthälfte verstand er dabei als „Jahre der tödlichen Krise“, die deutlich gemacht hätten, „wie verwundbar die Zivilisation ist.“ (23)
Zwar wird bis heute über unterschiedliche Forschungsansätze und Deutungsmuster kontrovers debattiert (vgl. Kap. III, 1), gleichzeitig hat sich mit wachsender zeitlicher Distanz aber auch nachdrücklich bestätigt, dass die Krise der liberalen Demokratie und der damit korrespondierende Aufstieg von Diktaturen in der ersten Hälfte des Jahrhunderts (sowie deren Überwindung in der zweiten Jahrhunderthälfte) in makrohistorischer Sicht die zentralen Entwicklungsprozesse in der politischen Geschichte des 20. Jahrhunderts darstellen. Dies gilt in ganz besonderem Maße aus der europäischen Perspektive, die den Bezugsrahmen dieses Bandes bildet, lässt sich allerdings auch auf den außereuropäischen Bereich übertragen (17).
In Deutschland wird seit dem Fall der Berliner Mauer und der friedlichen Revolution in der DDR intensiv über eine angemessene Einordnung der SED-Herrschaft in die deutsche Geschichte und, hiermit eng zusammenhängend, über den Vergleich der beiden deutschen Diktaturen gestritten. Auf internationaler Ebene war es der Zusammenbruch der Sowjetunion (1991) und das damit verbundene Ende des über vier Jahrzehnte die Weltpolitik dominierenden Ost-West-Gegensatzes, die sehr bald als markante Zäsur der Weltgeschichte identifiziert wurden. Innerhalb weniger Jahre entstand eine größere Zahl von bilanzierenden Analysen und Interpretationen zu der als nunmehr abgeschlossen betrachteten Epoche. Große Aufmerksamkeit wurde dem welthistorisch angelegten Rückblick des britischen Sozialhistorikers Eric Hobsbawm zuteil, der das aus seiner Sicht „kurze“, nämlich nur von 1914 bis 1991 zu datierende, 20. Jahrhundert prägnant als „Zeitalter der Extreme“ („Age of Extremes“) charakterisiert hat. Für ihn ist diese Epoche in drei Abschnitte gegliedert: Mit der „Epochenschwelle“ (vgl. hierzu 24) des Ersten Weltkriegs beginnt das „Katastrophenzeitalter“, das über das Jahr 1945 hinaus auch noch die unmittelbaren Nachwirkungen des Zweiten Weltkriegs umfasst. Es wird in Hobsbawms Zeitraster abgelöst von einem „Goldenen Zeitalter“, das in etwa mit dem dritten Viertel des Jahrhunderts deckungsgleich ist, um danach mit den achtziger und neunziger Jahren für große Teile der Welt erneut in eine neue „Ära des Verfalls, der Unsicherheit und Krise“ zu münden (17, S. 20ff.). Hobsbawms welthistorische Betrachtung endet – trotz der Überwindung der großen „weltanschaulich“ geprägten Diktaturen – mit einem skeptischen „Blick ins Dunkle“, bei dem der „Zusammenbruch des einen Teils der Welt“ (gemeint ist neben dem ehemaligen Sowjetimperium vor allem Afrika) am Ende nur die „Malaise des anderen“, also der wirtschaftlich und politisch tonangebenden Industriestaaten, enthüllt (17, S. 24). Seine kritische Gesamtbilanz der Epoche und der sich abzeichnenden Zukunftsperspektiven steht in einem diametralen Gegensatz zur „metaphysischen Prophetie“ (so Hobsbawm (17, S. 21) in polemischer Zuspitzung gegen den amerikanischen Politikwissenschaftler Francis Fukuyama), die nach dem nahezu weltweiten Triumph des liberalen Kapitalismus in überschießender Euphorie das „Ende der Geschichte“ verkündet hatte, was postwendend durch mörderische (Bürger-)Kriege und „ethnische Säuberungen“ in den neunziger Jahren ad absurdum geführt worden ist.
Pessimistische Prognosen sind unter den „Nachrufen“ auf das vergangene Jahrhundert zahlreich vertreten. Aus ganz anderer Warte als der ehemals marxistisch orientierte, heute linksliberale Sozialhistoriker Hobsbawm hat der amerikanische Politologe Samuel P. Huntington vor einem drohenden „Kampf der Kulturen“ gewarnt, bei dem sich die westlichen Zivilisationen im Kontext der „multipolaren, multikulturellen Welt“ des 21. Jahrhunderts auf neuartige Herausforderungen einzurichten hätten. Dabei werde die überwundene Rivalität der Supermächte USA und Sowjetunion durch einen „Konflikt der Kulturen“ abgelöst. In dieser künftigen Weltordnung „werden die hartnäckigsten, wichtigsten und gefährlichsten Konflikte nicht zwischen sozialen Klassen, Reichen und Armen oder anderen ökonomisch definierten Gruppen stattfinden, sondern zwischen Völkern, die unterschiedlichen kulturellen Einheiten angehören“ (19, S. 24). Eine „zentrale Achse der Weltpolitik nach dem Kalten Krieg“ und eine sehr sensible neue Konfliktlinie sei dabei die Positionierung der westlichen Zivilisation gegenüber dem islamischen und fernöstlichen Fundamentalismus.
Die totalitäre Form der Diktatur, der „totale Staat“ sei „das politische Phänomen des 20. Jahrhunderts“, hatte der nach Großbritannien emigrierte Jurist Gerhard Leibholz bereits im November 1946 in einem Rundunkvortrag erklärt, den er im Rahmen einer Vorlesungsreihe für die BBC hielt (26). Zahlreiche Historiker und Politologen (von Klaus Hornung und Ernst Nolte bis Friedrich Pohlmann, Eckhard Jesse und Karl Dietrich Bracher) haben diese Sichtweise aufgenommen und bezeichnen daher das 20. Jahrhundert als das „Zeitalter des Totalitarismus“. Dabei verzerrt Hornung allerdings die Konturen seines komplexen Untersuchungsgegenstandes. In seiner auf frühere Arbeiten gestützten „Bilanz des 20. Jahrhunderts“ (18) verfolgt er das Phänomen des „politischen Messianismus“ historisch zurück bis in die Phase der jakobinischen Diktatur, um im nächsten Schritt den von ihm in den Schriften von Marx und Engels identifizierten kommunistischen Messianismus politisch-moralisch für das spätere Auftreten totalitärer Herrschaft haftbar zu machen. Gleichzeitig blendet er aber den historischen Entstehungsort des „stato totalitario“, nämlich den italienischen Faschismus, sowie das Versagen der bürgerlichen Eliten angesichts der faschistischen Herausforderung vollständig aus. Im Ergebnis prägt eine ideologiegeleitete Sichtweise die gesamten Anlage dieses einseitig ausgelegten Bilanzversuches. Dabei wird der totalitäre Charakter der stalinistischen Sowjetunion und des NS-Staates weitgehend auf eine statische Momentaufnahme reduziert, indem sowohl die konkreten historischen Entstehungsbedingungen als auch die, jedenfalls im Falle der Sowjetunion, bemerkenswerten Wandlungsmöglichkeiten überhaupt nicht zur Kenntnis genommen werden. Schließlich werden „Hitler und der totalitäre Nationalsozialismus“ als „Gegen- und Nachbild“ (18, S. 184 ff.) zur „totalitären Despotie“ Stalins konstruiert, während die Vorbildrolle Mussolinis und die Ursachen für den Zerfall des bürgerlichen Liberalismus ausgeklammert werden. Damit kommt Hornung den in den späten Schriften Ernst Noltes vertretenen Thesen recht nahe, die darauf hinauslaufen, die NS-Bewegung als quasi verständliche und moralisch legitimierte Reaktion auf die „bolschewistische Herausforderung“, mithin gleichsam als präventive Maßnahme im Rahmen eines von 1917 bis 1945 währenden „europäischen Bürgerkriegs“ zwischen Nationalsozialismus und Bolschewismus (32) oder gar eines fast über das ganze 20. Jahrhundert ausgreifenden „Weltbürgerkriegs“, zu interpretieren. Mit starken Argumenten ist diesem Ansatz und seinen Vertretern vorgeworfen worden, dass die beispiellosen Verbrechen der NS-Zeit durch die exklusive Überbetonung des kausalen Zusammenhanges der beiden Extremformen der Diktatur in unzulässiger Weise relativiert werden. Insofern spiegeln einige der vorgelegten „Bilanzen“ zum gerade vergangenen 20. Jahrhundert, teilweise in modifizierter Form, noch einmal die Fronten und kontroversen Grundsatzpositionen des „Historikerstreits“ der achtziger Jahre wider.
Als der wohl konsequenteste Verfechter der Totalitarismustheorie in den in Deutschland über mehrere Jahrzehnte geführten kontroversen konzeptionellen Debatten ist Karl Dietrich Bracher anzusehen. Sein Bemühen richtete sich in den siebziger Jahren vor allem darauf, den wissenschaftlichen Kern dieses Forschungsansatzes gegen die durchaus eingeräumte geschichtspolitische Instrumentalisierung während des „Kalten Krieges“ zu verteidigen (7, S. 59 ff.). Für Bracher ist das 20. Jahrhundert im Rahmen eines theoretisch weit ausgreifenden systemtypologischen Analysekonzeptes, das sich nicht zuletzt auch auf eigene bahnbrechende Studien zum Verfall der Weimarer Demokratie und zum Charakter des NS-Staates als „deutsche Diktatur“ stützen kann, als „Zeitalter der ideologischen Auseinandersetzungen zwischen demokratischen und totalitären Systemen“ (8) bzw. als „Jahrhundert der Ideologien und Totalitarismen“ (9, S. 31) zu charakterisieren. Auf einer ähnlichen Interpretationslinie bewegt sich Eckhard Jesse, für den 1917, 1933, 1945 und 1989 als „Schlüsseljahre“ die entscheidenden Zäsuren im „Zeitalter des Totalitarismus“ markieren (22; ähnlich auch: 34). Zwar wird die Überwindung des „Großtotalitarismus“ als Leistung der Demokratie herausgestellt, denn so Jesse, „totalitäre Systeme vom Schlage der kommunistischen Sowjetunion oder des nationalsozialistischen Deutschland […] haben keine Wirkungsmacht mehr“ (21, S. 30), aber gleichzeitig – unter Verweis auf die Kriege und nationalistischen Exzesse der neunziger Jahre – vor überzogenen Optimismus gewarnt, da „diktatorische Gefahren“ auch nach dem Ende des „Zeitalters des Totalitarismus“ eben keineswegs ein für alle mal gebannt sind. Erheblich kritischer fällt Mark Mazowers Rückblick auf das Europa des 20. Jahrhunderts aus, das er als „dunklen Kontinent“ identifiziert (28). Er hebt dabei auf drei große rivalisierende Ideologien ab, die nach dem Ersten Weltkrieg einen unversöhnlichen und nur knapp entschiedenen Kampf um die politische Definitionsmacht über das moderne Europa führten: den Kommunismus, den Nationalsozialismus und die liberale Demokratie, als deren wichtigsten Repräsentanten er Woodrow Wilson herausstellt (ähnlich auch 33).
Eberhard Jäckel argumentiert in seiner stark aus der nationalgeschichtlichen Perspektive komponierten politikgeschichtlichen Bilanz, die zu Ende gegangene Epoche sei – freilich im negativen Sinne – das „deutsche Jahrhundert“ gewesen, denn kein anderes Land habe „Europa und der Welt im 20. Jahrhundert so tief seinen Stempel eingebrannt wie Deutschland, schon im Ersten Weltkrieg, als es im Mittelpunkt aller Leidenschaften stand, dann natürlich unter Hitler und im Zweiten Weltkrieg, zumal mit dem Verbrechen des Jahrhunderts, dem Mord an den europäischen Juden“ (20, S. 7f.). In gewisser Hinsicht gelte dies aufgrund der Nachwirkungen der genannten Faktoren sogar für die Zeit nach 1945. Jäckel konstatiert, Deutschland sei in Gestalt des „Dritten Reiches“ einen „besonderen Weg gegangen“, der als „schreckliche Abweichung von den westlichen Traditionen der Demokratie und der Menschenrechte“ zu kennzeichnen sei, auch wenn es sich dabei keineswegs um einen spezifischen deutschen „Sonderweg“ gehandelt habe (20, S. 9).
Der in Tel Aviv und Leipzig lehrende Historiker Dan Diner hat schließlich eine „universalhistorische Deutung“ des gerade vergangenen Saeculums vorgelegt (11). Wie viele andere Erklärungsansätze auch, trägt diese zwar stark eurozentrische Züge, zeichnet sich aber durch die ungewöhnliche Verschiebung der Untersuchungsperspektive vom Zentrum an die Peripherie, von West- nach Osteuropa aus. Diner betrachtet aus diesem Blickwinkel das 20. Jahrhundert durch die Untersuchung einer Reihe miteinander verbundener Antagonismen: Freiheit versus Gleichheit, Bolschewismus versus Antibolschewismus, Kapitalismus versus Kommunismus, Ost gegen West, Demokratie gegen Diktatur. Dabei kommt er zu dem Schluss, dass ein „angemessener Zugang“ zur untersuchten Epoche nur erreicht werden kann, indem die beiden aus seiner Sicht konstitutiven und sich ergänzenden Deutungsachsen zur Interpretation der neueren europäischen Geschichte miteinander „verschränkt“ und konzeptionell verbunden werden. Die vordergründig dominierende sei die des „Weltbürgerkrieges der Werte und Ideologien“, der freilich bei Diner keineswegs eine legitimierende und damit relativierende Funktion erhält wie bei Ernst Nolte, sondern, analog zu Hobsbawm, als problematische Ausgangslage einer durch die „Urkatastrophe“ des Ersten Weltkriegs und den Niedergang des Liberalismus gezeichneten Epoche verstanden wird. Für Diner bleibt diese „ideologische“ Deutungsachse aber unterlegt durch eine traditionelle, aus dem 19. Jahrhundert stammende: nämlich die von „Ethnos und Geographie“, die zwischenzeitlich zwar in erheblichem Maße überdeckt worden war, aber seit dem Ende des Ost-West-Gegensatzes wieder verstärkt an Wirkungsmächtigkeit gewonnen und ihre über lange Jahre unterdrückte zerstörerische Energie entfaltet habe. Letztlich ist für Diner die strikte Gegenüberstellung von Demokratie und Diktatur in nachdiktatorialen Gesellschaften zwar aus „volkspädagogischen“ Gründen „erforderlich“, aber als Leitlinie zur Strukturierung der europäischen Geschichte im 20. Jahrhundert eher „wenig überzeugend“. Unter Rückgriff auf ältere Überlegungen von Henry A. Turner wirft Diner die Frage auf, ob angesichts des Zersetzungsprozesses der Weimarer Republik, des „Verfalls der republikanischen und parlamentarischen Optionen die angemessene historische Sichtweise nicht besser von einer Entgegensetzung von Diktatur und Diktatur auszugehen hätte als von der idealtypisch vorgegebenen Dichotomie von Diktatur und Demokratie“ (11, S. 137f.).
Allen hier vorgestellten „Nachrufen“ auf das 20. Jahrhundert ist gemeinsam, dass das Phänomen der modernen Diktaturen im Rahmen unterschiedlicher Interpretationsansätze, gleichermaßen in sozial- und politikgeschichtlicher wie in politologischer oder geschichtsphilosophischer Perspektive sowie aus nationaler ebenso wie aus europäischer oder weltgeschichtlicher Perspektive, eine zentrale Rolle spielt. Allerdings treten Tyranneien und Despotien in unterschiedlichen Formen und Ausprägungen bereits in der antiken Welt, im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit auf. Aber erst in den „modernen Diktaturen“ des 20. Jahrhunderts gewinnt das epochenübergreifende Gesamtphänomen der Diktatur eine zeittypische Gestalt, die den erheblich erweiterten technologischen Möglichkeiten der industriellen Welt entspricht.