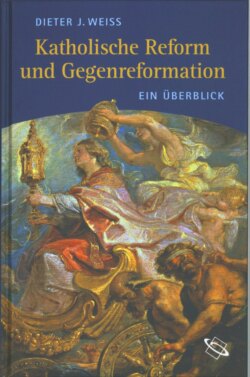Читать книгу Katholische Reform und Gegenreformation - Dieter J. Weiß - Страница 22
Staatskirchenpolitik und Reform am Beispiel des Herzogtums Bayern
ОглавлениеDas landesherrliche Kirchenregiment war bei manchen Territorien und Städten des Reiches bereits vor der Reformation ausgeprägt. Während der Einfluss des Kaisers auf die Reichskirche zurückgedrängt wurde, griffen die Reichsfürsten und Städte nach weit reichenden Aufsichtsrechten über die Kirche. Neben der Gründung von Residenzstiften für die Erledigung von Verwaltungsangelegenheiten erwarben sie sich Einfluss durch ein Bündel staatskirchlicher Ansprüche: Besteuerungsrechte auf Kirchengüter, Eingriffe in die geistliche Gerichtsbarkeit, Patronatsrechte und Visitationsprivilegien. Gestützt auf Elemente des mittelalterlichen Eigenkirchenwesens wurde die äußere Verwaltung kirchlicher Institutionen und Einkünfte weltlicher Kontrolle, wurden Pfarreien und Klöster staatlicher Visitation unterworfen. Die meisten Erzbistümer und Bistümer der Reichskirche blieben aber außerhalb des direkten Einflusses der Landesherren. Während in Bayern das Bemühen um die Errichtung eines Residenzbistums scheiterte, konnte Kaiser Friedrich III. (1440 –1493) 1469 in Wien und Wiener Neustadt die Gründung von – freilich kleinen – Landesbistümern durchsetzen.
Ein Beispiel für erfolgreiche Staatskirchenpolitik bildet das Herzogtum Bayern, das zum überwiegenden Teil in der Kirchenprovinz Salzburg lag. Zu dieser Metropolie gehörten die Fürstbischöfe von Freising, Passau und Regensburg, die jeweils über kleine eigene Territorien verfügten. Größeren Anteil am Herzogtum hatten auch die Bischöfe von Augsburg und Eichstätt, die zur Mainzer Kirchenprovinz gehörten. Den Herzögen stand für kirchliche Angelegenheiten also kein einheitlicher Ansprechpartner zur Verfügung. Beim Ausbau staatskirchlicher Rechte stützten sie sich auf die enge Zusammenarbeit mit dem Papsttum und den Reformkonzilien. So verfügten sie über bedeutende Rechte wie fallweise die Dezimation – die Einziehung eines Zehntels der geistlichen Einkünfte –, die Visitation der Klöster und die Besetzung zahlreicher Stellen. Bereits im 15. Jahrhundert hatten sie die Zivil- und einen Teil der Strafgerichtsbarkeit über den Klerus an sich gezogen, die ältere Steuerfreiheit der Geistlichkeit beseitigt und die Oberaufsicht über das Ortskirchenvermögen beansprucht. Dabei konnten sie sich auf die Rechtsinstitute des Patronats und der Kirchenvogtei stützen. Aus diesen innerlich nicht zusammenhängenden Teilstücken wurde nach 1522 ein förmliches System (praxis Bavariae) ausgebaut.
Auch in Bayern traten Sympathisanten Martin Luthers und evangelische Gläubige auf. Der Aufbau fester kirchlicher Strukturen wurde aber von der Politik unterdrückt. Dies stellt noch keine Besonderheit dar. Außergewöhnlich war allein die Tatsache, dass diese Haltung konsequent durchgesetzt und beibehalten wurde. Das Wormser Edikt vom Mai 1521 wurde in Bayern durchgesetzt. Die letztlich in der Person der Herzöge liegenden Motive für die bayerische Kirchenpolitik werden sich nicht ergründen lassen: Politische Gesichtspunkte spielten eine Rolle, die Wahrung der landesfürstlichen Hoheit nach innen gegenüber dem Adel wie die Anlehnung an die kaiserliche Religionspolitik. Eine Bayern vergleichbare Haltung nahm zunächst Herzog Georg der Bärtige von Sachsen (1500 –1539) ein, der am 10. Februar 1522 ein scharfes Religionsedikt in altgläubigem Sinne erließ. Später bemühte er sich um die Durchsetzung einer Reformordnung auf erasmianisch-humanistischer Grundlage, um dadurch der Reformation die Spitze zu nehmen.
Grünwalder Konferenz (10. Februar 1522)
Die Herzöge Wilhelm IV. (1508 –1550) und Ludwig X. (1516 –1545) einigten sich auf die Grundlinien ihrer Religionspolitik: Ablehnung der Reformation Martin Luthers bei gleichzeitiger Umsetzung eines Reformprogramms mit staatskirchlichen Mitteln. Dazu drängte Bayern zur Einberufung eines geistlichen Reformkonvents. Hier wurde das Programm der bayerischen Religionspolitik festgelegt, wie es die folgenden Jahrhunderte bestimmen sollte.
Das erste bayerische Religionsmandat (5. März 1522) forderte die Beamten zum Einschreiten gegen lutherische Tendenzen auf. Der Leiter der Innenpolitik, Leonhard von Eck (1480 –1550), hatte den Text aufgrund der Vorarbeiten von Ingolstädter Professoren entworfen. Da eine Reihe der von Luther vertretenen theologischen Positionen von Papst und Kardinälen verworfen worden sei und sein Wirken zur Zerrüttung von göttlicher und menschlichen Ordnung führe, forderten die Herzöge die Untertanen zum Festhalten am alten Glauben auf. Die Verbindung staatlichen Glaubenszwanges mit obrigkeitlichen Reformmaßnahmen blieb konstitutiv für die Geschichte Bayerns im konfessionellen Zeitalter (Walter Ziegler).
Ende Mai 1522 wurde in der salzburgschen Exklave Mühldorf am Inn ein Reformkonvent für die Kirchenprovinz abgehalten. Der Erzbischof von Salzburg und die Bischöfe von Freising, Passau und Chiemsee, der Propst von Berchtesgaden und mehrere Äbte besuchten die Synode persönlich. Sie beschlossen neben einer Generalvisitation und einer Provinzialsynode das Einschreiten gegen häretische Geistliche und lutherische Druckereien. Die Bischöfe beantworteten aber die herzoglichen Reformforderungen mit Gegenvorwürfen bezüglich staatlicher Eingriffe in ihre Jurisdiktion und wirkten so eher hemmend gegen eine tiefer gehende Erneuerung.
Die bayerischen Herzöge beschritten den Weg der engen Zusammenarbeit mit Rom, um so einen Ausbau der staatlichen Kirchenhoheitsrechte zu erreichen. Dr. Johannes Eck verhandelte in ihrem Auftrag 1523/24 mit den Päpsten Hadrian VI. und Clemens VII. Er erhielt dabei mehrere Privilegien für Bayern: die Erhebung einer „Türkenquint“ (ein Fünftel der geistlichen Einkünfte), deren Erträge auch zur Bekämpfung der Lutheraner verwendet werden durften, die Ausübung der Strafgerichtsbarkeit über den Klerus durch eine vom Herzog einzusetzende Prälatenkommission und Nominationsrechte für eine Vielzahl von Pfründen, die bald auf alle Verleihungen in den päpstlichen (= ungeraden) Monaten ausgedehnt wurden. Die engen Beziehungen zur Kurie entwickelten sich zu einem wesentlichen Instrument der bayerischen Staatskunst auch in den folgenden Jahrhunderten.
Die Festlegung Bayerns auf die Bewahrung des katholischen Glaubens wurde zunehmend zum Movens der gesamten Politik. Beim Regensburger Konvent betrieb Leonhard von Eck seinen Plan eines Sonderbündnisses katholischer Mächte: Bayern, Erzherzog Ferdinand, Salzburg und die oberdeutschen Fürstbischöfe sollten ihn zur Koordinierung ihrer Politik bilden.
Der Regensburger Konvent trat auf Anregung des Erzherzogs Ferdinand, des nachmaligen Königs und Kaisers (1531/1556 –1564), und des Kardinallegaten Lorenzo Campeggio (1474 –1539) im Juni 1524 zusammen. Die Teilnehmer verpflichteten sich zum Festhalten an der überlieferten Kirchenlehre und -praxis, zur Verschärfung der Zensur, zum Einsatz des weltlichen Armes zur Bekämpfung der Reformation und zur Beachtung des Wormser Edikts (Regensburger Einung 6. Juli 1524). Dazu wurde eine über Mühldorf hinausgehende Reformordnung in gemeinsamer Verantwortung weltlicher und geistlicher Fürsten verabschiedet. Sie beinhaltete die Kontrolle der Predigttätigkeit durch die bischöflichen Ordinariate, eine Lebens- und Prüfungsordnung für die Priester und die Abhaltung von Diözesansynoden. Die Wirkung der Reformnormen wurde aber dadurch beeinträchtigt, dass die Einsprüche der oberdeutschen Bischöfe zur Seite geschoben wurden, während die anderen Bischöfe gar nicht beteiligt waren.
In Bayern wurden seit 1524 periodische Visitationen durchgeführt. Dadurch erweiterten die Herzöge ihre Aufsicht über Kirchen- und Klostervermögen zum Kontrollrecht über Glauben, Disziplin und Amtsführung der Kleriker und Mönche. Die Prälatenwahlen (Äbte und Stiftspröpste) bedurften staatlicher Bestätigung. Die Herzöge wollten für die Predigt des wahren Evangeliums durch geprüfte Prediger und die Erneuerung des Klerus Sorge tragen. Aus Angst um ihre Jurisdiktion und wohl auch aus Lässigkeit sorgten die Bischöfe nicht für die entschlossene Umsetzung der Regensburger Beschlüsse.
Im Zusammenhang mit der energisch umgesetzten Reformpolitik sind repressive und konstruktive Maßnahmen zu unterscheiden. Erstere beruhten vor allem auf dem zweiten Religionsmandat vom 2. Oktober 1524, das durch das Anwachsen der evangelischen Bewegung im Herzogtum ausgelöst wurde. Die verurteilten Lehren und das strafwürdige Verhalten waren hier festgehalten, eine Zensur für alle Druckwerke wurde eingeführt und die Rückkehr aller bayerischen Studenten aus Wittenberg angeordnet. Die katholische Sakramentenlehre und Praxis wurden festgeschrieben, nur bischöflich geprüfte Priester sollten predigen dürfen. Als Strafen wurden Gefängnis und Meldung an den Herzog angedroht. Nach 1524 verschärfte sich das Vorgehen, 1527 kam es zu drei Hinrichtungen, dann konzentrierte sich die Verfolgung auf die Täufer. Ein drittes Religionsmandat wurde am 19. Mai 1531 erlassen, das – gestützt auf den Abschied des Augsburger Reichstags von 1530 – alle abweichenden Lehren verbot und zur Abstellung von Missbräuchen in der Kirche aufforderte.
Verbote und Strafen standen in engem Zusammenhang mit aufbauenden Maßnahmen religiöser und politischer Art. Die bayerischen Herzöge waren überzeugt, dass es ihre Pflicht sei, zur Reform der Kirche mit staatlichen Mitteln einzugreifen. Die beklagten Missstände erklärten sie mit Versäumnissen der Hierarchie und des Klerus. Damit war der Weg zur Zusammenarbeit mit dem Papst, dem Kaiser und den katholischen weltlichen Reichsfürsten wie die Frontstellung gegen die Bischöfe vorgezeichnet.