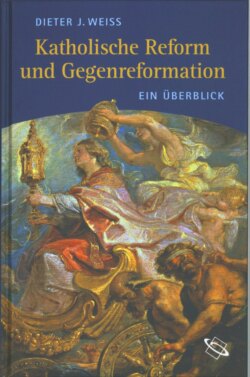Читать книгу Katholische Reform und Gegenreformation - Dieter J. Weiß - Страница 21
Die Auswirkungen der Reformation
ОглавлениеDer Augustinereremit und Wittenberger Theologieprofessor Martin Luther beklagte am 31. Oktober 1517 in 95 an den Erzbischof von Magdeburg und Kurfürsten von Mainz, Albrecht von Brandenburg (1490 –1545), gerichteten lateinischen Thesen die kommerzialisierte Ausbeutung des Ablasses und damit der Heilssehnsucht der Gläubigen. 1518 wurde Luther beim Reichstag in Augsburg durch den päpstlichen Kardinallegaten Thomas de Vio Cajetanus (1469 –1534) verhört, 1519 zweifelte er bei der Leipziger Disputation mit dem Ingolstädter Professor Johannes Eck (1486 – 1543) die Unfehlbarkeit der Konzilien an, noch ohne an eine Kirchenspaltung zu denken. 1520 verkündete er in seinen großen Programmschriften die These vom Papst als Antichristen, auch lehnte er nun das katholische Verständnis vom Messopfer und vier der sieben Sakramente ab. Darauf wurde ihm mit der Bulle Exsurge Domine (15. Juni 1520) der Kirchenbann angedroht. Beim Wormser Reichstag 1521, auf dem seine erste Begegnung mit Kaiser Karl V. (1519 –1556, † 1558) stattfand, wurde über ihn die Reichsacht verhängt (Wormser Edikt).
Obwohl auch Luthers Anhänger geächtet wurden, breiteten sich seine Gedanken weiter aus, zumal der Kaiser nicht zur Durchsetzung des Wormser Edikts in der Lage war. Die evangelische Bewegung fand breiten Zulauf, weil sich die religiöse Sehnsucht und die gesellschaftlichen Bestrebungen vieler Menschen in ihren Forderungen wiederfanden. Der Protestantismus erfuhr mit der von Philipp Melanchthon (1497–1560) für den Augsburger Reichstag 1530 verfassten Confessio Augustana eine wesentliche konfessionelle Verfestigung. Die Mehrzahl der weltlichen Reichsstände schloss sich in den folgenden Jahrzehnten der Reformation an, ihnen folgten auch in von katholischen Fürsten regierten Ländern ein Teil des Adels und der Städte. Der Wille zur Selbstreform wie zur Selbstverteidigung war unter den Vertretern der alten Kirche nur schwach ausgeprägt. Formal katholisch blieben die habsburgischen Erblande (zumindest seitens der Landesherrschaft und der Kirchenorganisation) und das Herzogtum Bayern sowie die süd- und westdeutschen geistlichen Reichsstände, vor allem wenn sie Anlehnung an benachbarte weltliche katholische Fürsten fanden.